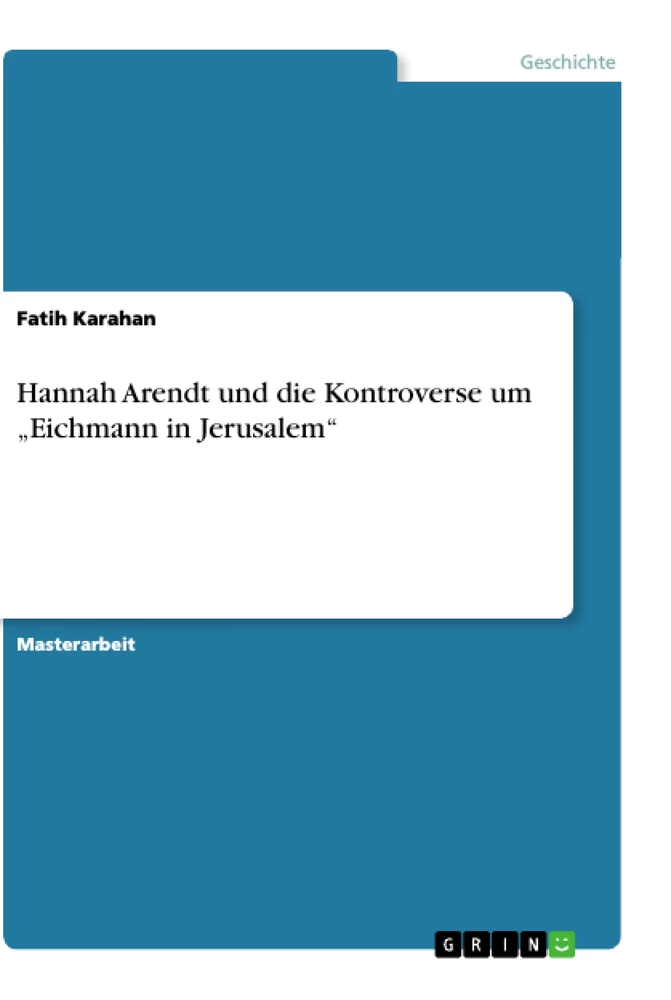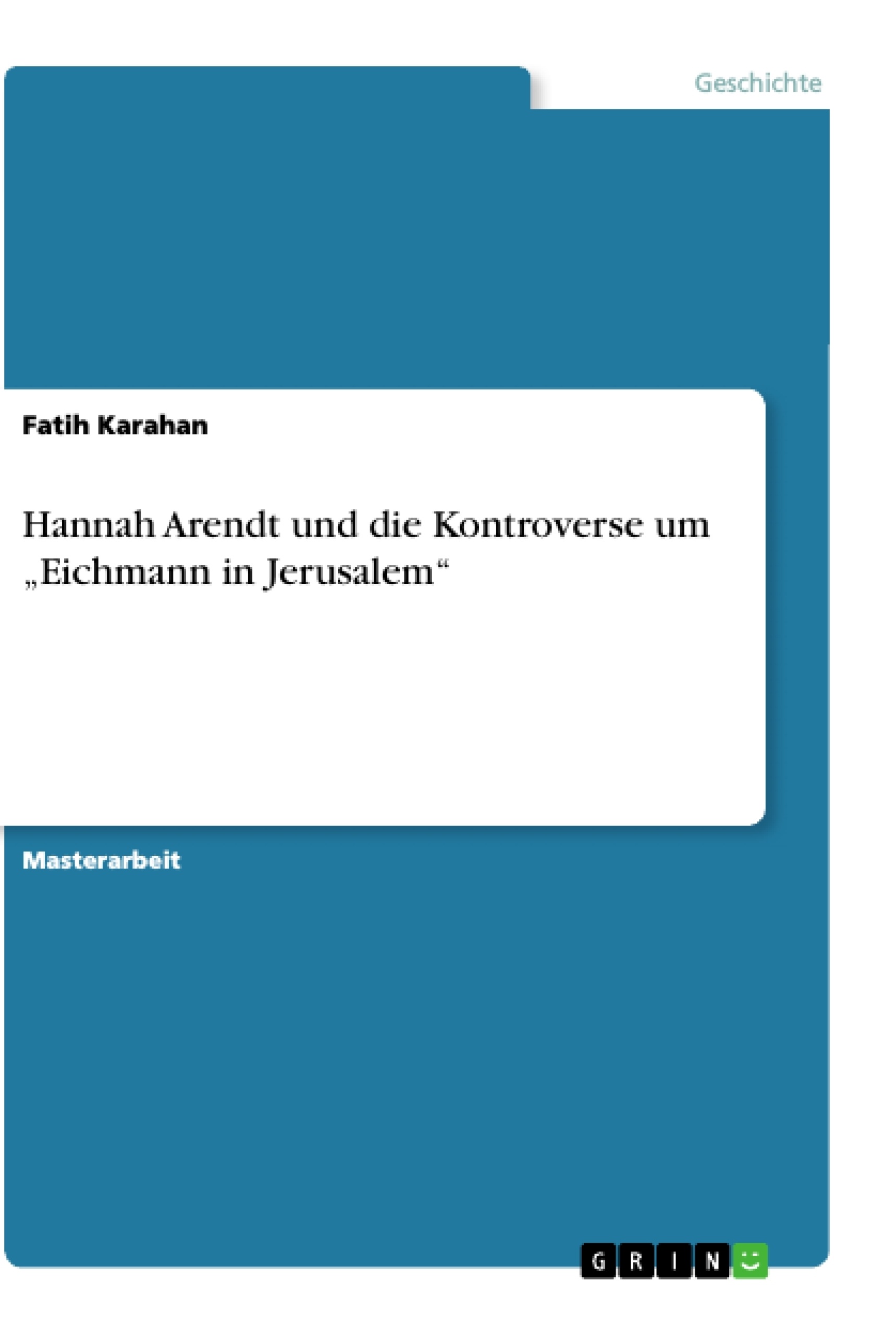In dieser Arbeit geht es um diese Kontroverse, die die Thesen der Journalistin Hannah Arendt aus ihrem Buch "Eichmann in Jerusalem" , nach dem Prozess des nazistischen Kriegsverbrechers Adolf Eichmann, vor Allem in Amerika, auslösten.
Die zu klärende Frage ist, aus welchen Gründen Arendts Thesen so stark in der Kritik standen. Dazu wird die Kontroverse in vier Themenbereiche eingeteilt, die sich allerdings leicht überschneiden können, da sowohl Arendts Thesen als auch die Kritik mehr als einem Themenfeld zugeordnet werden können. Um die Fragestellung zu beantworten und die geäußerte Kritik zu verstehen, werden neben der Kritik auch Arendts Thesen vorgestellt. Zuerst werden die Thesen zum Subjekt des Buchs Adolf Otto Eichmann beleuchtet. Dabei werden zunächst Arendts Thesen und Aussagen und im Anschluss die Kritik, sowohl positive als auch negative, vorgestellt. Im nächsten Kapitel werden Arendts Aussagen zur Haltung der Juden betrachtet sowie die Kritik in diesem Themenfeld. Das darauffolgende Thema gilt den Aussagen, Bemerkungen und Kritik zum Prozess in Jerusalem und den weiteren Rahmenbedingungen. Als letztes wird die Kritik zu Arendts Schreibstil und Methodik untersucht. Die Kritik wird in allen Themenbereichen in zeitgenössische Kritik sowie in jüngere Kritik eingeteilt, da der Fokus eher auf ersterem liegt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Eichmann und seine Rolle in der NS-Maschinerie "Judenvernichtung"
- Arendts Auffassung des banalen Eichmann
- Eichmanns banales Täterbild in der Kritik
- Rolle der Judenräte und der Widerstand im NS-Regime
- Arendts Thesen zur Rolle der Juden im NS-System
- Kritik an Arendts Auffassung bzgl. der Rolle der Juden in der Endlösung
- Kritik am israelischen Gericht und dem Staat Israel
- Arendts Kritik an den Rahmenbedingungen des Prozesses
- Kritik an Arendts Anmerkungen zum Prozess
- Kritik an Arendts Ausdrucksweise und Methodik
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Kontroverse um Hannah Arendts Buch „Eichmann in Jerusalem. Ein Bericht von der Banalität des Bösen“. Sie untersucht die Gründe für die starke Kritik an Arendts Thesen, die in den Vereinigten Staaten, wo ihre Berichte zuerst veröffentlicht wurden, einen „Bürgerkrieg“ unter Literaten auslöste. Die Analyse gliedert sich in vier Themenbereiche, die sich überschneiden können, da Arendts Thesen und die Kritik an ihnen mehreren Themenfeldern zugeordnet werden können.
- Arendts Darstellung von Adolf Eichmann als „banaler Täter“
- Die Rolle der Juden im NS-System und Arendts Thesen dazu
- Kritik am Eichmann-Prozess und dessen Rahmenbedingungen
- Kritik an Arendts Schreibstil und Methodik
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet Arendts Thesen über Adolf Eichmann und die daraufhin geäußerte Kritik. Es wird gezeigt, wie sich Arendts Sicht von Eichmann von der des israelischen Staatsanwalts Gideon Hausner unterschied. Das zweite Kapitel analysiert Arendts Aussagen über die Haltung der Juden im NS-Regime und die Kritik an diesen Thesen. Das dritte Kapitel widmet sich Arendts Ausführungen zum Eichmann-Prozess in Jerusalem und den Rahmenbedingungen des Prozesses. Das vierte Kapitel untersucht die Kritik an Arendts Schreibstil und Methodik.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit zentralen Themen wie der Banalität des Bösen, dem Eichmann-Prozess, der Rolle der Juden im NS-Regime, dem Widerstand und der Kritik an Arendts Thesen. Weitere wichtige Begriffe sind Totalitarismus, Nationalsozialismus, „Endlösung der Judenfrage“ und die Rolle des Staates Israel.
- Citation du texte
- Fatih Karahan (Auteur), 2018, Hannah Arendt und die Kontroverse um „Eichmann in Jerusalem“, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/914844