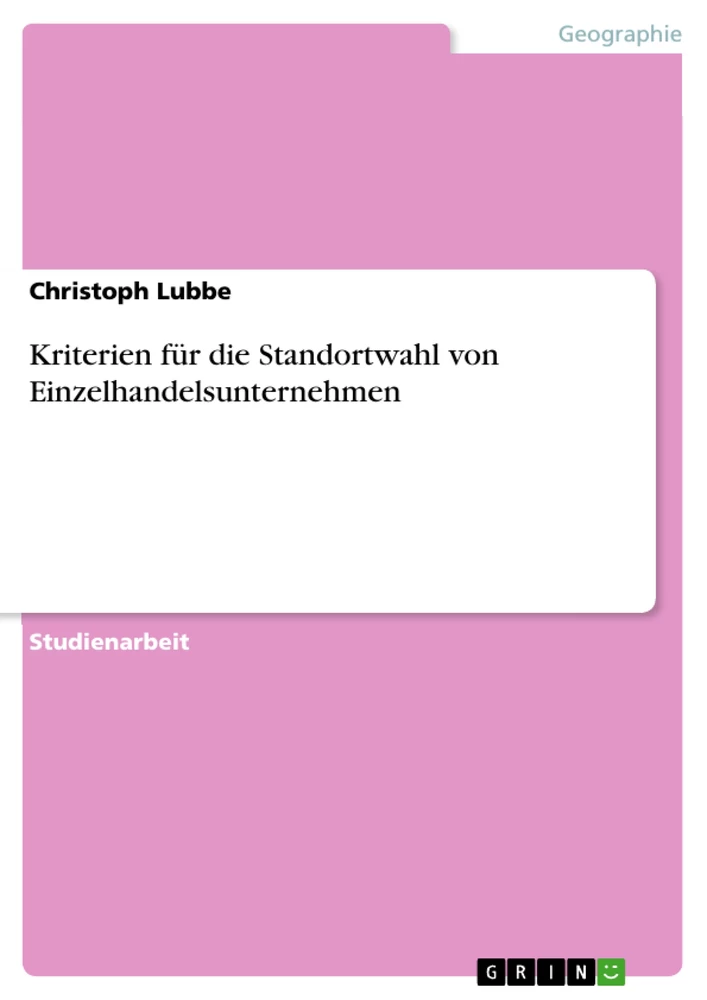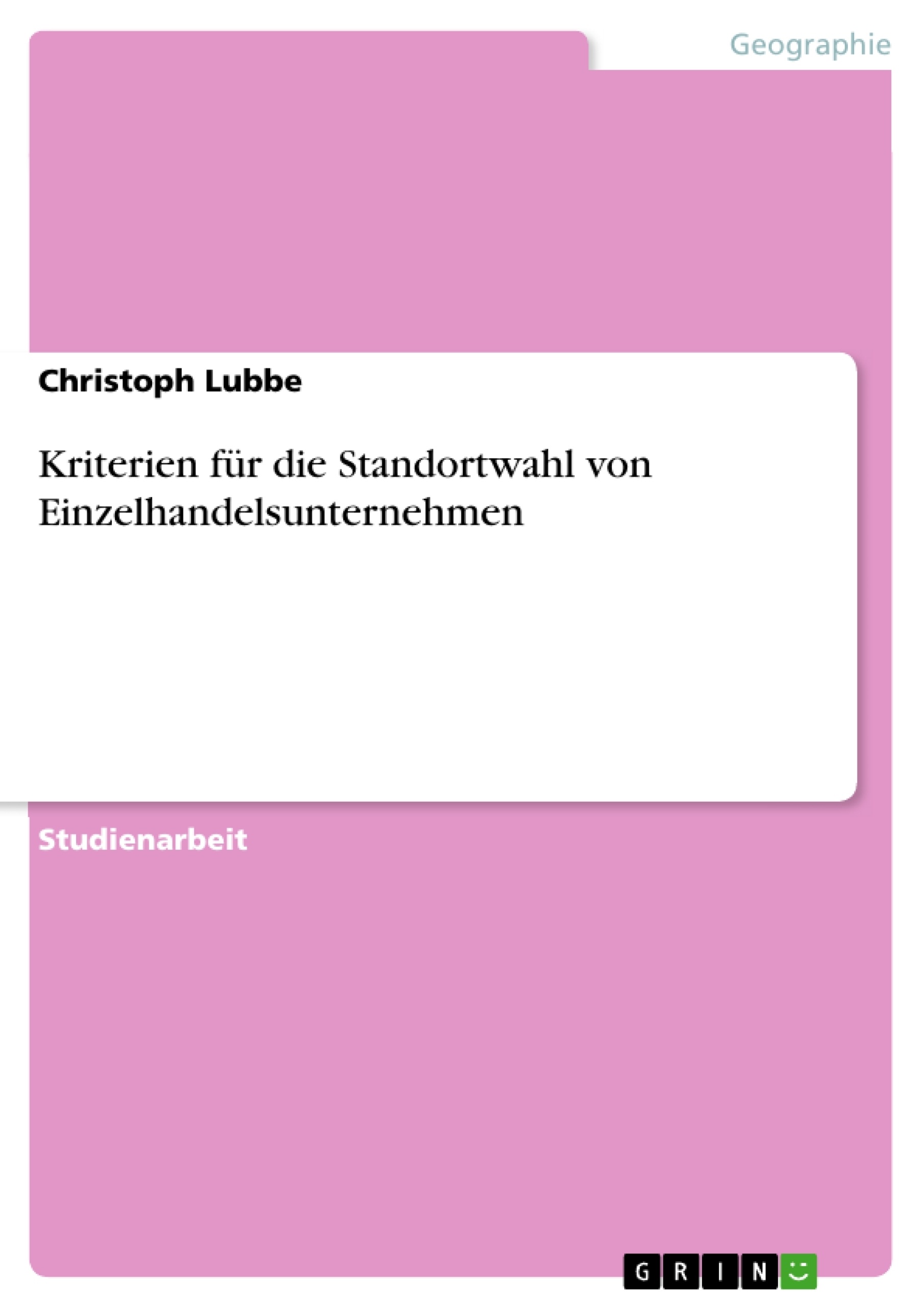Das Arbeit soll die verschiedenartigsten Motive und Gründe bei der Wahl des Geschäftsstandortes von Einzelhandelsunternehmen reflektieren. Hierbei soll es weniger darum gehen eine einheitliche Patentlösung für die Positionierung der Einzelhandelsstandorte innerhalb von Wirtschaftsräumen zu finden, als eher die äußerst divergenten Einflussfaktoren, die bei der Standortbestimmung wirken, aufzuzeigen und sie in ihren unterschiedlichsten Gewichtungen zu bewerten. Um eine den Bedürfnissen des Einzelhändlers angepasste Standortwahl durchzuführen, müssen daher die Unternehmensziele klar definiert werden.
Die Notwendigkeit einer Standortanalyse ergibt sich aus dem Umstand, dass es bei der Besetzung eines neuen Standortes, als auch bei der Bewertung eines bereits bestehenden Standortes Einflüsse gibt, die von elementarer Wichtigkeit für ein erfolgreiches wirtschaften an einer bestimmten Verkaufsstätte sind. So unterliegen Standorte ständiger Änderungen durch äußere Faktoren, die sich auf den ersten Blick nicht erkennen lassen, sondern erst mit der Heranziehung Standortgebundener Informationen voraussagbar werden. Um auch längerfristig konkurrenzfähig zu bleiben, kann sich ein Einzelhändler zu Fragen der Standortanalyse auf Dauer nicht länger entziehen.
Bei der Erarbeitung der möglichen Standortfaktoren bedarf es einer deutlichen Abgrenzung der Wirtschaften des Einzelhandels und der Industrie. Im Einzelhandel wirken nahbedarfsorientierte Betriebe, die weniger darauf abzielen einen nationalen oder internationalen Markt zu bedienen. Sie konzentrieren sich im Gegensatz zur Industrie eher auf lokale und regionale Märkte. (Vgl. Ludwig Schätzl, 2001: Wirtschaftsgeographie 1, Theorie, 8. Aufl., UTB, Schöningh,). Es werden zum Beispiel dem Industriestandort meist völlig andere Standortbedingungen als dem Einzelhandelsstandort unterstellt. So spielen beispielsweise Faktoren der Verfügbarkeit und Beschaffungsnähe von Rohstoffen, Umweltauflagen, Know-how-Potential oder politische Stabilität im Standortgebiet der Industrie eine große Rolle, sind aber für den Einzelhandel von relativ untergeordnetem Stellenwert. Für den Einzelhandel sind eher die Verkaufs- und Verwaltungsflächen von Interesse, Produktionsflächen hingegen werden hauptsächlich von der Industrie nachgefragt. [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Bevölkerungsdemographische Aspekte
- 2.1. Die Raumverteilung der Bevölkerung
- 2.2. Die Altersstruktur und die Geschlechterverteilung
- 2.3. Die Beschäftigtenstruktur
- 2.4. Die Anzahl der Haushalte
- 2.5. Angaben zur Bevölkerungsentwicklung
- 3. Die Kaufkraft
- 3.1. Die Einkommensstruktur
- 3.2. Die Sparquote
- 4. Die Siedlungsstruktur
- 5. Die Verkehrsinfrastruktur
- 5.1. Die Erreichbarkeit der Standorte
- 5.2. Das Parkplatzproblem
- 5.3. Verkehrsberuhigung und Fussgängerzonen - Vor- und Nachteile
- 6. Die Konkurrenzsituation
- 6.1. Analyse der derzeitigen Konkurrenzstrukturen
- 6.2. Zukünftige Entwicklungen der Konkurrenz und der Standortsituation
- 7. Abschliessend zusammenfassende Bewertung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit den Kriterien für die Standortwahl von Einzelhandelsunternehmen. Ziel ist es, die verschiedenen Motive und Gründe für die Standortwahl zu untersuchen und deren unterschiedliche Gewichtung bei der Standortbestimmung zu analysieren. Die Arbeit beleuchtet die Bedeutung der Standortanalyse für die langfristige Konkurrenzfähigkeit von Einzelhandelsbetrieben und zeigt die Unterschiede in den Standortfaktoren zwischen Einzelhandel und Industrie auf.
- Bevölkerungsdemographische Aspekte
- Kaufkraft und Einkommensstruktur
- Siedlungsstruktur und Verkehrsinfrastruktur
- Konkurrenzsituation und zukünftige Entwicklungen
- Abgrenzung von Einzelhandels- und Industriestandorten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Standortwahl von Einzelhandelsunternehmen ein und stellt die Relevanz der Standortanalyse für die Wirtschaftlichkeit von Verkaufsstätten heraus. Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit den bevölkerungsdemographischen Aspekten, die für die Standortwahl relevant sind. Dabei werden die Raumverteilung der Bevölkerung, die Altersstruktur und die Geschlechterverteilung, die Beschäftigtenstruktur, die Anzahl der Haushalte und die Bevölkerungsentwicklung beleuchtet. Das dritte Kapitel befasst sich mit der Kaufkraft und der Einkommensstruktur, die ebenfalls wichtige Faktoren für die Standortwahl darstellen. Das vierte Kapitel behandelt die Siedlungsstruktur als weiteren Aspekt, der bei der Standortwahl zu berücksichtigen ist. Das fünfte Kapitel analysiert die Verkehrsinfrastruktur und ihre Bedeutung für die Erreichbarkeit und die Parkmöglichkeiten von Einzelhandelsstandorten. Das sechste Kapitel untersucht die Konkurrenzsituation und die Bedeutung der Analyse derzeitiger und zukünftiger Konkurrenzstrukturen für die Standortwahl.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Standortwahl, Einzelhandel, Bevölkerungsdemographie, Kaufkraft, Siedlungsstruktur, Verkehrsinfrastruktur, Konkurrenzsituation, Standortanalyse, Wirtschaftlichkeit, Verkaufsstätten.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist die Standortanalyse für Einzelhändler so wichtig?
Standorte unterliegen ständigen Änderungen durch äußere Faktoren. Eine Analyse ist notwendig, um langfristig konkurrenzfähig und wirtschaftlich erfolgreich zu bleiben.
Wie unterscheiden sich Einzelhandels- und Industriestandorte?
Der Einzelhandel orientiert sich an lokalen Märkten und Verkaufsflächen, während die Industrie auf Rohstoffnähe, Umweltauflagen und Produktionsflächen fokussiert ist.
Welche demographischen Aspekte beeinflussen die Standortwahl?
Wichtige Faktoren sind die Raumverteilung der Bevölkerung, Altersstruktur, Geschlechterverteilung, Beschäftigtenstruktur und die Anzahl der Haushalte.
Welche Rolle spielt die Kaufkraft?
Die Einkommensstruktur und die Sparquote der Bevölkerung im Einzugsgebiet bestimmen maßgeblich das Umsatzpotenzial eines Standortes.
Welche verkehrstechnischen Faktoren sind entscheidend?
Die Erreichbarkeit des Standorts, die Verfügbarkeit von Parkplätzen sowie die Vor- und Nachteile von Fußgängerzonen sind kritische Kriterien.
- Quote paper
- Christoph Lubbe (Author), 2002, Kriterien für die Standortwahl von Einzelhandelsunternehmen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/9149