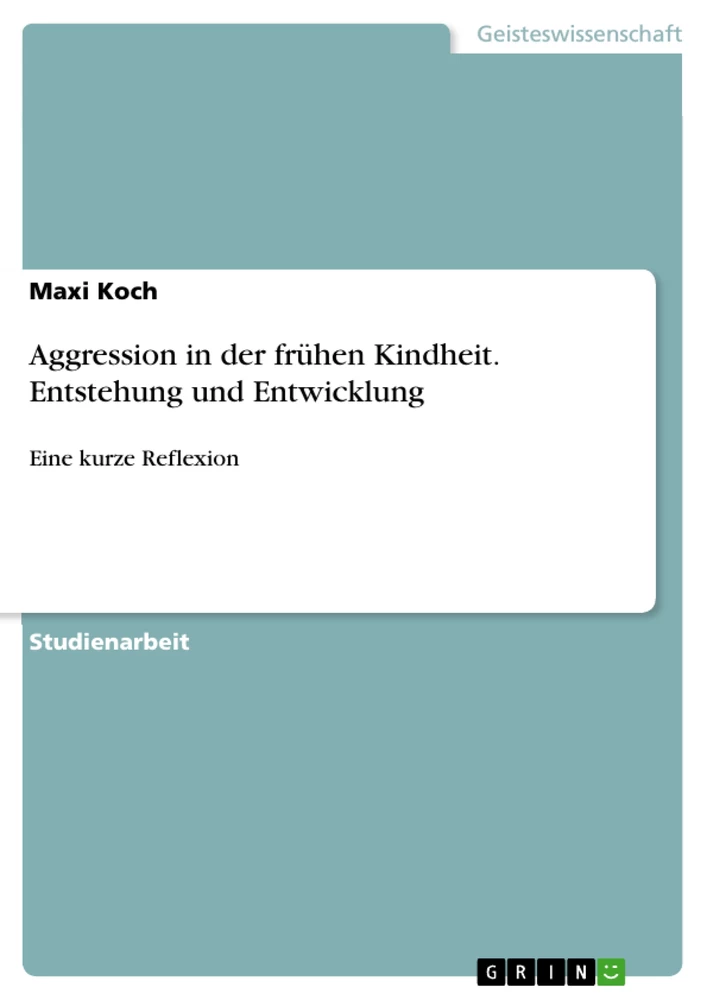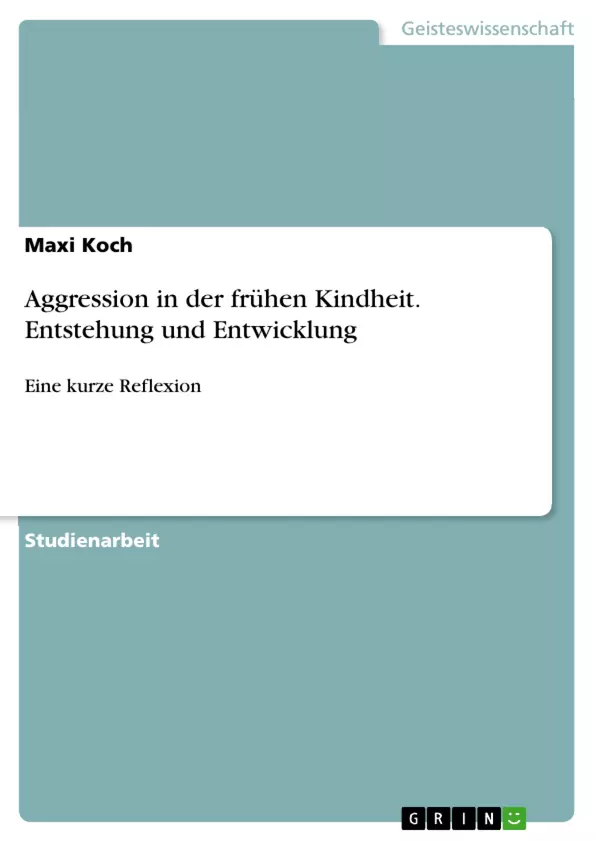Diese Arbeit setzt sich mit dem Kapitel "Die Entstehung und Entwicklung von Aggression" aus dem Buch "Die frühe Kindheit- Entwicklungspsychologie der ersten Lebensjahre" von Martin Dornes auseinander.
Das Kapitel wirft viele Fragen auf. Unter anderem, ob Aggression ein Trieb oder eine Affekthandlung ist, die reaktiv auf Unterdrückung der Selbstbehauptung auftritt.
Angefangen bei der Triebtheorie von Freud, folgt die Behandlung der konstruktiven und destruktiven Aggression und die Entwicklung des Ärgers. Daraufhin widmet sich die Arbeit dem objektgerichteten Ärger, den Ursprüngen in Objektbeziehungen und dem Problem der Aggressionslust. Am Ende beantwortet das Fazit die Frage zum Ursprung der Aggression.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Triebtheorie
- 2. Konstruktive und destruktive Aggression
- 3. Die Entwicklung des Ärgers
- 4. Objektgerichteter Ärger
- 5. Ärger und seine Ursprünge in Objektbeziehungen
- 6. Das Problem der Aggressionslust
- 7. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Text analysiert die Entstehung und Entwicklung von Aggression im Kindesalter. Er befasst sich mit der Frage, ob Aggression ein Trieb oder eine Affekthandlung ist, die auf Unterdrückung der Selbstbehauptung zurückzuführen ist.
- Die Triebtheorie Freuds und die Einordnung von Aggression in Lebens- und Todestrieb
- Die Unterscheidung zwischen konstruktiver und destruktiver Aggression und die Bedeutung des Umgangs mit aggressivem Verhalten
- Die Entwicklung des Ärgers im Kindesalter und dessen Zusammenhang mit Frustration und Selbstbehauptung
- Der Einfluss von Objektbeziehungen auf die Entstehung und Ausprägung von Aggression
- Die Rolle der Aggressionslust in der kindlichen Entwicklung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt den Kontext des Textes dar und erläutert die behandelte Thematik: die Entstehung und Entwicklung von Aggression im Kindesalter. Sie skizziert die zentralen Fragen, die im Text untersucht werden.
1. Triebtheorie
Dieses Kapitel befasst sich mit der Triebtheorie von Sigmund Freud und der Einordnung von Aggression. Zunächst wurde Aggression dem Sexualtrieb und später dem Selbsterhaltungstrieb zugeordnet. Später sah Freud Aggression als einen eigenständigen Trieb mit zerstörerischer Tendenz an. Das Kapitel beleuchtet die vier Merkmale von Trieben und diskutiert die Schwierigkeit, den Ursprung von Aggressionstrieben zu bestimmen.
2. Konstruktive und destruktive Aggression
Dieses Kapitel unterscheidet zwischen zwei Arten von Aggression: konstruktiver und destruktiver. Konstruktive Aggression dient der Exploration und Selbstbehauptung, während destruktive Aggression eine Reaktion auf Unlust und Frustration ist. Die Unterscheidung zwischen beiden Formen kann schwierig sein, da sie sich in ähnlichen Handlungen manifestieren. Das Kapitel betont die Bedeutung des Umgangs mit aggressivem Verhalten und dessen Auswirkungen auf die Entwicklung.
3. Die Entwicklung des Ärgers
Dieses Kapitel untersucht die Entwicklung des Ärgers im Kindesalter. Es beschreibt den Beginn des Ärgerausdrucks ab zwei Monaten und die Rolle von Hindernissen, die zur Frustration führen. Der Ärger wird als situationsbedingte Reaktion auf eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten verstanden. Das Kapitel beleuchtet die zunehmende Bedeutung von Wirkmächtigkeit und die Entwicklung von Frustration in passiven Handlungssituationen.
4. Objektgerichteter Ärger
Dieses Kapitel beschreibt die Entwicklung des objektgerichteten Ärgers ab dem neunten Monat. Die Kinder sind nun in der Lage, sich selbst fortzubewegen und ihre Autonomiebedürfnisse wachsen. Das Kapitel analysiert den Zusammenhang zwischen zunehmender Selbstbehauptung, Verbote und der Entstehung von Ärger in bestimmten Situationen. Die Kinder reagieren reaktiv ärgerlich und handeln instrumentell-aggressiv.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter des Textes sind: Aggression, Triebtheorie, konstruktive Aggression, destruktive Aggression, Ärger, Frustration, Selbstbehauptung, Objektbeziehung, Aggressionslust, Entwicklungspsychologie, frühe Kindheit.
Häufig gestellte Fragen
Ist Aggression bei Kindern ein angeborener Trieb?
Die Arbeit diskutiert dies anhand von Freuds Triebtheorie, stellt aber auch die Sichtweise dar, dass Aggression eine reaktive Affekthandlung auf Frustration sein kann.
Was ist der Unterschied zwischen konstruktiver und destruktiver Aggression?
Konstruktive Aggression dient der Selbstbehauptung und Exploration, während destruktive Aggression oft eine Reaktion auf Unlust oder starke Unterdrückung ist.
Wann beginnt die Entwicklung von Ärger bei Kleinkindern?
Erste Formen des Ärgerausdrucks lassen sich bereits ab einem Alter von etwa zwei Monaten beobachten, oft als Reaktion auf Hindernisse.
Welchen Einfluss haben Objektbeziehungen auf Aggression?
Die Qualität der Beziehung zu Bezugspersonen (Objekten) prägt maßgeblich, wie Kinder mit Frustration umgehen und ob sich aggressives Verhalten verfestigt.
Was versteht man unter "objektgerichtetem Ärger"?
Ab dem neunten Monat richten Kinder ihren Ärger gezielt gegen Personen oder Gegenstände, die ihren Autonomiebestrebungen oder Wünschen im Weg stehen.
- Arbeit zitieren
- Maxi Koch (Autor:in), 2019, Aggression in der frühen Kindheit. Entstehung und Entwicklung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/915034