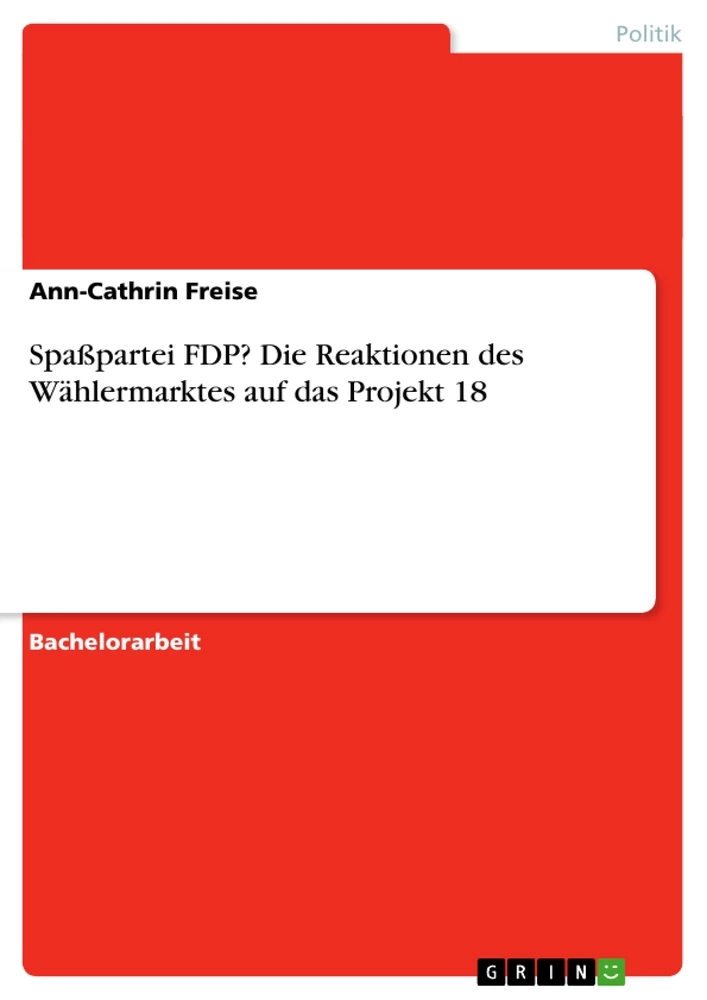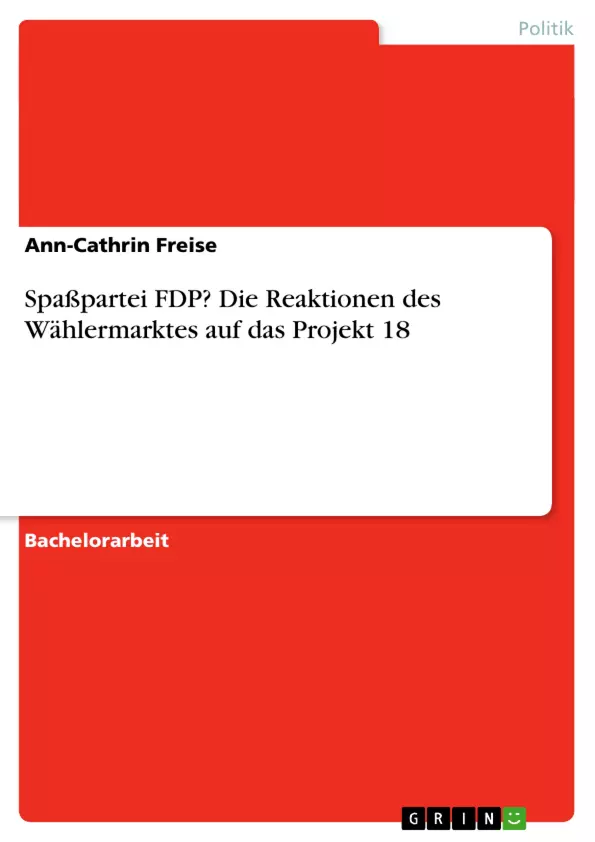Der Alltag der deutschen Gesellschaft des 21. Jahrhunderts ist geprägt durch
Individualisierung und Schnelllebigkeit; Elemente, welche einer umfassenden
Modernisierung zugeschrieben werden. Ein Prozess, der auch in der Politikvermittlung
für grundlegende Veränderungen gesorgt hat.
Die Zeitung ist nicht mehr das hauptsächliche Kommunikationsmittel. Dieser
Stellenwert wird nunmehr von den Massenmedien Fernsehen und Internet belegt,
welche sich den modernen Gegebenheiten und Lebensgewohnheiten der Menschen
angepasst haben. Vor allem das Fernsehen bietet dabei eine soziale Reichweite, an die
kein anderes Medium heranreicht. Schließlich verfügt nahezu jeder deutsche Haushalt
über ein Gerät - oftmals sind es sogar mehrere. Die Programmpräferenzen können ganz
nach den individuellen Vorlieben gestaltet werden und wenn ein Format nicht in
kürzester Zeit das Interesse des Rezipienten binden kann, wird zu einem anderen Sender umgeschaltet.
Gleiches gilt auch für die Vermittlung von politischen Inhalten. Die Parteien mussten
während der vergangenen Jahren lernen, die veränderten Gewohnheiten des
Wählermarktes zu studieren und für die eigene Präsentation zu nutzen. Als mit den so
genannten “Elefantenrunden”, bei denen führende Politiker vor der Bundestagswahl im
Fernsehen zusammenkamen und über unterschiedliche Positionen diskutierten, die
Mediatisierung der deutschen Politik eingeläutet wurde, war das heutige Ausmaß noch
nicht denkbar.
Die politische Kommunikation erfolgt heute vorrangig über die Massenmedien, da das
Volk ansonsten nicht erreicht werden kann. Aufgrund der angesprochenen
Schnelllebigkeit gilt es jedoch, sich in kürzester Zeit von den konkurrierenden Parteien
abzugrenzen und das gewünschte Image zu verkaufen. Vor allem aufgrund der latenten Politikverdrossenheit der Bevölkerung muss es eine Partei verstehen den Bürger direkt und emotional anzusprechen. Dies gelingt jedoch lediglich mit Hilfe eines
medienwirksamen Stellvertreters. Im Fall der FDP handelte es sich seinerzeit um den Bundesvorsitzenden Guido Westerwelle.
Inhaltsverzeichnis
- 1.0 Einleitung
- 2.0 Die etablierte FDP
- 2.1 Unterwegs zur Spaßpartei: Die Entwicklung des politischen Stellenwertes und des Images der FDP zwischen 1990 und 1998
- 2.2 Die verlorene Bundestagswahl 1998 – Entwicklungsmöglichkeiten in der Opposition
- 3.0 Die liberale Emanzipation
- 3.1 Die Kampagne 8 des Jürgen W. Möllemann
- 3.2 Ein unkonventioneller Landtagswahlkampf
- 4.0 Das Projekt 18 der FDP
- 4.1 Das Programm zur Bundestagswahl 2002
- 4.2 Die Definition der Zielgruppen
- 4.3 Exkurs: Der modernisierte Wahlkampf als Kernelement der Politikvermittlung
- 4.4 Der modernisierte Wahlkampf der FDP
- 4.5 Die Positionierung des Spitzenkandidaten und die Ernennung zur Spaẞpartei
- 4.6 Die ersten Erfolge: Ausgewählte Landtagswahlergebnisse der FDP während der Jahre 1999-2002
- 4.7 Der Höhepunkt des Projekts 18: Die Kanzlerkandidatur des Guido Westerwelle
- 5.0 Das vorzeitige Ende des Spaßwahlkampfes
- 5.1 Mangelnde Flexibilität im professionalisierten Wahlkampf: Die Elbflut und die Irakkrise
- 5.2 Das Ergebnis der Bundestagswahl 2002
- 6.0 Empirische Untersuchung: Wie wirkte sich das Projekt 18 langfristig aus?
- 6.1 Die Strukturdaten
- 6.2 Die Analyse ausgewählter Fragestellungen
- 6.3 Zusammenfassung der Auswertung: Die Bedeutung des Projekts 18 für die unmittelbare, weitere Entwicklung der FDP
- 7.0 Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Bachelorarbeit "Spaẞpartei FDP? – Die Reaktionen des Wählermarktes auf das Projekt 18" untersucht die strategische Ausrichtung der FDP im Bundestagswahlkampf 2002 und ihre Auswirkungen auf das politische Image der Partei. Die Arbeit analysiert die Entwicklung der FDP von einer etablierten Partei hin zu einer "Spaßpartei" und die damit verbundenen Chancen und Risiken.
- Die Entwicklung des politischen Stellenwertes und des Images der FDP zwischen 1990 und 1998
- Die Einführung und Umsetzung des "Projekts 18" im Bundestagswahlkampf 2002
- Die strategische Positionierung der FDP als "Spaßpartei" und ihre Auswirkungen auf das Wählerverhalten
- Die Erfolgsfaktoren und Herausforderungen des "Projekts 18"
- Die langfristige Wirkung des "Projekts 18" auf das Image der FDP
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 2 beleuchtet die Entwicklung der FDP von einer etablierten Partei zu einer Partei, die im Bundestagswahlkampf 1998 schwere Verluste erlitt. Kapitel 3 setzt sich mit der liberalen Emanzipation und der Kampagne des damaligen Bundesvorsitzenden Jürgen W. Möllemann auseinander. Kapitel 4 untersucht das "Projekt 18" der FDP, das die Bundestagswahl 2002 prägte. Es beleuchtet das Programm, die Zielgruppendefinition und die modernisierte Wahlkampfstrategie. Kapitel 5 analysiert das vorzeitige Ende des Spaßwahlkampfes, welches durch Ereignisse wie die Elbflut und die Irakkrise beeinflusst wurde. Kapitel 6 präsentiert eine empirische Untersuchung, die die langfristigen Auswirkungen des "Projekts 18" auf die Wahrnehmung der FDP beleuchtet. Das Resümee in Kapitel 7 fasst die zentralen Ergebnisse der Arbeit zusammen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Themenfelder Wahlkampfstrategie, Parteienimage, Wählerverhalten, Politikvermittlung, Mediatisierung und die Analyse des "Projekts 18" der FDP im Bundestagswahlkampf 2002. Wichtige Schlüsselbegriffe sind "Spaßpartei", "Personalisierung", "modernisierter Wahlkampf", "Zielgruppendefinition", "medienwirksame Politik" und "Wählermarkt".
Häufig gestellte Fragen
Was war das "Projekt 18" der FDP?
Das Projekt 18 war die Strategie der FDP für die Bundestagswahl 2002 mit dem Ziel, einen Wähleranteil von 18 % zu erreichen und sich als eigenständige Kraft neben Union und SPD zu positionieren.
Warum wurde die FDP als "Spaßpartei" bezeichnet?
Der Begriff entstand aufgrund des unkonventionellen, stark mediatisierten Wahlkampfs von Guido Westerwelle, der unter anderem mit dem "Guidomobil" tourte und in Unterhaltungsformaten auftrat.
Welche Rolle spielte Guido Westerwelle im Wahlkampf 2002?
Westerwelle trat als erster Kanzlerkandidat der FDP-Geschichte auf und personalisierte den Wahlkampf stark, um mediale Aufmerksamkeit zu generieren und neue Zielgruppen zu erschließen.
Welche Ereignisse führten zum Scheitern des Projekt 18?
Externe Krisen wie die Elbflut 2002 und die Debatte um den Irakkrieg veränderten die politische Agenda; der Fokus auf "Spaß" wirkte in dieser ernsten Lage auf viele Wähler deplatziert.
Was war die "Kampagne 8" von Jürgen Möllemann?
Es war eine vorangegangene Strategie in Nordrhein-Westfalen, die auf eine deutliche Steigerung der Stimmenanteile abzielte und den Weg für die bundesweite Emanzipation der FDP ebnete.
Wie wirkte sich das Projekt 18 langfristig aus?
Obwohl das 18 %-Ziel verfehlt wurde, modernisierte die Kampagne die politische Kommunikation der FDP nachhaltig, hinterließ aber auch ein polarisiertes Image der Partei.
- Arbeit zitieren
- B.A. in Social Science Ann-Cathrin Freise (Autor:in), 2007, Spaßpartei FDP? Die Reaktionen des Wählermarktes auf das Projekt 18, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/91506