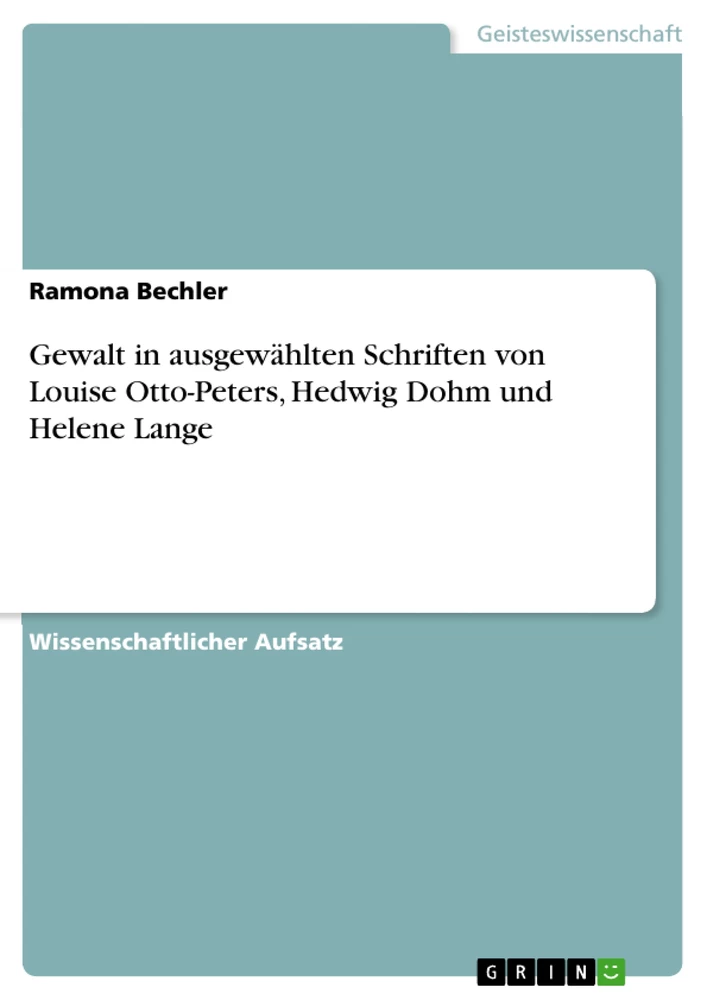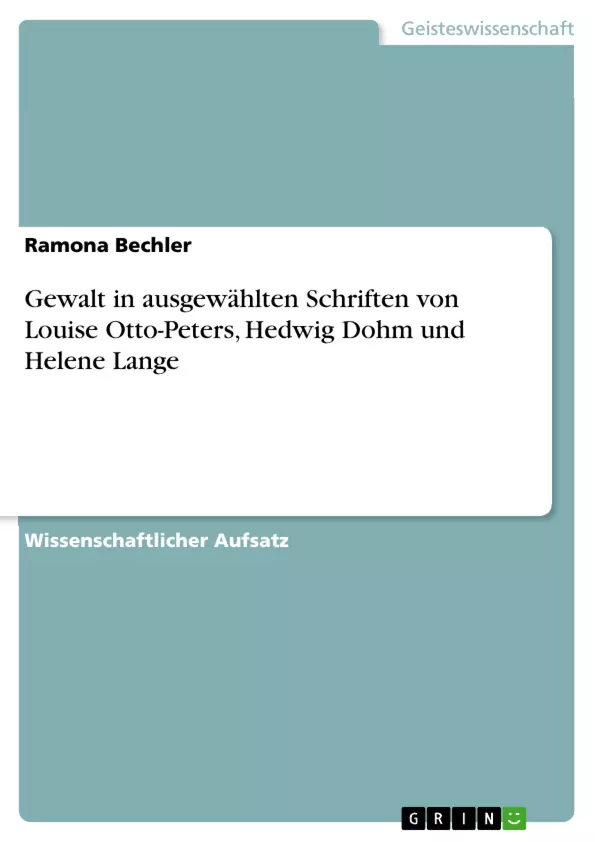Die Schriften von Vertreterinnen der bürgerlichen Frauenbewegung des 19. Jahrhunderts in Deutschland zeugen vielfach von einer intensiven Auseinandersetzung mit dem zeitgenössi-schen Geschlechteridealen. Sie gehen über die bloße Kritik der meist von Männern normierten Rollenzuordnungen und über die Beschreibung der realen Zustände hinaus. Eigene Entwürfe der Geschlechterverhältnisse werden formuliert und Emanzipationsforderungen daraus abgeleitet.
Haben sich die Akteurinnen der Ersten Frauenbewegung auch dem Thema Gewalt gewidmet? Um dieser Frage nachzugehen, gilt es in den Schriften von Louise Otto, Helene Lange und Hedwig Dohm nach Ausprägungen physischer und psychischer Gewalt Ausschau zu halten. Dabei darf nicht nur der Begriff Gewalt Kriterium sein, sondern auch damit assoziierte Ausprägungen, etwa Zwang, Folter, Knechtschaft, Beschränkung usw. Gleiches gilt auch für möglicherweise vorhandene Metaphern und sonstige versteckte Hinweise auf Gewalt. Nachfolgend liegt Hauptaugenmerk darauf, in welchen Zusammenhängen von Gewalt gesprochen und wie Gewalt sprachlich dargestellt wird. Zudem ist von Belang, ob Maßnahmen gegen Gewalt angedacht werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Gewalt in Louise Ottos „Das Recht der Frauen auf Erwerb“
- Gewalt bei Hedwig Dohm – „Der Frauen Natur und Recht“
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Darstellung von Gewalt in ausgewählten Schriften von Louise Otto-Peters, Hedwig Dohm und Helene Lange. Ziel ist es, aufzuzeigen, wie diese Vertreterinnen der bürgerlichen Frauenbewegung des 19. Jahrhunderts das Thema Gewalt im Kontext der Geschlechterverhältnisse behandelten und welche Schlussfolgerungen sich daraus ziehen lassen.
- Darstellung von Gewalt in den Schriften der Autorinnen
- Zusammenhang zwischen Gewalt und den Geschlechterverhältnissen
- Konzepte von Unterdrückung und Selbstbestimmung
- Analyse der Erziehungspraktiken und ihrer Auswirkungen
- Kritik an gesellschaftlichen Normen und Idealen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Entstehungskontext der Arbeit und die Auswahl der Quellen. Die Autorin erläutert, warum das Thema Gewalt, bei der ersten Bearbeitung der Texte übersehen, nun im Mittelpunkt steht und wie sie den Begriff Gewalt definiert. Es wird deutlich gemacht, dass die Aufrechterhaltung von Herrschaft über Personen mit Gewalt verbunden ist und dass das System der Geschlechterverhältnisse als Herrschaftsverhältnis betrachtet wird, welches die Analyse von Gewalt notwendig macht. Der Fokus liegt auf der sprachlichen Darstellung von Gewalt, assoziierten Ausprägungen und angedachten Maßnahmen dagegen.
Gewalt in Louise Ottos „Das Recht der Frauen auf Erwerb“: Louise Otto kritisiert das damalige Ideal der Frau als Gattin und Mutter als ein System, das Frauen unterdrückt und sie zu Opfern macht. Sie beschreibt die Zwangsheirat als eine Form von Gewalt und vergleicht die Situation unglücklicher Ehefrauen drastisch mit Folter und Prostitution. Otto analysiert die "Komplizenschaft" der Mütter bei der Aufrechterhaltung des patriarchalischen Systems, welches die Töchter zur Unterwerfung zwingt. Sie prangert die unterschiedliche Behandlung von Jungen und Mädchen an, wobei die strenge Erziehung der Mädchen als ein Mittel zur Unterdrückung und die Nachsicht mit Jungen als Grundlage für das Fortbestehen der Geschlechterhierarchie interpretiert wird. Sie erwähnt die gewaltsame Auflösung der Frauenvereine nach 1848/49 und spricht sich für medizinische Untersuchungen von Frauen durch Ärztinnen aus, um sexuellen Missbrauch zu verhindern. Aus all dem leitet sie ihre Forderung nach Selbständigkeit und Mitregentschaft der Frau ab.
Gewalt bei Hedwig Dohm – „Der Frauen Natur und Recht“: Hedwig Dohm hinterfragt das Dogma von naturgegebenen Eigenschaften der Frau als Mittel der Unterdrückung. Sie sieht die soziale Stellung der Frau als ein Leben lang währende Abhängigkeit, die zu Heuchelei und Verstellung führt. Die Autorin konstatiert, dass auch ohne Heuchelei die Frau in einer patriarchalen Gesellschaft die Misshandlung durch den Mann nicht entgehen kann. Dohm zeigt, wie die Erziehung die Geschlechterverhältnisse grundlegt, und kritisiert die unterschiedliche Behandlung von Jungen und Mädchen: Jungen werden zu rohen Männern erzogen, Mädchen hingegen zur Unterwerfung dressiert. Die Ehe wird als Herrschaftsform des Mannes über die Frau dargestellt, wobei die Braut als Ware und die kluge Frau als Schreckensbild des Mannes gesehen wird. Die Notwendigkeit des Gehorsams der Frau wird ironisch als Folge der Angst des Mannes vor einem „zweiten Gewissen“ dargestellt.
Schlüsselwörter
Gewalt, Geschlechterverhältnisse, bürgerliche Frauenbewegung, 19. Jahrhundert, Louise Otto-Peters, Hedwig Dohm, Helene Lange, Unterdrückung, Selbstbestimmung, Ehe, Erziehung, Patriarchat.
Häufig gestellte Fragen zu: Gewalt in der bürgerlichen Frauenbewegung des 19. Jahrhunderts
Was ist das Thema der Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Darstellung von Gewalt in ausgewählten Schriften von Louise Otto-Peters, Hedwig Dohm und Helene Lange im Kontext der bürgerlichen Frauenbewegung des 19. Jahrhunderts. Der Fokus liegt dabei auf der sprachlichen Darstellung von Gewalt, assoziierten Ausprägungen und angedachten Maßnahmen dagegen. Die Aufrechterhaltung von Herrschaft über Personen wird mit Gewalt in Verbindung gebracht, wobei das System der Geschlechterverhältnisse als Herrschaftsverhältnis betrachtet wird.
Welche Autorinnen werden untersucht?
Die Arbeit analysiert die Schriften von Louise Otto-Peters, Hedwig Dohm und Helene Lange. Der Schwerpunkt liegt auf Louise Otto-Peters' „Das Recht der Frauen auf Erwerb“ und Hedwig Dohms „Der Frauen Natur und Recht“.
Wie wird Gewalt in der Arbeit definiert?
Die Arbeit definiert Gewalt im Zusammenhang mit der Aufrechterhaltung von Herrschaft und betrachtet das System der Geschlechterverhältnisse als ein Herrschaftsverhältnis, welches die Analyse von Gewalt notwendig macht. Es geht um die sprachliche Darstellung von Gewalt und die damit verbundenen Implikationen.
Welche Aspekte der Gewalt werden untersucht?
Die Arbeit untersucht verschiedene Aspekte von Gewalt, darunter Zwangsheirat, Unterdrückung durch die Erziehung (unterschiedliche Behandlung von Jungen und Mädchen), die Situation unglücklicher Ehefrauen, sexuellen Missbrauch und die gewaltsame Auflösung von Frauenvereinen. Es wird der Zusammenhang zwischen Gewalt und den Geschlechterverhältnissen, Konzepte von Unterdrückung und Selbstbestimmung sowie die Kritik an gesellschaftlichen Normen und Idealen analysiert.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Arbeit zeigt auf, wie die untersuchten Autorinnen das Thema Gewalt im Kontext der Geschlechterverhältnisse behandelten und welche Schlussfolgerungen sich daraus für die damalige Zeit ziehen lassen. Die Autorinnen kritisieren das patriarchale System und fordern Selbständigkeit und Mitregentschaft der Frau.
Wie wird die Ehe dargestellt?
Die Ehe wird in den untersuchten Schriften als Herrschaftsform des Mannes über die Frau dargestellt. Zwangsheirat wird als Form von Gewalt kritisiert, und die Situation unglücklicher Ehefrauen wird mit Folter und Prostitution verglichen. Die Braut wird als Ware betrachtet, und die kluge Frau wird als Schreckensbild des Mannes gesehen.
Welche Rolle spielt die Erziehung?
Die unterschiedliche Erziehung von Jungen und Mädchen wird als ein zentrales Element der Aufrechterhaltung der Geschlechterverhältnisse betrachtet. Jungen werden zu rohen Männern erzogen, Mädchen hingegen zur Unterwerfung dressiert. Die strenge Erziehung der Mädchen wird als Mittel der Unterdrückung interpretiert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Gewalt, Geschlechterverhältnisse, bürgerliche Frauenbewegung, 19. Jahrhundert, Louise Otto-Peters, Hedwig Dohm, Helene Lange, Unterdrückung, Selbstbestimmung, Ehe, Erziehung, Patriarchat.
- Quote paper
- Ramona Bechler (Author), 2007, Gewalt in ausgewählten Schriften von Louise Otto-Peters, Hedwig Dohm und Helene Lange, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/91516