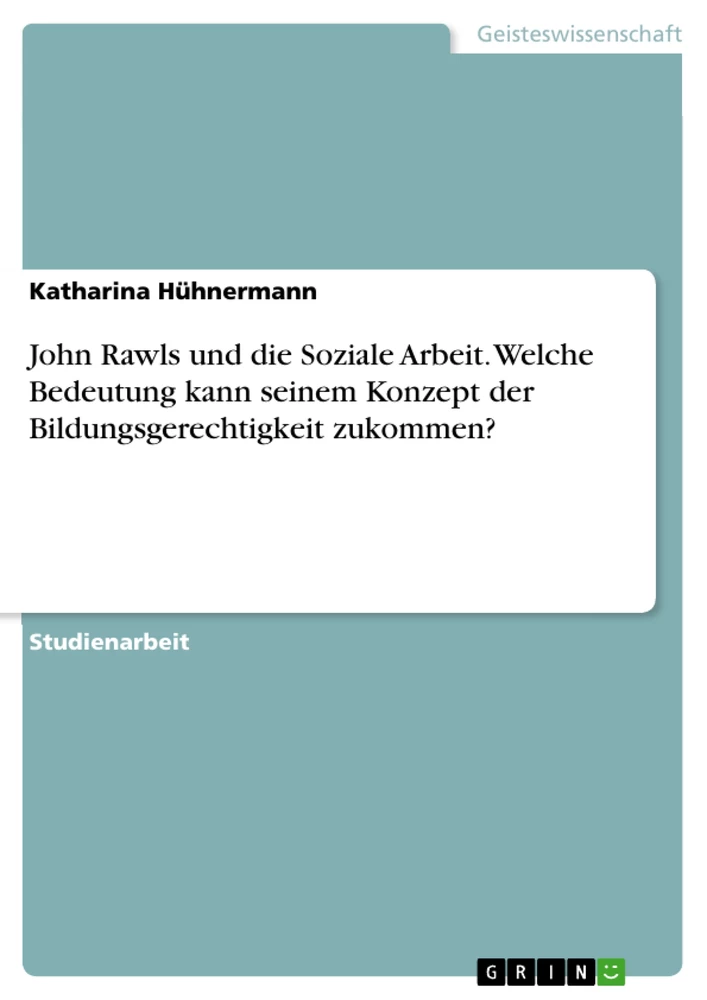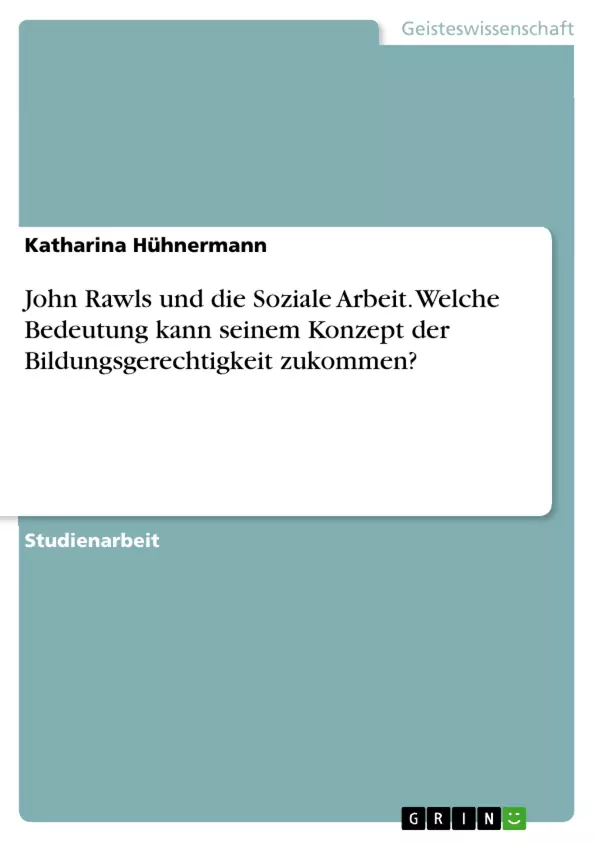Die folgende Hausarbeit thematisiert die Bildungsgerechtigkeit in Deutschland nach John Rawls "Theorie der Gerechtigkeit als Fairness" und seiner Bedeutung für die Soziale Arbeit. Mit dieser Arbeit soll das Verständnis von Rawls von Bildungsgerechtigkeit herausgearbeitet werden. Zudem soll die daraus folgende Lage für Benachteiligte sowie Begabte aufgezeigt werden und zudem die Bedeutung von Rawls Sichtwiese für die Soziale Arbeit geklärt werden.
Die zentrale Fragestellung des Textes lautet wie folgt: Wie sieht Bildungsgerechtigkeit nach John Rawls aus und was bedeutet dies für die Soziale Arbeit? Schwerpunktmäßig behandelt diese Arbeit Rawls Theorie der Gerechtigkeit bezogen auf die Gebiete der Bildung, Benachteiligung und der sozialen Arbeit.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Bildungsverständnis nach John Rawls
- Kennzeichnung von Bildung
- Gerechtigkeit als Fairness
- Bildungsgerechtigkeit
- Bedeutung für Randgruppen
- Bedeutung für Benachteiligte
- Förderung von Begabten
- Ableitung für die Soziale Arbeit
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit dem Konzept der Bildungsgerechtigkeit im Kontext der Theorie der Gerechtigkeit als Fairness von John Rawls. Sie analysiert Rawls’ Verständnis von Bildungsgerechtigkeit und untersucht die Auswirkungen auf Benachteiligte und Begabte. Darüber hinaus wird die Bedeutung von Rawls’ Sichtweise für die Soziale Arbeit erörtert.
- Rawls’ Theorie der Gerechtigkeit als Fairness und ihre Implikationen für Bildung
- Die Bedeutung von Bildungsgerechtigkeit für die Förderung von Chancengleichheit
- Die Herausforderungen der Bildungsgerechtigkeit im Hinblick auf Benachteiligte und Begabte
- Die Rolle der Sozialen Arbeit in der Umsetzung von Bildungsgerechtigkeit
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Bildungsgerechtigkeit nach John Rawls ein und erläutert die Relevanz des Themas im deutschen Kontext. Die Fragestellung der Arbeit und die methodische Vorgehensweise werden dargestellt.
- Bildungsverständnis nach John Rawls: Dieses Kapitel befasst sich mit Rawls’ Definition von Bildung und seiner Theorie der Gerechtigkeit als Fairness. Es analysiert, wie Rawls Bildung im Kontext von Chancengleichheit und sozialer Gerechtigkeit begreift.
- Bedeutung für Randgruppen: Dieses Kapitel beleuchtet die Folgen von Rawls’ Bildungsgerechtigkeit für Benachteiligte und Begabte. Es untersucht die Chancen und Herausforderungen, die sich aus Rawls’ Theorie für diese Gruppen ergeben.
- Ableitung für die Soziale Arbeit: Dieses Kapitel untersucht, welche Implikationen sich aus Rawls’ Theorie der Gerechtigkeit für die Praxis der Sozialen Arbeit ableiten lassen. Es analysiert, wie die Soziale Arbeit zur Umsetzung von Bildungsgerechtigkeit beitragen kann.
Schlüsselwörter
Bildungsgerechtigkeit, John Rawls, Gerechtigkeit als Fairness, Chancengleichheit, Benachteiligung, Begabung, Soziale Arbeit, Bildungssystem, Lebensumfeld.
- Quote paper
- Katharina Hühnermann (Author), 2018, John Rawls und die Soziale Arbeit. Welche Bedeutung kann seinem Konzept der Bildungsgerechtigkeit zukommen?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/916320