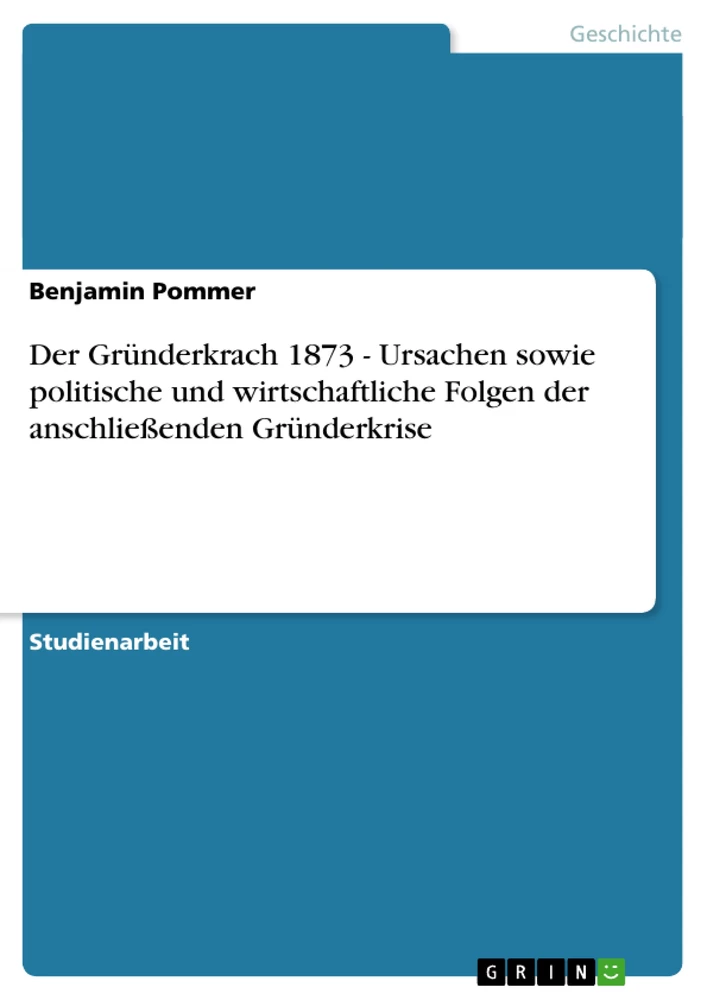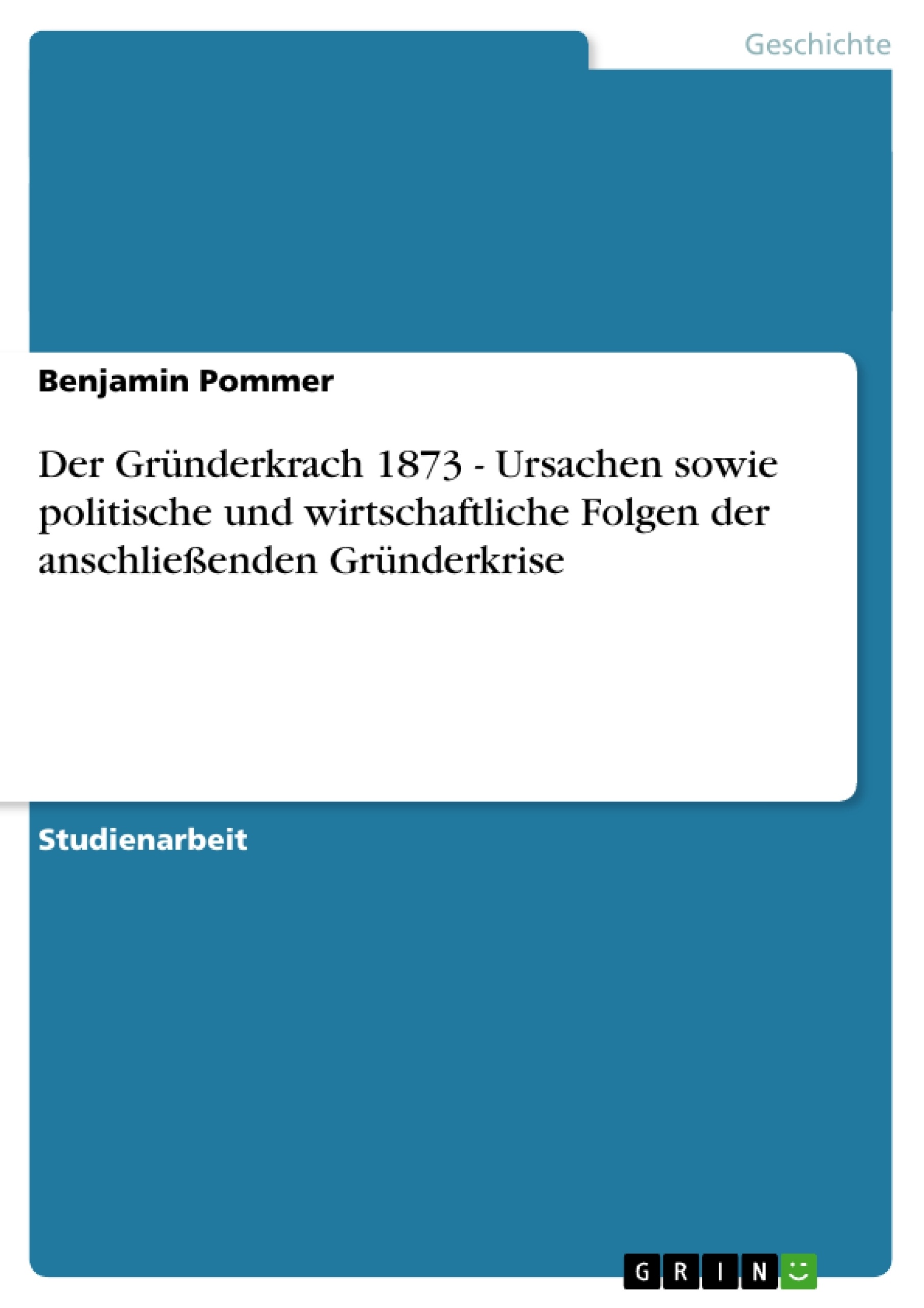Bei der Betrachtung der heutigen weltwirtschaftlichen Lage fällt jedem halbwegs finanzpolitisch Interessierten auf, dass dem Börsenmarkt als Richterskala von politischen Krisen eine hohe Bedeutung zukommt. Weiterhin zeigt gerade das Beispiel der Krise auf dem amerikanischen Börsenmarkt, inwieweit deutsche Banken oder Anleger involviert sind und von der Krise profitieren oder Schaden nehmen. Diese weltwirtschaftlichen Verflechtungen vor allem der Finanzmärkte zeigen besonders deutlich die Vor- und Nachteile von Globalisierung. Ohne weitere Vorahnungen verkünden zu wollen soll die Brücke zur zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts geschlagen werden, die zeitlich den Rahmen dieser Untersuchung einnimmt.
Gerade diese Zeit stellte den Beginn des Höhepunktes der Industrialisierung dar, die sich vor allem im immer mehr zusammen wachsenden Deutschland vollzog. Die Idee eines deutschen Nationalstaates wurde dabei zunächst im Rückblick auf die Revolution von 1848/49 von liberalen Kräften getragen, denen zusätzlich der Freihandel als Mittel der wirtschaftspolitischen Maxime für Europa und den Welthandel zuzuordnen war.
Wie heute in Wirtschaftswissenschaft bekannt ist, haben Volkswirtschaften mit einer mehr markwirtschaftlich orientierten Wirtschaftsordnung und einem niedrigen Staatseingriff eine größere wirtschaftliche Entfaltungsmöglichkeit, so wie es seit den 1850er Jahren in vielen deutschen Staaten und auch im Deutschen Reich ab 1870/71 erfolgte. Wo liegen aber nun die Ursachen für eine Abkehr von diesen Prinzipien? Allein das Argument einer Krise vermag nicht zu überzeugen, da jede wirtschaftliche Krise nicht automatisch einen Systemwechsel nach sich zieht. Im Folgenden wird das wirtschaftliche Wachstum während und nach der Reichsgründung 1871 bis hin zum Krach der Berliner Börse 1873 auf destabilisierende Faktoren hin analysiert. Weiter wird der Krach für sich und seine Ursachen betrachtet, wobei diese auf einen Zusammenhang zum Wachstum untersucht werden. Den Hauptteil macht die Betrachtung der auf den Börsenkrach folgenden Krise aus, deren Folgen dann im Zusammenhang mit den Maßnahmen des Staates betrachtet werden. Die Literaturlage stellt sich in diesem Bereich als ergiebig heraus, was die Nachvollziehbarkeit über vorliegende empirische Befunde und Statistiken belegt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung
- 2. Auswirkungen des Gründerbooms 1867-73
- 3. Die Gründerkrise 1873-79
- 3.1. Der Gründerkrach 1873
- 3.2. Verlauf der Krise
- 3.3. Folgen
- 4. Gegenmaßnahmen nach der „Konservativen Wende“ 1878
- 4.1. Veränderung der politischen Machtverhältnisse
- 4.2. Ordnungspolitische Maßnahmen
- 5. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Ursachen des Gründerkrachs von 1873 und die politischen sowie wirtschaftlichen Folgen der darauf folgenden Gründerkrise. Der Fokus liegt auf der Analyse des wirtschaftlichen Wachstums vor dem Krach, den destabilisierenden Faktoren, die zum Krach beitrugen, und den staatlichen Reaktionen auf die Krise.
- Wirtschaftswachstum und Gründerboom in Deutschland vor 1873
- Ursachen des Gründerkrachs von 1873
- Verlauf und Folgen der Gründerkrise
- Staatliche Gegenmaßnahmen und ordnungspolitische Veränderungen
- Zusammenhang zwischen Wirtschaftswachstum, Spekulation und Krisenmanagement
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einführung: Die Einleitung stellt einen Bezug zur heutigen weltwirtschaftlichen Lage her und betont die Bedeutung von Börsenmärkten als Indikatoren für politische Krisen. Sie führt in die Zeit der Industrialisierung im späten 19. Jahrhundert in Deutschland ein, verbindet die Idee des Nationalstaates mit liberalen Kräften und Freihandelspolitik, und skizziert die Fragestellung der Arbeit: die Ursachen für eine Abkehr von liberalen Wirtschaftsprinzipien und die Analyse des wirtschaftlichen Wachstums vor und nach dem Gründerkrach von 1873. Die Arbeit verspricht, den Krach, seine Ursachen und seine Folgen im Kontext der staatlichen Maßnahmen zu betrachten.
2. Auswirkungen des Gründerbooms 1867-73: Dieses Kapitel beschreibt die Hochkonjunktur in Deutschland in der Zeit vor dem Gründerkrach, beeinflusst durch den Deutsch-Französischen Krieg. Es betont die Rolle der Schwerindustrie, insbesondere der Eisenbahnindustrie, beim Wirtschaftswachstum und den damit verbundenen Ausbau des Börsenverkehrs und des Kapitalmarktes. Die Gewerbeordnung von 1867 und die französischen Reparationszahlungen werden als wichtige Faktoren für den wirtschaftlichen Aufschwung und die Spekulationswelle genannt, die durch die Aufhebung von Beschränkungen im Kapitalverkehr und die Aktienrechtsnovelle von 1870 begünstigt wurde. Die Einführung der Goldwährung im Jahr 1871 wird ebenfalls als ein beitragender Faktor hervorgehoben.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Der Gründerkrach von 1873
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Ursachen des Gründerkrachs von 1873 und die politischen sowie wirtschaftlichen Folgen der darauffolgenden Gründerkrise in Deutschland. Der Fokus liegt auf dem wirtschaftlichen Wachstum vor dem Krach, den destabilisierenden Faktoren, die zum Krach beitrugen, und den staatlichen Reaktionen auf die Krise. Die Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen Wirtschaftswachstum, Spekulation und Krisenmanagement.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Wirtschaftswachstum und Gründerboom in Deutschland vor 1873, die Ursachen des Gründerkrachs von 1873, den Verlauf und die Folgen der Gründerkrise, staatliche Gegenmaßnahmen und ordnungspolitische Veränderungen nach der „Konservativen Wende“ 1878, sowie den Zusammenhang zwischen Wirtschaftswachstum, Spekulation und Krisenmanagement.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in ihnen?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel:
- Kapitel 1 (Einführung): Stellt einen Bezug zur heutigen weltwirtschaftlichen Lage her, führt in die Zeit der Industrialisierung im späten 19. Jahrhundert in Deutschland ein und skizziert die Fragestellung der Arbeit: die Ursachen für eine Abkehr von liberalen Wirtschaftsprinzipien und die Analyse des wirtschaftlichen Wachstums vor und nach dem Gründerkrach von 1873.
- Kapitel 2 (Auswirkungen des Gründerbooms 1867-73): Beschreibt die Hochkonjunktur vor dem Gründerkrach, die Rolle der Schwerindustrie, den Ausbau des Börsenverkehrs und des Kapitalmarktes, und die Bedeutung von Faktoren wie der Gewerbeordnung von 1867, französischen Reparationen und der Goldwährung von 1871.
- Kapitel 3 (Die Gründerkrise 1873-79): Untersucht den Gründerkrach von 1873, den Verlauf der Krise und deren Folgen.
- Kapitel 4 (Gegenmaßnahmen nach der „Konservativen Wende“ 1878): Analysiert die Veränderung der politischen Machtverhältnisse und die ordnungspolitischen Maßnahmen nach der Krise.
- Kapitel 5 (Zusammenfassung): Fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen.
Welche Rolle spielten der Deutsch-Französische Krieg und die Gewerbeordnung von 1867?
Der Deutsch-Französische Krieg und die französischen Reparationszahlungen trugen maßgeblich zum wirtschaftlichen Aufschwung und zur Spekulationswelle bei. Die Gewerbeordnung von 1867 schuf ein liberaleres wirtschaftliches Umfeld, das ebenfalls zum Boom beitrug.
Welche Faktoren führten zum Gründerkrach von 1873?
Die Arbeit untersucht die Ursachen des Gründerkrachs, die unter anderem in der vorangegangenen Spekulationswelle, überhöhten Erwartungen und der Überinvestition in der Industrie zu suchen sind. Die genauen Ursachen werden im Detail im entsprechenden Kapitel analysiert.
Wie reagierte der Staat auf die Gründerkrise?
Die staatlichen Reaktionen auf die Krise und die ordnungspolitischen Veränderungen nach der „Konservativen Wende“ 1878 werden in einem eigenen Kapitel detailliert untersucht. Hier wird die Abkehr von liberalen Wirtschaftsprinzipien analysiert.
- Quote paper
- Benjamin Pommer (Author), 2008, Der Gründerkrach 1873 - Ursachen sowie politische und wirtschaftliche Folgen der anschließenden Gründerkrise, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/91637