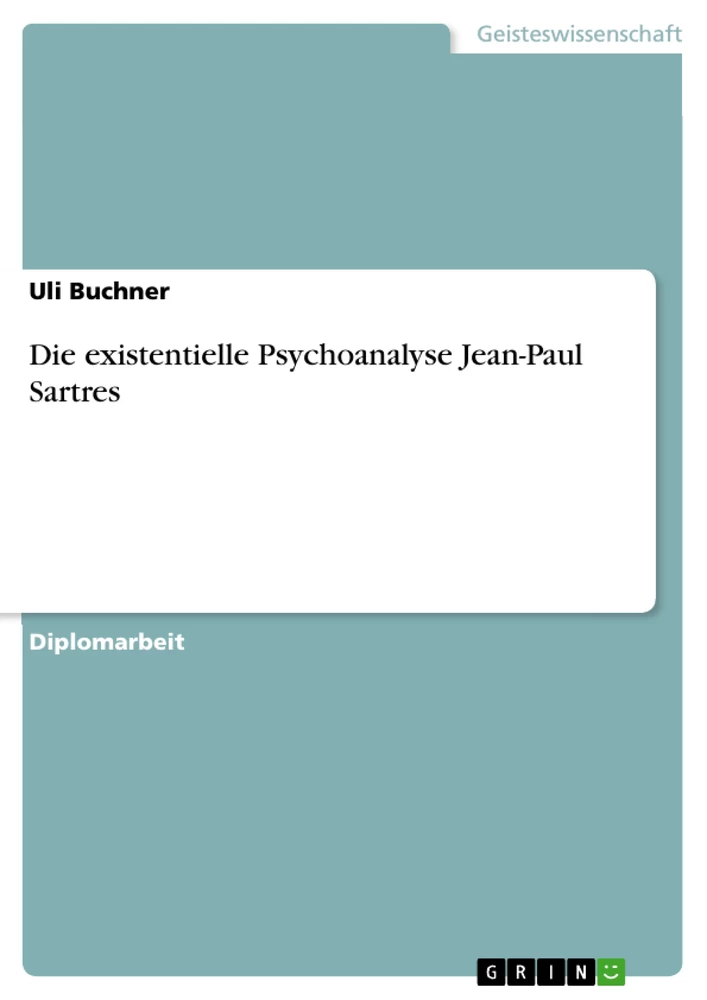Der Titel: Jean-Paul Sartre: Die existentielle Psychoanalyse als Thema einer Diplomarbeit in Psychologie mag manchen überraschen. Jean-Paul Sartre, war der nicht Philosoph? Psychoanalyse – die ist doch von Sigmund Freud. Einige mag das wundern. Obwohl ein Psychologe doch weiß, dass seine Wissenschaft untrennbar in der Philosophie wurzelt. Er weiß, dass es zu einer Psychologie als Wissenschaft gekommen ist, weil seit jeher Menschen sich Fragen wie folgende gestellt haben: Wer sind wir? Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Warum tun wir dies und jenes? Dennoch: Jean-Paul Sartre als Psychologe? Nun gut, gewissermaßen sind alle Philosophen zum Teil auch Psychologen. Aber hat er wirklich etwas Wichtiges zur Psychologie beigetragen? Etwas, das auch von praktischem Wert und Nutzen ist? Die Antwort lautet: Ja. Aber warum erfährt man davon so gut wie gar nichts? Warum gibt es kaum etwas darüber zu lesen, wird nur ganz selten etwas darüber gelehrt?
Woran mag das liegen? Nun, zum einen wohl einmal daran, dass Jean-Paul Sartre in der breiten Öffentlichkeit zu allererst als Dramatiker bekannt ist. Und zwar als Dramatiker, dessen Werke auf den ersten Blick einen ziemlich düsteren und hoffnungslosen Eindruck hinterlassen. Ich denke dabei zum Beispiel an „Tote ohne Begräbnis“, „Die schmutzigen Hände“ oder seinen Film „Das Spiel ist aus“. Alleine vom Titel her klingen sie nicht gerade besonders erbaulich. Manch einem mag es dabei die Lust nehmen, sich mit der dahinterstehenden Philosophie zu beschäftigen, ohne die jedoch diese Dramen eigentlich nur sehr schwer verständlich sind. Zum zweiten mag es daran liegen, dass der Existentialismus besonders während der Nachkriegszeit als eine Lebenseinstellung missbraucht worden ist, die es angeblich dem Einzelnen gestattet, sein Leben unabhängig von allen Anderen und frei von jeglicher Verantwortung gegenüber seinen Mitmenschen in vollster Egomanie auszuleben. Auch dieser Eindruck trügt. Menschen, die glauben, die Rechtfertigung für ein solches Dasein aus dem Existentialismus ziehen zu können, haben von ihm überhaupt keine Ahnung.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Philosophische Hintergründe des Existentialismus Jean-Paul Sartres
- 1.1 René Descartes und das „cogito“
- 1.2 Husserl, Heidegger und die Phänomenologie
- 2. Der Existentialismus Jean-Paul Sartres
- 2.1 Die Existenz des Anderen: Der Blick
- 3. Die existentielle Psychoanalyse
- 3.1 Die Kritik des Sartreschen Existentialismus an der Psychologie und der Freudschen Psychoanalyse
- 3.1.1 Unreflektiertes Bewusstsein und reflexives Bewusstsein
- 3.1.2 Die substantialistische Täuschung der Psychologie
- 3.1.3 Das Unbewusste
- 3.1.3.1 Die alltagssprachliche Bedeutung des Begriffs „unbewusst“
- 3.1.3.2 Der Begriff „unbewusst“ im Sprachgebrauch des psychologischen Wortschatzes
- 3.1.3.3 Das Unbewusste in der Psychoanalyse
- 3.1.3.4 Anmerkung: Le vécu: Die gelebte Erfahrung
- 3.1.4 Gewalt als Merkmal der psychoanalytischen Beziehung
- 3.1.3.1 Anmerkung: Die „zwei“ Psychoanalysen
- 3.2 Die Schlussfolgerungen des Existentialismus Jean-Paul Sartres für die Psychologie
- 3.2.1 Das Ziel des Für-sich: Das An-und-für-sich
- 3.2.2 Die Urwahl oder der Urentwurf
- 3.2.3 Die objektiven Bedeutungen der Dinge oder: Der ontologische Sinn der Qualitäten
- 3.2.3.1 Die drei großen Kategorien der konkreten menschlichen Existenz: Tun, Haben und Sein
- 3.2.3.2 Die Enthüllung des Seins der Dinge durch die Qualität – die Psychoanalyse der Dinge
- 3.3 Theorie der existentiellen Psychoanalyse
- 3.3.1 Die Grundgedanken der existentiellen Psychoanalyse
- 3.3.2 Die Aufgaben der existentiellen Psychoanalyse
- 3.3.3 Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen der existentiellen Psychoanalyse und der Freudschen Psychoanalyse
- 3.3.4 Die Biographien: „Der Idiot der Familie“ und „Saint Genet“
- 3.1 Die Kritik des Sartreschen Existentialismus an der Psychologie und der Freudschen Psychoanalyse
- 4. Anmerkungen: Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen der existentiellen Psychoanalyse und anderen Ansätzen aus Psychologie und Psychotherapie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die existentielle Psychoanalyse Jean-Paul Sartres, indem sie ihre philosophischen Wurzeln beleuchtet und ihre Kritik an der traditionellen Psychologie und der Freudschen Psychoanalyse darlegt. Die Arbeit analysiert Sartres Konzepte und zeigt ihre Relevanz für das Verständnis menschlicher Existenz auf.
- Philosophische Grundlagen der Sartreschen Existentialpsychoanalyse
- Kritik an der traditionellen Psychologie und der Freudschen Psychoanalyse
- Konzept des Bewusstseins und des Unbewussten bei Sartre
- Existentielle Freiheit und Verantwortung
- Anwendung der existentiellen Psychoanalyse auf konkrete Lebensfragen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Philosophische Hintergründe des Existentialismus Jean-Paul Sartres: Dieses Kapitel legt die philosophischen Grundlagen der Sartreschen Existentialpsychoanalyse dar, indem es die Einflüsse von Descartes, Husserl und Heidegger untersucht. Die Auseinandersetzung mit dem „cogito“ Descartes’ und der Phänomenologie Husserls und Heideggers bildet den Ausgangspunkt für Sartres eigene existenzialistische Philosophie und seine Konzeption des menschlichen Bewusstseins. Das Kapitel betont die Bedeutung der subjektiven Erfahrung und des individuellen Daseins für Sartres Denken.
2. Der Existentialismus Jean-Paul Sartres: Dieses Kapitel führt in den Existentialismus Jean-Paul Sartres ein und konzentriert sich besonders auf den Aspekt der Existenz des Anderen. Der „Blick“ des Anderen, die Wahrnehmung durch die Außenwelt, und die damit verbundene Verdinglichung des Selbst werden als konstitutive Elemente des menschlichen Daseins beschrieben. Das Kapitel legt die Bedeutung der Interaktion und des Einflusses der sozialen Umwelt auf die Selbstwahrnehmung und die Existenz des Individuums dar.
3. Die existentielle Psychoanalyse: Dieses Kapitel stellt die existentielle Psychoanalyse Sartres vor und analysiert seine scharfe Kritik an der traditionellen Psychologie und der Freudschen Psychoanalyse. Sartre kritisiert insbesondere die Konzeption des Unbewussten und die Reduktion des Menschen auf psychische Mechanismen. Das Kapitel erörtert ausführlich Sartres Konzept des Bewusstseins und hebt die Bedeutung von Freiheit, Verantwortung und der subjektiven Erfahrung hervor. Es werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede zur Freudschen Psychoanalyse herausgestellt und die spezifischen Aufgaben der existentiellen Psychoanalyse definiert.
4. Anmerkungen: Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen der existentiellen Psychoanalyse und anderen Ansätzen aus Psychologie und Psychotherapie: Dieses Kapitel vergleicht die existentielle Psychoanalyse mit anderen psychologischen und psychotherapeutischen Ansätzen, um ihre Eigenheiten und ihren Beitrag zum Verständnis menschlicher Existenz herauszuarbeiten. Es beleuchtet die spezifischen Stärken und Schwächen der existentiellen Psychoanalyse im Vergleich zu anderen Methoden. Die Kapitel diskutiert die unterschiedlichen Behandlungsansätze und die jeweiligen konzeptionellen Grundlagen.
Schlüsselwörter
Existentialismus, Jean-Paul Sartre, existentielle Psychoanalyse, Phänomenologie, Bewusstsein, Unbewusstes, Freiheit, Verantwortung, Kritik der Psychoanalyse, Dasein, Existenz des Anderen, Le vécu.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Existentiellen Psychoanalyse Jean-Paul Sartres
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die existentielle Psychoanalyse Jean-Paul Sartres. Sie beleuchtet die philosophischen Grundlagen, die Kritik an traditioneller Psychologie und der Freudschen Psychoanalyse, und untersucht Sartres Konzepte zur menschlichen Existenz.
Welche philosophischen Hintergründe werden behandelt?
Die Arbeit untersucht die philosophischen Wurzeln der Sartreschen Existentialpsychoanalyse, insbesondere den Einfluss von Descartes (cogito), Husserl und Heidegger (Phänomenologie). Die Bedeutung der subjektiven Erfahrung und des individuellen Daseins wird hervorgehoben.
Wie kritisiert Sartre die traditionelle Psychologie und die Freudschen Psychoanalyse?
Sartre kritisiert die traditionelle Psychologie und die Freudschen Psychoanalyse scharf. Er beanstandet die Konzeption des Unbewussten und die Reduktion des Menschen auf psychische Mechanismen. Er betont stattdessen die Bedeutung von Freiheit, Verantwortung und subjektiver Erfahrung.
Welche Rolle spielen Bewusstsein und Unbewusstes in Sartres Denken?
Sartre unterscheidet zwischen reflektiertem und unreflektiertem Bewusstsein. Seine Kritik am psychoanalytischen Unbewussten wird detailliert dargestellt. Der Begriff des "Le vécu" (die gelebte Erfahrung) spielt eine zentrale Rolle.
Welche zentralen Konzepte der existentiellen Psychoanalyse werden erläutert?
Die Arbeit erklärt zentrale Konzepte wie die Existenz des Anderen ("Der Blick"), existentielle Freiheit und Verantwortung, die "Urwahl" oder den "Urentwurf", und die ontologische Bedeutung der Dinge (Tun, Haben, Sein).
Wie werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede zur Freudschen Psychoanalyse dargestellt?
Die Arbeit vergleicht die existentielle Psychoanalyse mit der Freudschen Psychoanalyse, hebt Gemeinsamkeiten und Unterschiede hervor und definiert die spezifischen Aufgaben der existentiellen Psychoanalyse.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Die Arbeit besteht aus vier Kapiteln: Kapitel 1 behandelt die philosophischen Grundlagen; Kapitel 2 führt in den Sartreschen Existentialismus ein; Kapitel 3 stellt die existentielle Psychoanalyse vor und analysiert die Kritik an anderen Ansätzen; Kapitel 4 vergleicht die existentielle Psychoanalyse mit anderen psychologischen und psychotherapeutischen Ansätzen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Existentialismus, Jean-Paul Sartre, existentielle Psychoanalyse, Phänomenologie, Bewusstsein, Unbewusstes, Freiheit, Verantwortung, Kritik der Psychoanalyse, Dasein, Existenz des Anderen, Le vécu.
Für wen ist diese Arbeit bestimmt?
Diese Arbeit ist für Leser gedacht, die sich für die existentielle Psychoanalyse Jean-Paul Sartres und deren philosophische Grundlagen interessieren. Sie eignet sich für akademische Zwecke und die Analyse existenzialistischer Themen.
Wo finde ich weitere Informationen?
Weitere Informationen können durch die Recherche der genannten Schlüsselwörter und Autoren in wissenschaftlichen Datenbanken und Literatur gefunden werden.
- Arbeit zitieren
- Dipl.-Psych. Uli Buchner (Autor:in), 1989, Die existentielle Psychoanalyse Jean-Paul Sartres, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/91663