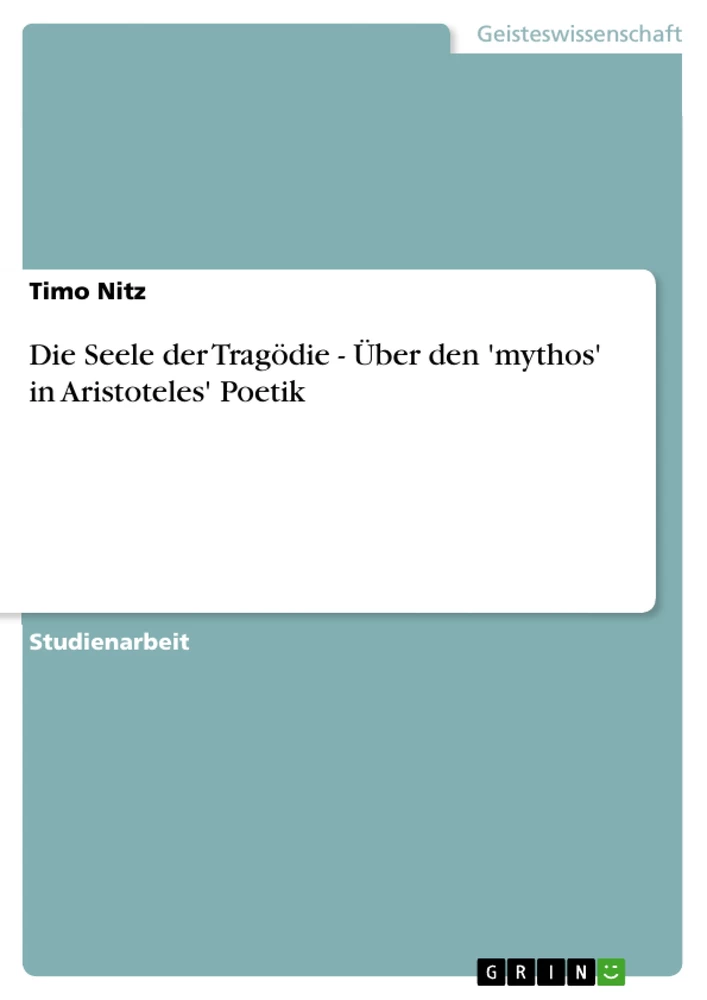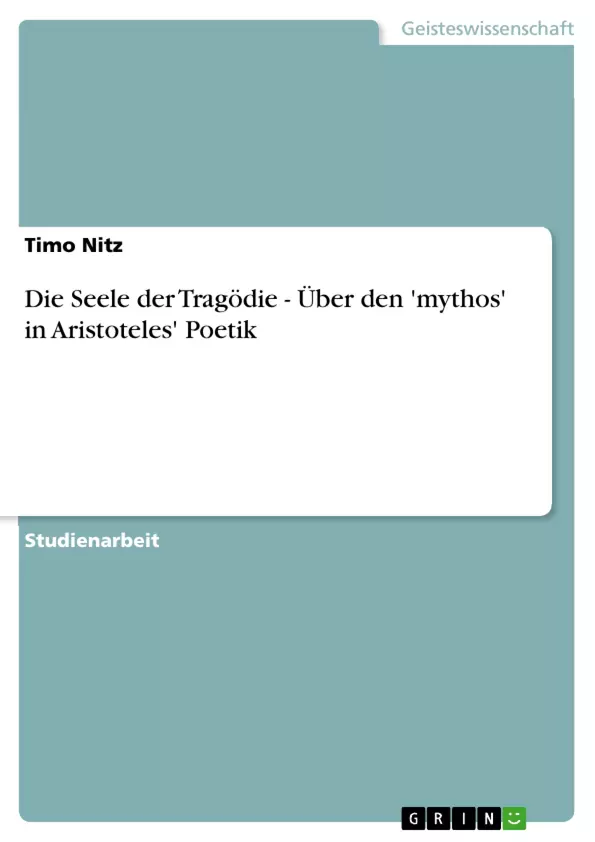In der POETIK des Aristoteles, die wohl nach 335 v. Chr. entstand, können wir erfahren, was Aristoteles unter Dichtkunst versteht und wann eine Tragödie als eine gelungene Tragödie bezeichnet werden kann. Für Aristoteles ist die Tragödie Nachahmung: eine spezifische Nachahmung von Handlungen und Lebenswirklichkeit. Hierbei darf selbstverständlich nicht daran gedacht werden, dass Aristoteles an eine zwingend original getreue Nachahmung des natürlich Gegebenen denkt. Vielmehr muss berücksichtigt werden, dass der Begriff der Nachahmung lediglich der Versuch einer Übersetzung des griechischen „μίμησις“ (mimesis) darstellt und im deutschen nur unzureichend mit „Nachahmung“ wiedergegeben wird. Trefflicher ließe sich von Gestaltung, Bildung, Werk, oder vielleicht am Besten, von Darstellung sprechen. In diesem Sinne zeigt sich die Tragödie für Aristoteles als schöpferische Nachahmung oder eben als Darstellung. Und „daher sind die Geschehnisse und der Mythos das Ziel der Tragödie; das Ziel aber ist das Wichtigste von allem.“ (POETIK. [1450a 22]). „Das Fundament und gewissermaßen die Seele der Tragödie ist also der Mythos.“ ([1450a 38])
Fast unbemerkt schleicht sich an dieser Stelle ein Begriff mit in die Diskussion ein, der so ohne weiteres in seiner Bedeutung nicht auf unmittelbares Verständnis stößt: „der Mythos“.
Wir wollen daher im Folgenden der Frage nachgehen, was der „mythos“ (μῦθος) für Aristoteles bedeutet und welchen Stellenwert er in der POETIK in Bezug auf die Tragödie einnimmt. Hierzu nähern wir uns anfänglich dem Begriff des mythos, was ihn bezeichnet und beschreibt, um im weiteren ein Verständnis von dem zu gewinnen, was der mythos fasst.
Inhaltsverzeichnis
- VORHANG AUF! …...………………….
- MYOOZ. ÜBER EINEN BEGRIFF UND DESSEN VERWENDUNG............
- DIE BESCHAFFENHEIT DES MYTHOS IN SEINEN UNTERSCHIEDLICHEN BEDEUTUNGSZUSAMMENHÄNGEN
- ÜBER DIE GRÖBE DES MYTHOS. ODER: DAS GESETZ DES SCHÖNEN
- DER UNTEILBARE MYTHOS - DIE TEILE DES GANZEN .......
- DER CHARAKTEr des WunderbBAREN & DES LEIDS. DIE 3 TRAGISCHEN MOMENTE DES MYTHOS.
- DIE KOMPOSITION DES TRAGISCHEN MYTHOS.
- [1454A 14]. ODER: EIN SCHLUSSWORT ....
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text „Die Seele der Tragödie. Über den mythos in Aristoteles' Poetik“ befasst sich mit der Bedeutung des „mythos“ in Aristoteles' Poetik. Das Ziel des Autors ist es, den Begriff „mythos“ im Kontext der Tragödie zu analysieren und zu verstehen, welche Rolle er für die Struktur und die Wirkung von Tragödien spielt.
- Die Bedeutung des "mythos" in Aristoteles' Poetik
- Die verschiedenen Bedeutungszusammenhänge des Begriffs "mythos"
- Die Rolle des "mythos" in der Struktur und Wirkung von Tragödien
- Die Komposition des tragischen "mythos"
- Die verschiedenen Teile des "mythos" und deren Bedeutung
Zusammenfassung der Kapitel
- Das einleitende Kapitel „Vorhang auf!“ führt den Leser in das Thema der Tragödie ein und stellt den Bezug zur Poetik des Aristoteles her. Der Autor diskutiert dabei die Inszenierung der „Orestie“ von Aischylos im Sommer 2007 in Epidaurus und vergleicht die damalige Inszenierung mit der Kritik des Aristoteles an der Dichtkunst.
- Das Kapitel „μüßoç. Über einen Begriff und dessen Verwendung.“ analysiert den Begriff „mythos“ im Kontext der Poetik des Aristoteles. Der Autor untersucht die Stellung des „mythos“ innerhalb der Tragödie und befasst sich mit der Unterscheidung von „mythos“ als Teil der Dichtung und als Handlung.
Schlüsselwörter
Die zentralen Begriffe des Textes sind „mythos“, „Tragödie“, „Poetik“, „Aristoteles“, „Dichtkunst“, „Nachahmung“, „Handlung“, „Komposition“, „Struktur“ und „Wirkung“. Der Text beschäftigt sich mit der Bedeutung des „mythos“ in der Tragödie im Kontext der Poetik des Aristoteles. Dabei werden die verschiedenen Bedeutungszusammenhänge des Begriffs „mythos“ untersucht sowie seine Rolle für die Struktur und die Wirkung von Tragödien.
- Citation du texte
- Timo Nitz (Auteur), 2007, Die Seele der Tragödie - Über den 'mythos' in Aristoteles' Poetik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/91694