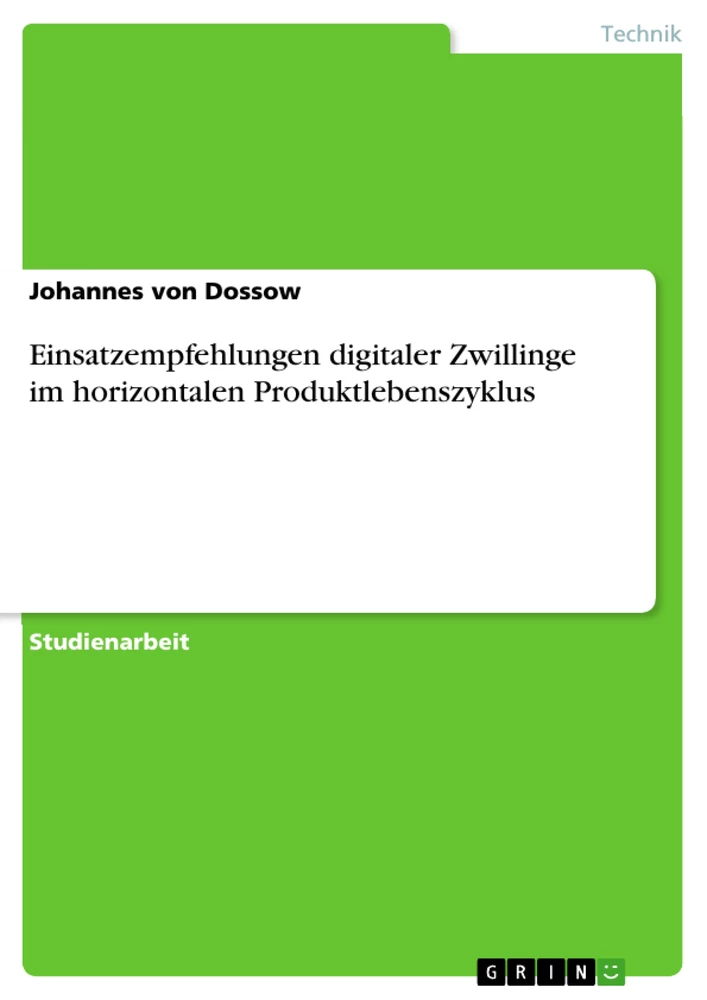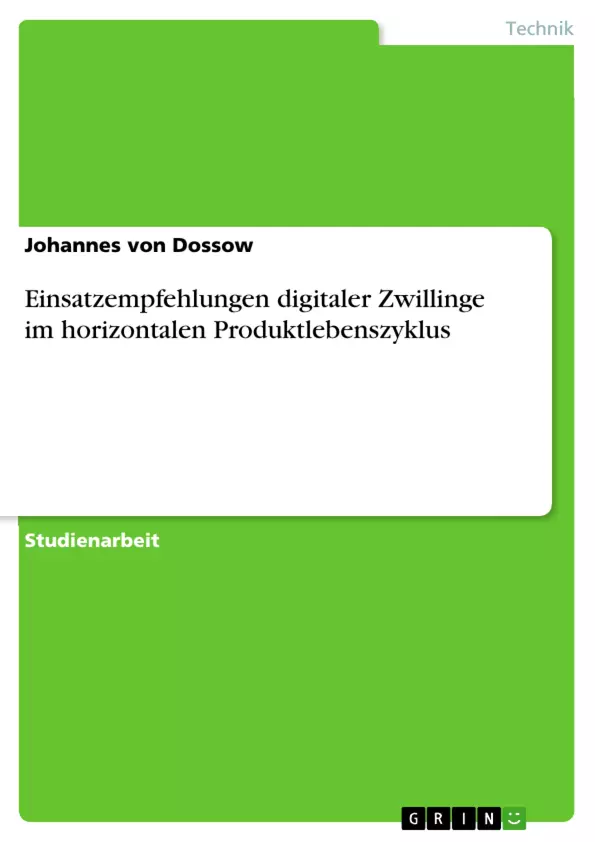Ein einheitliches Ziel aller ökonomisch agierenden Unternehmen, die Produktivitätssteigerung, hat einen neuen Inkubator entdeckt, die Industrie 4.0. Das Internet der Dinge verspricht, dass bis Ende 2020 rund 37 Milliarden Dinge in Form von Komponenten, Produkten und Systemen mit dem Internet verbunden sein werden.
Auf Industrie 4.0 aufbauend werden disruptive Geschäftsmodelle wie Predictive Maintenance oder die Erschaffung sogenannter ‚digitaler Zwillinge‘ entwickelt. In angelsächsischer Literatur gerne auch als Digital Twins bezeichnet. Allein im Anlagen- und Maschinenbau wird bis 2025 eine kumulierte Produktivitätssteigerung von 30 % erwartet, die Erwartungen an die Industrie 4.0 sind entsprechend hoch.
Diese Hausarbeit grenzt sich dabei klar zu den anderen disruptiven Geschäftsmodellen von Industrie 4.0 ab und befasst sich vorwiegend mit der Technologie der digitalen Zwillinge. Besonders im Maschinen- und Anlagenbau mit hoher Komplexität und Fertigungstiefe soll der digitale Zwilling bis Ende 2020 in 90 % der Unternehmen eingesetzt werden.
Digitale Zwillinge können prinzipiell im gesamten Produktlebenszyklus eingesetzt werden. Oft wird jedoch ausschließlich von der Digitalisierung von Fabrik- und IT- Systemen als vertikaler Integration gesprochen. Für die gewünschten Produktivitätssteigerungen ist jedoch besonders der horizontale Produktlebenszyklus bedeutend. Das Augenmerk dieser Hausarbeit soll darum auf digitale Zwillinge im horizontalen Produktlebenszyklus von Anlagen und Produkten gelegt werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Industrie 4.0 und der digitale Zwilling
- 2.1 Industrie 4.0 als Inkubator
- 2.2 Die digitalen Zwillinge
- 2.2.1 Herkunft & Definition
- 2.2.2 Stand der Wissenschaft und Technik
- 3 Das Produktlebenszyklusmanagement
- 3.1 Produktlebenszyklen ohne digitale Zwillinge
- 3.2 Produktlebenszyklen mit Integration digitaler Zwillinge
- 4 Fragenkatalog zum Einsatz von digitalen Zwillingen
- 5 Fazit
- 6 Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Einsatzempfehlung digitaler Zwillinge im horizontalen Produktlebenszyklus und beleuchtet dabei die Frage, wie ein Produktlebenszyklus mit Integration digitaler Zwillinge gestaltet werden kann und welche Voraussetzungen für einen erfolgreichen Einsatz erfüllt sein sollten.
- Der digitale Zwilling als Schlüsseltechnologie der Industrie 4.0
- Der horizontale Produktlebenszyklus und die Integration digitaler Zwillinge
- Die Bedeutung der Datenverarbeitung und -analyse im Kontext des digitalen Zwillings
- Potenziale und Herausforderungen beim Einsatz digitaler Zwillinge
- Entwicklung eines Fragenkatalogs zur Beurteilung der Eignung digitaler Zwillinge im Produktlebenszyklus
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1: Einleitung
Die Einleitung stellt die Relevanz der Produktivitätssteigerung im Kontext von Industrie 4.0 dar und führt den digitalen Zwilling als disruptive Technologie ein. Die Hausarbeit fokussiert auf die Integration digitaler Zwillinge im horizontalen Produktlebenszyklus und definiert die zentralen Forschungsfragen.
Kapitel 2: Industrie 4.0 und der digitale Zwilling
Dieses Kapitel beleuchtet den Begriff Industrie 4.0 und seine historische Entwicklung sowie das Konzept des digitalen Zwillings. Es werden die Herkunft und Definition des digitalen Zwillings sowie der Stand der Forschung und Technik dargestellt.
Kapitel 3: Das Produktlebenszyklusmanagement
Kapitel 3 untersucht die verschiedenen Phasen des Produktlebenszyklus und analysiert die Integration digitaler Zwillinge in den horizontalen Produktlebenszyklus. Es werden die Vorteile und Herausforderungen dieses Ansatzes diskutiert.
Schlüsselwörter
Industrie 4.0, digitaler Zwilling, Produktlebenszyklus, horizontale Integration, Predictive Maintenance, Datenanalyse, Datenauswertung, Wettbewerbsvorteile, Geschäftsmodelle, Innovation, Cyber-Physical Systems.
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein digitaler Zwilling?
Ein digitaler Zwilling ist ein virtuelles Abbild eines physischen Objekts oder Systems, das Daten in Echtzeit nutzt, um Simulationen, Analysen und Optimierungen zu ermöglichen.
Wie hängen Industrie 4.0 und digitale Zwillinge zusammen?
Industrie 4.0 fungiert als Inkubator. Durch das Internet der Dinge (IoT) werden Milliarden von Objekten vernetzt, was die Erstellung und Nutzung digitaler Zwillinge erst ermöglicht.
Was bedeutet horizontaler Produktlebenszyklus?
Der horizontale Lebenszyklus umfasst alle Phasen eines Produkts von der Entwicklung über die Produktion bis hin zur Nutzung beim Kunden und dem Recycling.
Welche Vorteile bietet Predictive Maintenance?
Durch die Analyse der Daten des digitalen Zwillings können Wartungsbedarfe vorhergesagt werden, bevor ein Ausfall auftritt, was die Produktivität massiv steigert.
In welchen Branchen sind digitale Zwillinge besonders wichtig?
Besonders im Maschinen- und Anlagenbau mit hoher Komplexität und Fertigungstiefe werden sie zur Effizienzsteigerung und für neue Geschäftsmodelle eingesetzt.
- Arbeit zitieren
- Johannes von Dossow (Autor:in), 2020, Einsatzempfehlungen digitaler Zwillinge im horizontalen Produktlebenszyklus, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/918205