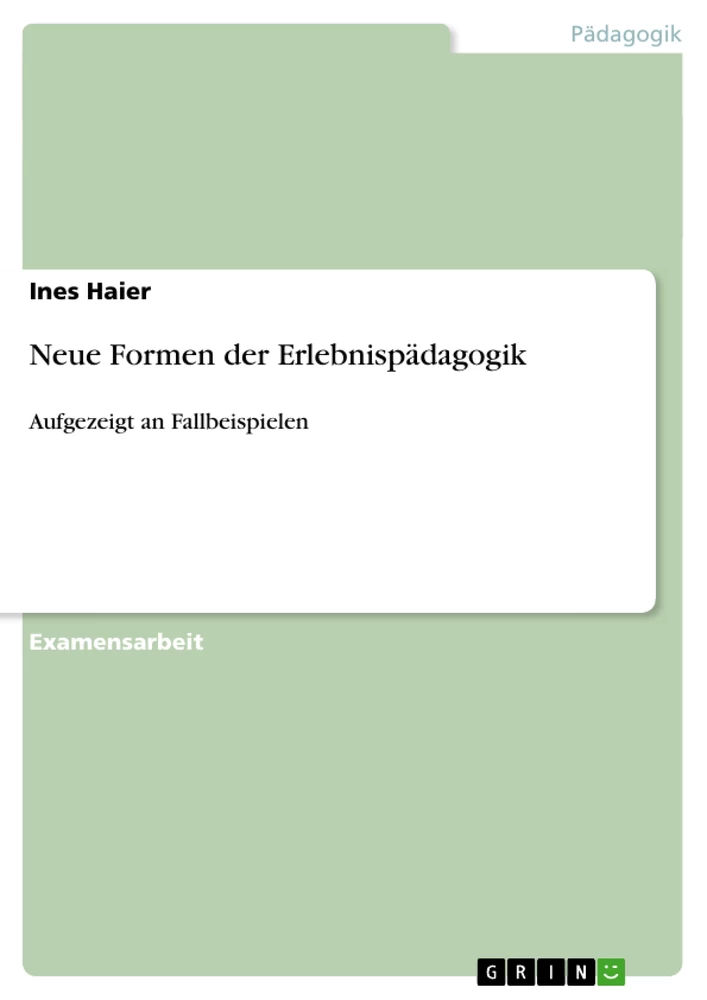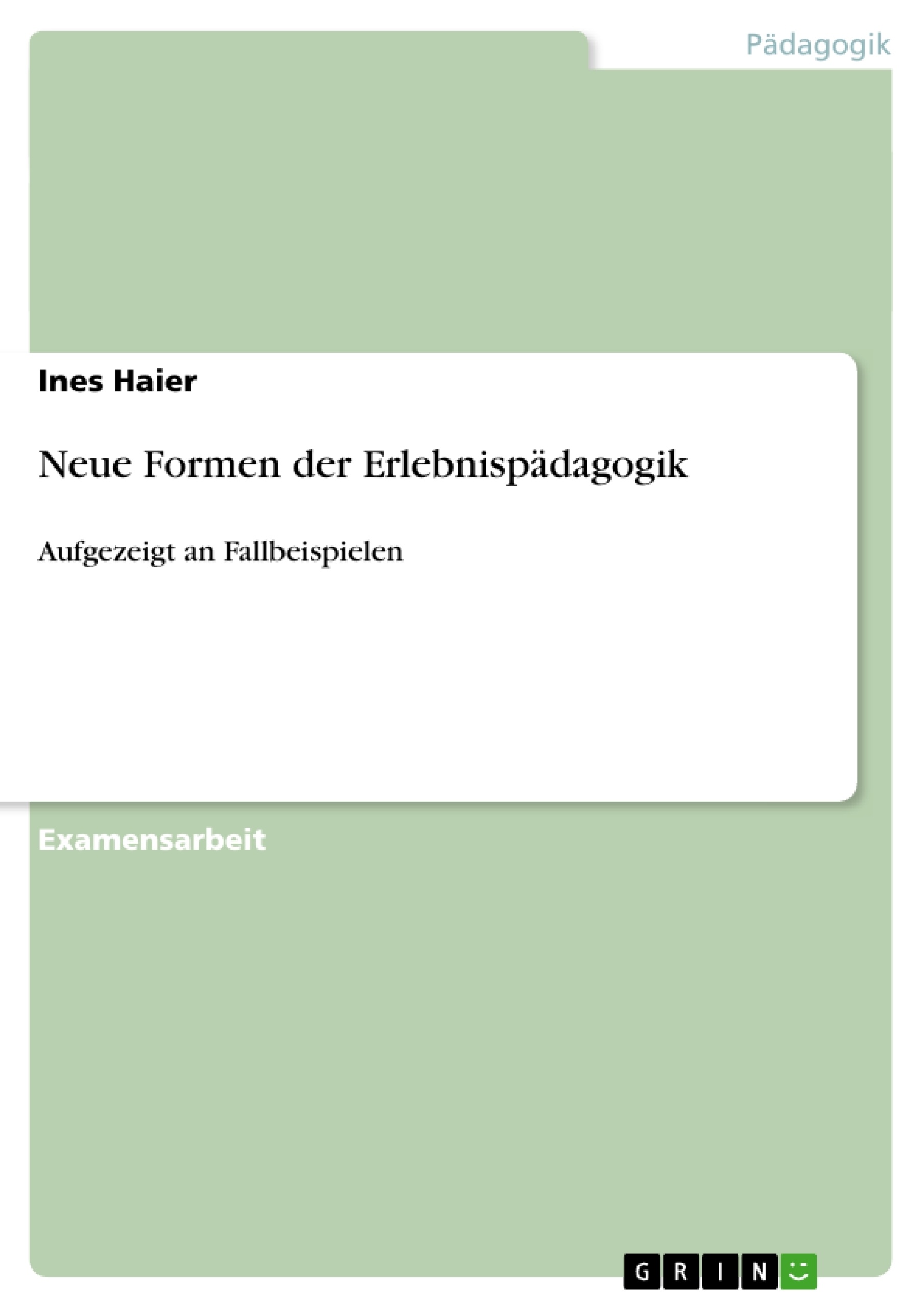Erlebnispädagogik ist ein weit gefächertes Terrain, das bis heute auf der Suche nach sich selbst ist. Immer noch fällt es schwer, eine einheitliche Definition von Erlebnispädagogik in
all ihren Formen und Facetten zu geben. Das zeigt, dass die Erlebnispädagogik noch nicht ausgereift ist und sie sich noch immer in einem Prozess der Weiterentwicklung befindet. Neue Sichtweisen und Formen der Erlebnispädagogik sind daher gefragter als je zuvor. Wer sich auf erlebnispädagogischem Gebiet bewegt wird schnell feststellen, wie schwierig es sich darstellt, zu wirklich guten, neuen Ansätzen vorzustoßen. Dennoch hat man bei der Erlebnispädagogik noch gute Chancen beim Ausbau ihres Wesens mitzuwirken. Das Gebiet, auf dem ich mich bewege, ist die erlebnispädagogische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Im Jahre 2003 habe ich bei EOS-Erlebnispädagogik e.V. begonnen, eine 2 jährige berufsbegleitende Ausbildung in Erlebnispädagogik (mit waldorfpädagogischen Hintergrund) zu absolvieren. Noch während der Ausbildung engagierte ich mich bei zahlreichen Ferienlagern und Klassenfahrten und arbeitete mich somit immer weiter in die erlebnispädagogische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ein. Als ich merkte, mit wie viel Freude die Kinder und Jugendlichen an den Ferienlagern teilnahmen und welche starken Auswirkungen allein ein Ferienlager auf das Leben von einzelnen Kindern haben kann, bekam die Erlebnispädagogik einen zentralen Stellenwert in meinem Leben. Immer wieder bemerkte ich, dass z.B. gerade Kinder und Jugendliche, die als sog. ADS- Kinder mit schwieriger schulischer Laufbahn galten, sich auf Ferienlagern ganz anders zeigten. Dadurch wurde mir immer klarer, dass diese erlebnispädagogischen Ferienlager eine wichtige Ergänzung zur schulischen Bildung darstellen können. Auch während meiner zahlreichen pädagogischen Praktika aufgrund meines Lehramtstudiums versuchte ich, einige erlebnispädagogische Elemente in meinen Unterricht mit einfließen zu lassen. Ganz besonders merkte ich, dass die Kinder an meinen Lippen hingen, wenn ich ihnen Geschichten erzählte. Dasselbe Phänomen bemerkte ich auch auf den Ferienlagern, nämlich, dass man Kinder durch Geschichten auf einer ganz tiefen seelischen Ebene ansprechen kann.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Wurzeln der Erlebnispädagogik
- Mythen und ausgewogene Bildung bei den alten Griechen
- Rousseau oder die Bildung durch die Natur
- David Henry Thoreau und Lehrmeisterin Natur
- Die Reformpädagogik und ihre Strömungen
- Die Kulturkritik
- Die Kunsterziehungsbewegung
- Die Jugendbewegung
- Die Arbeitsschulbewegung
- John Dewey
- Die Landerziehungsheimbewegung
- Die Erlebnistherapie von Kurt Hahn
- Jugendarbeit nach 1945 bis heute
- Einsatz und Entwicklungsfelder der modernen Erlebnispädagogik
- Medien der Erlebnispädagogik
- Wirkungsmodelle der Erlebnispädagogik
- The Mountain speaks for themselves
- Outward Bound Plus Modell
- Metaphorische Erlebnispädagogik
- Die kreativ-rituelle Prozessgestaltung
- Die Wichtigkeit des Transfers
- Skills in der Erlebnispädagogik
- Hard Skills
- Soft Skills
- Meta Skills
- Das Erlebnis in der Pädagogik
- Das Abenteuer in der Erlebnispädagogik
- Psychologisch-humanistische Erklärungsversuche der Abenteuersuche
- Soziologische Erklärungsversuche der Abenteurersuche
- Anthroposophische Elemente – als Grundlage für neue Formen der Erlebnispädagogik
- Rudolf Steiner als Erzieher
- Das anthroposophische Menschenbild
- Die Erziehung des Jugendlichen aus Sicht der Waldorfpädagogik
- Erziehung zum geistigen Bewusstsein
- Erziehung zur Eigenständigkeit
- Erziehung zur Selbstentwicklung
- Erziehung zum Willen
- Das Erlebnis bei Rudolf Steiner
- Erlebnis und Fähigkeit
- Die Schulung der Erlebnisfähigkeit
- Elemente zur Fähigkeitenentwicklung an der Waldorfschule
- Die Verarbeitung von Erlebnissen
- Der Versuch einer anthroposophischen Erlebnispädagogik am Beispiel von EOS-Erlebnispädagogik
- Das Projekt Schulzirkus eingebettet in das Thema Zigeuner
- Elemente der Märchen und Mythen in der Erlebnispädagogik
- Suche nach dem Sinn im Leben – und der Beitrag der Märchen und Mythen
- Von der Wirkung der Märchen
- Von der Wirkung von Mythen
- Mythos als erzieherisches Vorbild?
- Die Vorbildfunktion bei Eduard Spranger
- Die Vorbildfunktion bei Rudolf Steiner
- Lernen am Vorbild- die lernpsychologische Sicht
- Der Erlebnispädagoge als Vorbild
- Archetypen in der Erlebnispädagogik
- Auf den Spuren des König Artus – ein Ferienlager in Südengland
- Der Verlust der Mythen als Ausdruck fehlender Übergangsrituale in unserer Gesellschaft
- Das „Big Solo“ als Versuch eines erlebnispädagogischen Initiationsritus
- Das „Big Solo“ Ferienlager
- Interviews mit den Teilnehmern des „Big Solo“ Ferienlagers
- Heimweh nach dem Paradies - ein Grund für die Anziehungskraft der Erlebnispädagogik?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Frage, welche Möglichkeiten sich für die Erlebnispädagogik durch die Integration von Märchen und Mythen sowie anthroposophischen Elementen eröffnen. Der Fokus liegt auf der Suche nach neuen Formen der Erlebnispädagogik und deren Potenzial für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen.
- Integration von Märchen und Mythen in die Erlebnispädagogik
- Anthroposophische Elemente in der Erlebnispädagogik
- Suche nach neuen Formen der Erlebnispädagogik
- Potenzial für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
- Erlebnispädagogische Praxisbeispiele
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt den Ausgangspunkt der Arbeit dar und erläutert die Motivation des Autors, sich mit der Integration von Märchen und Mythen sowie anthroposophischen Elementen in der Erlebnispädagogik auseinanderzusetzen.
- Wurzeln der Erlebnispädagogik: Dieses Kapitel gibt einen umfassenden Überblick über die historischen Wurzeln der Erlebnispädagogik und beleuchtet die wichtigsten Strömungen und Persönlichkeiten, die die Entwicklung dieses Bereichs maßgeblich beeinflusst haben.
- Mythen und ausgewogene Bildung bei den alten Griechen: Dieses Kapitel erforscht die Rolle von Mythen in der antiken griechischen Erziehung und analysiert deren Einfluss auf die Entwicklung eines ganzheitlichen Menschenbildes.
- Rousseau oder die Bildung durch die Natur: In diesem Kapitel wird Jean-Jacques Rousseaus Philosophie der natürlichen Bildung beleuchtet, die erlebnispädagogische Ansätze stark beeinflusst hat.
- David Henry Thoreau und Lehrmeisterin Natur: Dieses Kapitel widmet sich dem Einfluss der Natur auf die Bildungsphilosophie von David Henry Thoreau und zeigt auf, wie er die Natur als Lehrmeisterin und Quelle für persönliches Wachstum verstand.
- Die Reformpädagogik und ihre Strömungen: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über die verschiedenen Strömungen der Reformpädagogik, die sich für eine erlebnisorientierte Pädagogik einsetzten, und beleuchtet deren Ziele und Prinzipien.
- Einsatz und Entwicklungsfelder der modernen Erlebnispädagogik: Dieses Kapitel präsentiert aktuelle Anwendungsfelder und Entwicklungsperspektiven der Erlebnispädagogik.
- Medien der Erlebnispädagogik: In diesem Kapitel werden verschiedene Medien vorgestellt, die in der Erlebnispädagogik eingesetzt werden können, um erlebnisreiche Lernprozesse zu gestalten.
- Wirkungsmodelle der Erlebnispädagogik: Dieses Kapitel beschreibt verschiedene Wirkungsmodelle der Erlebnispädagogik und erläutert, wie Erlebnispädagogik zu Persönlichkeitsentwicklung und Kompetenzaufbau beitragen kann.
- Die Wichtigkeit des Transfers: Dieses Kapitel beleuchtet die Bedeutung des Transfers von erlebnispädagogischen Erfahrungen in den Alltag und die Herausforderungen, die es bei der Übertragung erlebnispädagogischer Erkenntnisse in andere Lebensbereiche gibt.
- Skills in der Erlebnispädagogik: Dieses Kapitel beschreibt unterschiedliche Skill-Kategorien, die in der Erlebnispädagogik relevant sind, und analysiert deren Bedeutung für den Lernprozess.
- Das Erlebnis in der Pädagogik: Dieses Kapitel befasst sich mit dem zentralen Begriff „Erlebnis“ in der Pädagogik und beleuchtet seine Bedeutung für die Gestaltung von Lernprozessen.
- Das Abenteuer in der Erlebnispädagogik: Dieses Kapitel analysiert die Rolle des Abenteuers in der Erlebnispädagogik und geht auf verschiedene psychologische und soziologische Erklärungsansätze für die menschliche Abenteuersuche ein.
- Anthroposophische Elemente – als Grundlage für neue Formen der Erlebnispädagogik: Dieses Kapitel stellt Rudolf Steiner und die Anthroposophie als Inspirationsquelle für neue Formen der Erlebnispädagogik vor und beleuchtet die Möglichkeiten, die sich aus anthroposophischen Prinzipien für die Gestaltung von erlebnispädagogischen Prozessen ergeben.
- Elemente der Märchen und Mythen in der Erlebnispädagogik: Dieses Kapitel untersucht das Potenzial von Märchen und Mythen für die Erlebnispädagogik und analysiert deren Wirkung auf die kindliche und jugendliche Psyche.
- Suche nach dem Sinn im Leben – und der Beitrag der Märchen und Mythen: Dieses Kapitel beleuchtet die Rolle von Märchen und Mythen als Sinnstiftung für das menschliche Leben und zeigt auf, wie sie in der Erlebnispädagogik eingesetzt werden können, um Kindern und Jugendlichen Orientierung und Lebenshilfe zu bieten.
- Von der Wirkung der Märchen: Dieses Kapitel analysiert die psychologische und erzieherische Wirkung von Märchen.
- Von der Wirkung von Mythen: Dieses Kapitel analysiert die psychologische und erzieherische Wirkung von Mythen.
- Mythos als erzieherisches Vorbild?: Dieses Kapitel befasst sich mit der Frage, inwieweit Mythen als erzieherische Vorbilder dienen können.
- Die Vorbildfunktion bei Eduard Spranger: Dieses Kapitel analysiert Eduard Sprangers Konzeption von Vorbildlichkeit und deren Bedeutung für die erzieherische Praxis.
- Die Vorbildfunktion bei Rudolf Steiner: Dieses Kapitel analysiert Rudolf Steiners Konzeption von Vorbildlichkeit und deren Bedeutung für die erzieherische Praxis.
- Lernen am Vorbild- die lernpsychologische Sicht: Dieses Kapitel beleuchtet die lernpsychologische Sicht auf die Bedeutung von Vorbildern für den Lernprozess.
- Der Erlebnispädagoge als Vorbild: Dieses Kapitel analysiert die Rolle des Erlebnispädagogen als Vorbild für Kinder und Jugendliche.
- Archetypen in der Erlebnispädagogik: Dieses Kapitel untersucht die Bedeutung von Archetypen in der Erlebnispädagogik und zeigt auf, wie sie in der Gestaltung von erlebnispädagogischen Programmen genutzt werden können.
- Auf den Spuren des König Artus – ein Ferienlager in Südengland: Dieses Kapitel stellt ein konkretes Beispiel für ein erlebnispädagogisches Programm vor, das sich auf die Geschichte des König Artus bezieht.
- Der Verlust der Mythen als Ausdruck fehlender Übergangsrituale in unserer Gesellschaft: Dieses Kapitel analysiert die Auswirkungen des Verlustes von Mythen und Ritualen in der heutigen Gesellschaft auf die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen.
- Das „Big Solo“ als Versuch eines erlebnispädagogischen Initiationsritus: Dieses Kapitel beschreibt das „Big Solo“, ein erlebnispädagogisches Programm, das als Initiationsritus konzipiert ist.
- Das „Big Solo“ Ferienlager: Dieses Kapitel stellt das „Big Solo“ Ferienlager vor und beschreibt die Inhalte und Ziele des Programms.
- Interviews mit den Teilnehmern des „Big Solo“ Ferienlagers: Dieses Kapitel präsentiert Interviews mit Teilnehmern des „Big Solo“ Ferienlagers, die ihre Erfahrungen und Eindrücke schildern.
- Heimweh nach dem Paradies - ein Grund für die Anziehungskraft der Erlebnispädagogik?: Dieses Kapitel befasst sich mit der Frage, inwieweit die Sehnsucht nach einem Paradies die Anziehungskraft der Erlebnispädagogik erklären kann.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Erlebnispädagogik, Märchen, Mythen, Anthroposophie, Rudolf Steiner, Kinder und Jugendliche, Bildung, Erlebnis, Abenteuer, Sinnsuche, Vorbildfunktion, Archetypen und Übergangsrituale. Sie befasst sich insbesondere mit der Frage, wie sich diese Elemente sinnvoll in der Praxis der Erlebnispädagogik integrieren lassen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Besondere an neuen Formen der Erlebnispädagogik?
Sie integrieren Elemente wie Märchen, Mythen und anthroposophische Ansätze, um Kinder auf einer tieferen seelischen Ebene anzusprechen.
Welche Rolle spielt die Anthroposophie in dieser Arbeit?
Die Arbeit nutzt das anthroposophische Menschenbild Rudolf Steiners als Grundlage für die Erziehung zur Selbstentwicklung und zum Willen in der Erlebnispädagogik.
Was ist das "Big Solo" Projekt?
Es ist ein erlebnispädagogisches Ferienlager, das als moderner Initiationsritus konzipiert ist, um Jugendlichen den Übergang ins Erwachsenenalter zu erleichtern.
Warum sind Märchen und Mythen pädagogisch wertvoll?
Sie dienen als Sinnstiftung und bieten Kindern durch archetypische Vorbilder Orientierung und Lebenshilfe.
Was versteht man unter dem "Transfer" in der Erlebnispädagogik?
Transfer bedeutet die Übertragung der im Abenteuer oder Erlebnis gewonnenen Erkenntnisse und Fähigkeiten in den alltäglichen Lebensbereich.
- Arbeit zitieren
- Ines Haier (Autor:in), 2006, Neue Formen der Erlebnispädagogik, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/91842