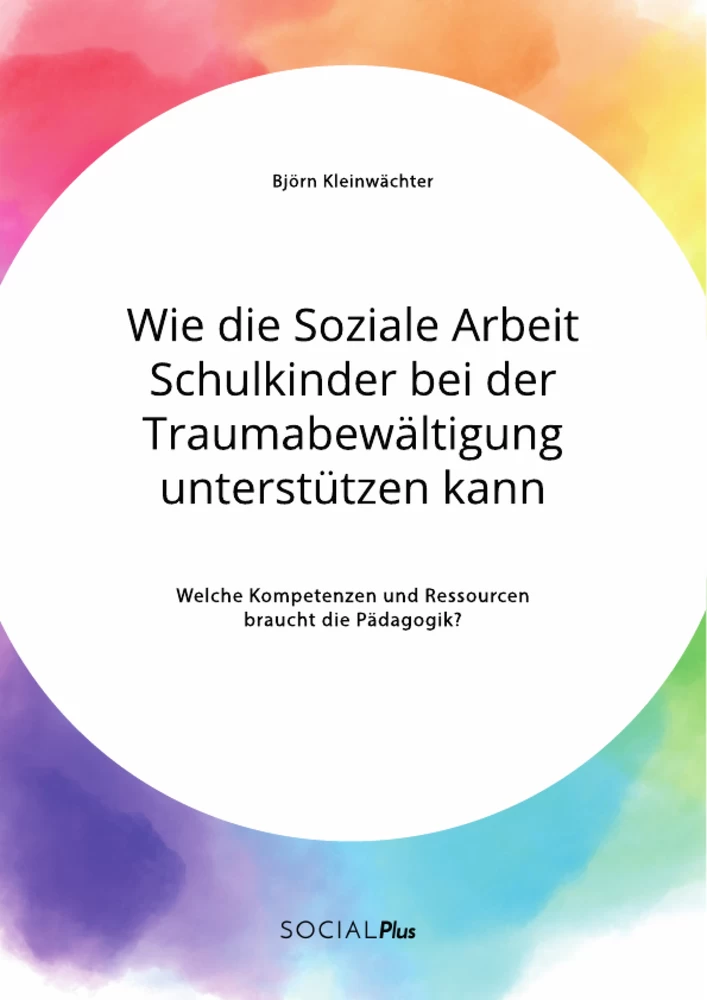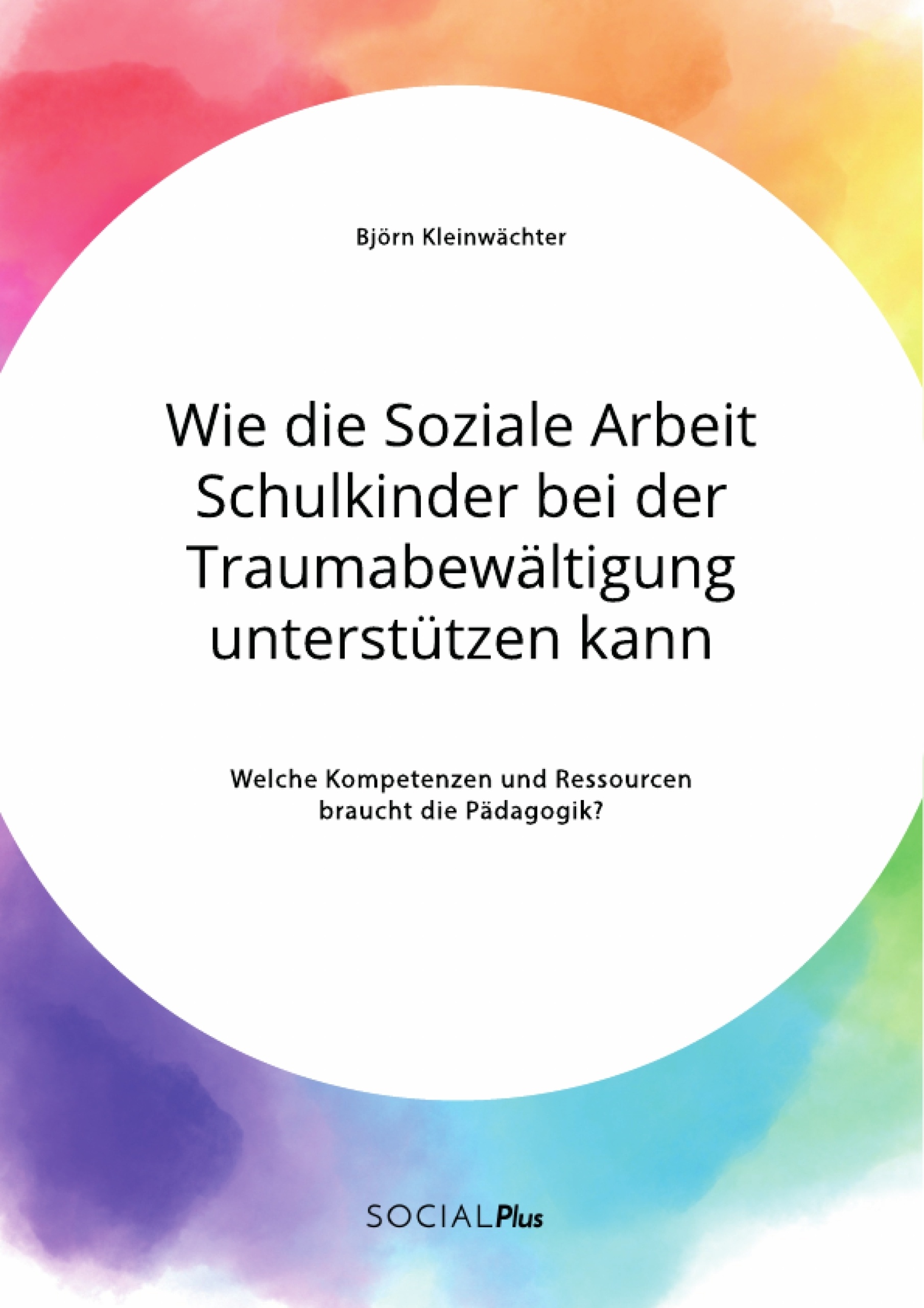Die Gesellschaft assoziiert Kindheit häufig mit Unbeschwertheit und Sorglosigkeit. Kinder sind auf die Fürsorge und Unterstützung ihrer Umgebung angewiesen, welche ihnen Schutz und die Erfüllung ihrer Grundbedürfnisse gewährt. Wenn diese Umgebung nicht oder nur in einer einschränkenden oder gar destruktiven Natur vorhanden ist, kann es zu schweren pathologischen Folgen kommen.
Welche Faktoren lösen Traumata bei Kindern aus? Wie sollten Pädagog/innen mit traumatisierten Kindern umgehen? Welche Rahmenbedingungen müssen bei der Arbeit mit Betroffenen gegeben sein? Welche Kompetenzen brauchen Pädagog/innen, um den Kindern eine bestmögliche Betreuung zu bieten?
Björn Kleinwächter untersucht, wie die Soziale Arbeit traumatisierte Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren begleiten und unterstützen kann. Er beschreibt die Methodenkompetenzen, Arbeitsweisen und Ressourcen, die nötig sind, damit diese Kinder ihr Leben selbstbestimmt fortführen können.
Aus dem Inhalt:
- Sozialpädagogik;
- Bindungsverhalten;
- Elternarbeit;
- Netzwerkarbeit;
- Resilienz;
- Dissoziation;
- Selbstbild
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Trauma
- Definition und Entstehung
- Traumafolgestörungen
- Traumatisierung im Kindesalter
- Risikofaktoren für Traumatisierung im Kindesalter
- Symptomatische Folgen und Auswirkungen von Traumatisierung auf Kinder
- Zwischenfazit zu kindlicher Traumatisierung und Einordnung in das aktuelle Verständnis von Traumata
- Soziale Arbeit und Trauma: Pädagogischer Umgang und Behandlungsmöglichkeiten am Beispiel der stationären Kinder- und Jugendhilfe
- Trauma: Ein Thema der Sozialen Arbeit
- Die Trennung aus der traumatisierenden Umgebung
- Resilienz und Ressourcen bei traumatisierten Kindern
- Lebensweltorientierung in der Arbeit mit traumatisierten Kindern
- Entwicklungsaufgaben der Kinder (nach Havighurst)
- Geschlechtsspezifische Unterschiede und Besonderheiten
- Praktische Arbeit mit traumatisierten Kindern in stationären Einrichtungen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit beleuchtet die Bedeutung der Unterstützung von traumatisierten Kindern im Alter von sechs bis zwölf Jahren durch die Soziale Arbeit. Sie analysiert die Herausforderungen, die mit Traumatisierung im Kindesalter verbunden sind, und untersucht, welche Kompetenzen und Ressourcen die Pädagogik benötigt, um traumatisierte Kinder effektiv zu unterstützen.
- Definition und Entstehung von Trauma
- Traumafolgestörungen im Kindesalter
- Risikofaktoren und Auswirkungen von Traumatisierung auf Kinder
- Die Rolle der Sozialen Arbeit bei der Traumabewältigung
- Entwicklungsspezifische Herausforderungen und Ressourcen in der Arbeit mit traumatisierten Kindern
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema Traumatisierung im Kindesalter ein und betont die Bedeutung der Unterstützung durch die Pädagogik. Kapitel 2 definiert Trauma und seine Entstehung, wobei Traumafolgestörungen im Detail betrachtet werden. Kapitel 3 analysiert die Risikofaktoren und Folgen von Traumatisierung im Kindesalter, wobei besondere Aufmerksamkeit den Auswirkungen auf die kindliche Entwicklung gewidmet wird. Kapitel 4 untersucht die Rolle der Sozialen Arbeit im Umgang mit traumatisierten Kindern und analysiert die Herausforderungen und Ressourcen, die für eine effektive Unterstützung benötigt werden.
Schlüsselwörter
Diese Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Trauma, Traumatisierung im Kindesalter, Soziale Arbeit, Pädagogik, Resilienz, Ressourcen, Entwicklungsaufgaben, stationäre Kinder- und Jugendhilfe und Lebensweltorientierung. Sie untersucht die Herausforderungen und Möglichkeiten der Unterstützung von traumatisierten Kindern im Rahmen der Sozialen Arbeit.
- Quote paper
- Björn Kleinwächter (Author), 2021, Wie die Soziale Arbeit Schulkinder bei der Traumabewältigung unterstützen kann. Welche Kompetenzen und Ressourcen braucht die Pädagogik?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/918548