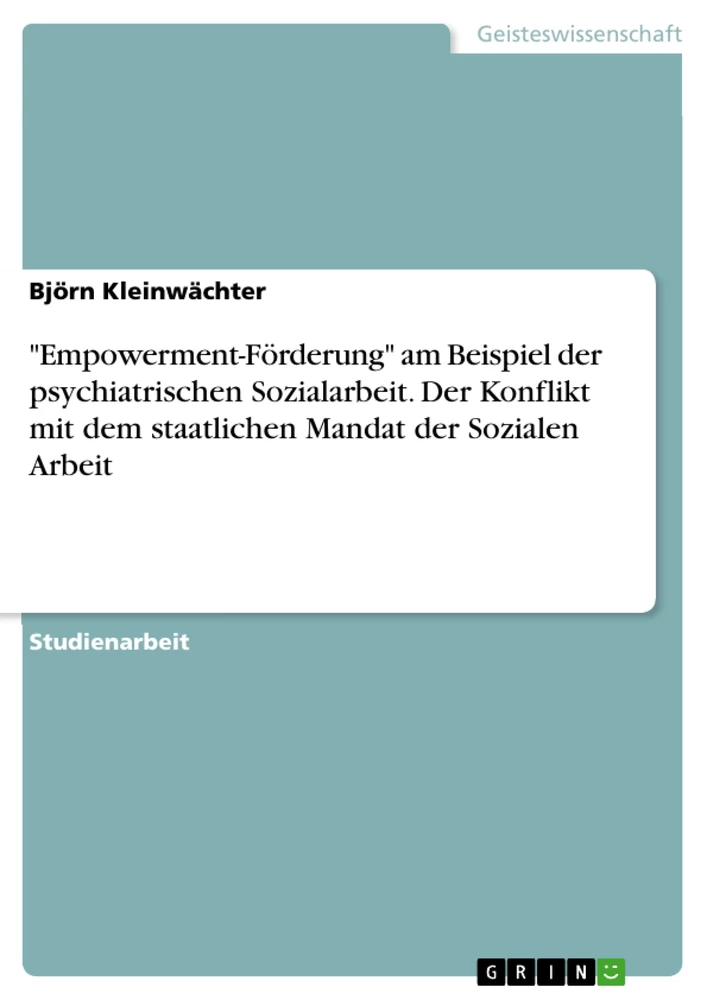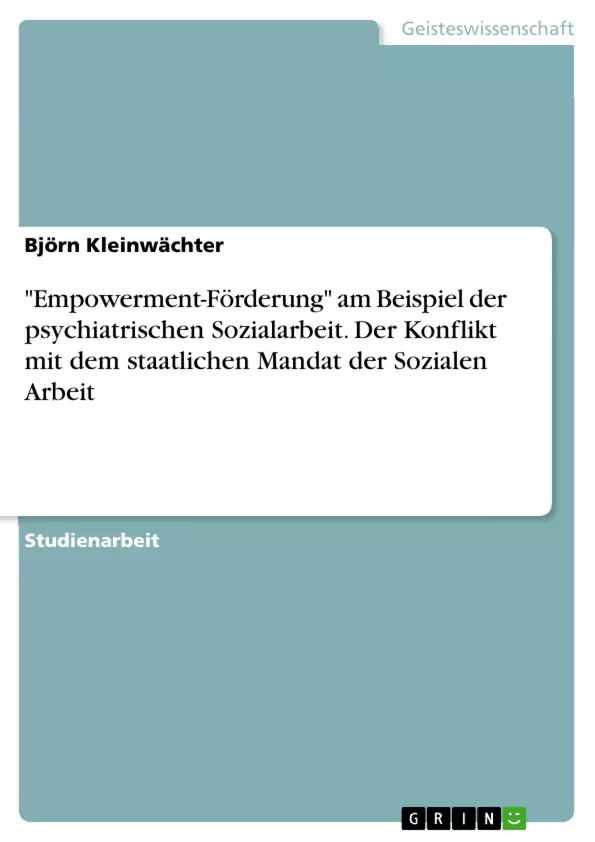Die Arbeit hat zum Ziel, die "Empowerment-Förderung" unter Betrachtung des staatlichen Mandats der Sozialen Arbeit zu bewerten. Es wird untersucht, ob dieses Konzept durch die äußerlichen Bedingungen zu sehr in die Schranken gewiesen wird oder sich gut mit ihnen vereinbaren lässt.
Des Weiteren soll festgestellt werden, ob externe Aufträge bei einem modernen Professionsverständnis überhaupt noch legitimiert werden können. Um einen praktischen Bezug zu der Sozialen Arbeit herzustellen, werden das Konzept so wie die theoretischen Überlegungen zum Professionsverständnis am Beispiel der psychiatrischen Sozialarbeit erläutert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Empowerment
- Herkunft und Entstehung des Konzeptes
- Definition und Bedeutung
- Allgemeine Definition
- Bedeutung von „Empowerment“ im Kontext psychiatrischer Sozialarbeit
- „Empowerment“-Förderung in der Praxis
- Soziale Arbeit im Spannungsfeld der Mandate
- Das Mandat der Hilfe
- Das Mandat der Kontrolle
- Das Spannungsfeld der Mandate in der psychiatrischen Sozialarbeit
- „Empowerment“ im Spannungsfeld der Mandate
- „Empowerment“-Förderung und das Mandat der Kontrolle
- Das Mandat der Kontrolle als Ausfluss staatlicher Regelungen und ethischer Grundsätze
- Mandat der Kontrolle in einem modernen Professionsverständnis
- Soziale Arbeit zwischen Hilfe und Sicherheit
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit zielt darauf ab, die „Empowerment-Förderung“ im Kontext des staatlichen Mandats der Sozialen Arbeit zu evaluieren. Es wird untersucht, ob dieses Konzept durch externe Bedingungen eingeschränkt wird oder sich mit ihnen vereinbaren lässt. Weiterhin soll geklärt werden, ob externe Aufträge im Rahmen eines modernen Professionsverständnisses überhaupt noch gerechtfertigt sind. Um einen Bezug zur Praxis der Sozialen Arbeit herzustellen, werden das Konzept und die theoretischen Überlegungen zum Professionsverständnis am Beispiel der psychiatrischen Sozialarbeit erläutert.
- Bewertung der „Empowerment-Förderung“ im Lichte des staatlichen Mandats der Sozialen Arbeit.
- Untersuchung der Vereinbarkeit von „Empowerment“ mit externen Bedingungen.
- Analyse der Legitimität externer Aufträge im Rahmen eines modernen Professionsverständnisses.
- Anwendung des „Empowerment“-Konzepts und des Professionsverständnisses in der psychiatrischen Sozialarbeit.
- Vertiefte Betrachtung des Begriffs „Empowerment“ im Kontext der psychiatrischen Sozialarbeit.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel liefert eine umfassende Einleitung und erläutert den aktuellen Stellenwert des „Empowerment“-Konzepts in der Sozialen Arbeit.
Das zweite Kapitel befasst sich mit dem Kernkonzept der „Empowerment-Förderung“. Es wird die Herkunft und Entstehung des Begriffs aus der „civil-rights-movement“ in den USA beleuchtet. Anschließend werden verschiedene Definitionen des Begriffs „Empowerment“ vorgestellt und diskutiert, wobei der Fokus auf die spezifische Bedeutung im Kontext der psychiatrischen Sozialarbeit liegt.
Kapitel drei beleuchtet die Sozialarbeit im Spannungsfeld ihrer Mandate: dem Mandat der Hilfe und dem Mandat der Kontrolle.
Das vierte Kapitel beschäftigt sich mit der Rolle der „Empowerment-Förderung“ im Spannungsfeld der Mandate. Es werden insbesondere die Herausforderungen und Möglichkeiten der „Empowerment-Förderung“ im Kontext des Mandats der Kontrolle und in einem modernen Professionsverständnis betrachtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen „Empowerment“, „Empowerment-Förderung“, „psychiatrische Sozialarbeit“, „Mandat der Hilfe“, „Mandat der Kontrolle“, „Professionelles Handeln“, „Selbstbestimmung“ und „Autonomie“. Der Fokus liegt auf der Analyse des „Empowerment“-Konzepts im Kontext der psychiatrischen Sozialarbeit und dessen Spannungsverhältnis zu den staatlichen Mandaten der Sozialen Arbeit.
Häufig gestellte Fragen
Was wird unter Empowerment in der psychiatrischen Sozialarbeit verstanden?
Empowerment bezeichnet die Förderung der Selbstbestimmung und Autonomie von Klienten, insbesondere im Kontext psychischer Erkrankungen.
Welcher Konflikt steht im Zentrum der Arbeit?
Die Arbeit untersucht das Spannungsfeld zwischen dem Empowerment-Konzept und dem staatlichen Mandat der Kontrolle in der Sozialen Arbeit.
Woher stammt das Konzept des Empowerment ursprünglich?
Es hat seinen Ursprung in der US-amerikanischen Bürgerrechtsbewegung ("civil-rights-movement").
Was sind die "Mandate der Hilfe und Kontrolle"?
Soziale Arbeit muss einerseits dem Klienten helfen (Hilfemandat) und andererseits gesellschaftliche Sicherheits- und Kontrollvorgaben erfüllen (Kontrollmandat).
Ist Empowerment-Förderung trotz staatlicher Auflagen möglich?
Die Arbeit evaluiert, ob sich das Konzept mit externen Bedingungen vereinbaren lässt oder durch das staatliche Mandat zu stark eingeschränkt wird.
- Arbeit zitieren
- Björn Kleinwächter (Autor:in), 2018, "Empowerment-Förderung" am Beispiel der psychiatrischen Sozialarbeit. Der Konflikt mit dem staatlichen Mandat der Sozialen Arbeit, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/918558