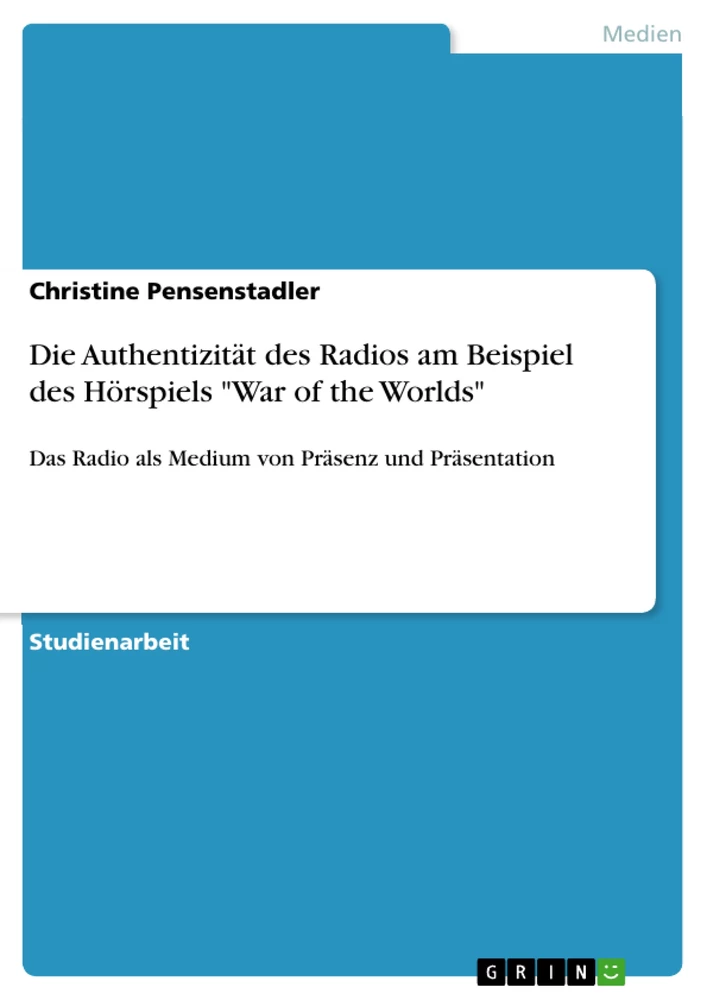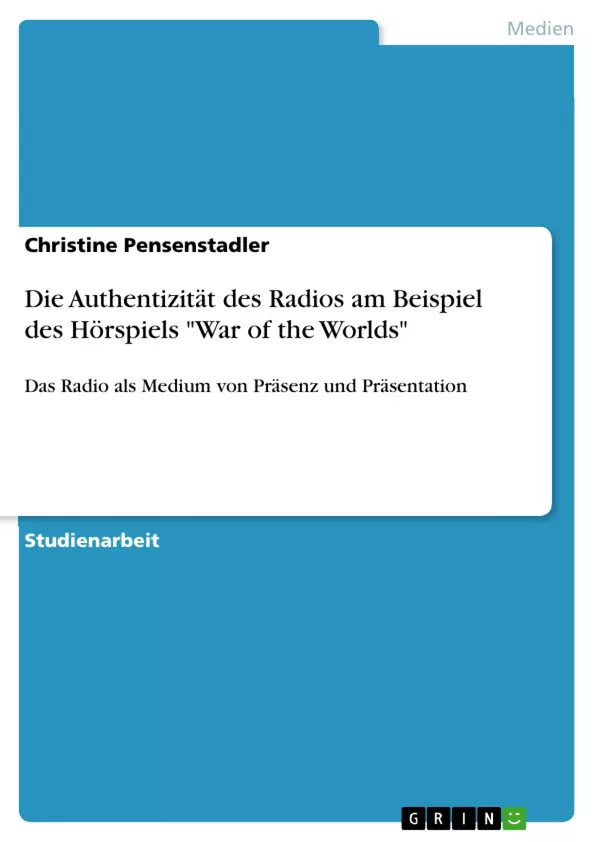Die Arbeit beschäftigt sich mit dem Radiohörspiel "War of the Worlds". Der Text hinterfragt die Authentizität der Radios mit Hilfe dieses Hörspiels. Dass es sich manchmal nicht bloß um Medien handelt, zeigte bereits das Radio Drama "War of the Worlds" von Orson Welles, das im Jahr 1938 eine Massenpanik in Amerika auslöste.
Doch wie war das eigentlich möglich? Wie konnten die Zuhörer dem glauben, was sie da im Radio hörten? Diesen Fragen soll in dieser Arbeit nachgegangen werden. Im Folgenden wird als Einstieg in das Thema zunächst die allgemeine mediale Aufrichtigkeit beleuchtet, bevor näher auf die Authentizität des Mediums Radio am Beispiel des Hörspiels "War of the Worlds" eingegangen werden soll.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Medien im Alltag und ihre Wirkung
- 2. Die mediale Aufrichtigkeit
- 3. Die Authentizität des Radios
- 3.1. Radioverhalten in Amerika
- 3.2. „War of the Worlds“ als Beispiel für die Authentizität des Radios
- 3.2.1. Die Live-Übertragung
- 3.2.2. Die auditive Wahrnehmung
- 3.2.3. Illusion
- 3.2.4. Angst
- 3.2.5. Die Auswirkungen
- 3.2.6. Zweifel über das Ausmaß der Panik
- 3.3. Einordnung in Welles' Karriere
- 4. Zwischen Science Fiction und Newscast
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Authentizität des Radios, insbesondere im Kontext des Hörspiels „War of the Worlds“ von Orson Welles. Die Arbeit beleuchtet die Wirkungsmacht der Medien und die Frage, wie es zu einer Massenpanik durch eine Radioübertragung kommen konnte. Die Analyse fokussiert auf die auditive Wahrnehmung, die Illusion von Realität und die daraus resultierenden Auswirkungen.
- Wirkung von Massenmedien auf Individuum und Gesellschaft
- Authentizität und Glaubwürdigkeit von Medien
- Die Rolle der auditiven Wahrnehmung im Radio
- Illusion und Realität in medialen Darstellungen
- Analyse der Massenpanik nach der „War of the Worlds“-Übertragung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Medien im Alltag und ihre Wirkung: Dieses Kapitel untersucht den Einfluss von Massenmedien auf den Alltag und die Gesellschaft. Es werden die Nutzungsdauer verschiedener Medien in Deutschland dargestellt und die kontroversen Meinungen über deren Wirkungspotential diskutiert. Besonders hervorgehoben wird die Möglichkeit einer Überschreitung der Medialität zu einem Realitätserlebnis und der Einfluss der Medien auf Affekte und Emotionen der Rezipienten. Der Fall „War of the Worlds“ wird als Beispiel für die überraschende Wirkungsmacht des Mediums Radio angeführt.
2. Die mediale Aufrichtigkeit: Dieses Kapitel erörtert den Begriff der Authentizität im Kontext von Medien. Es wird die Frage nach dem Verhältnis von Wirklichkeit und Fiktion in künstlich produzierten Medien wie Hollywoodfilmen diskutiert. Der Text beleuchtet die Auffassung von Wirklichkeit im Zeitalter der Massenmediale Kommunikation und die unterschiedlichen Ansätze zur Interpretation von "Authentizität". Die Arbeit von Niklas Luhmann zur Unterscheidung zwischen "realer Realität" und "konstruierter Realität" wird als wichtiges Argument eingeführt.
Schlüsselwörter
Authentizität, Radio, Massenmedien, Medienwirkung, „War of the Worlds“, Orson Welles, auditive Wahrnehmung, Illusion, Realität, Massenpanik, Medienallmacht, Medienohnmacht.
Häufig gestellte Fragen zu: Seminararbeit über die Authentizität des Radios am Beispiel von Orson Welles' "War of the Worlds"
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht die Authentizität des Radios, insbesondere im Kontext von Orson Welles' Hörspiel "War of the Worlds". Sie beleuchtet die Wirkungsmacht der Medien und die Frage, wie es zu einer Massenpanik durch eine Radioübertragung kommen konnte. Der Fokus liegt auf der auditiven Wahrnehmung, der Illusion von Realität und den daraus resultierenden Auswirkungen.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt Themen wie die Wirkung von Massenmedien auf Individuum und Gesellschaft, die Authentizität und Glaubwürdigkeit von Medien, die Rolle der auditiven Wahrnehmung im Radio, die Illusion und Realität in medialen Darstellungen sowie die Analyse der Massenpanik nach der "War of the Worlds"-Übertragung. Der Begriff der "medialen Aufrichtigkeit" und die Unterscheidung zwischen "realer Realität" und "konstruierter Realität" (Luhmann) spielen eine wichtige Rolle.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: 1. Medien im Alltag und ihre Wirkung; 2. Die mediale Aufrichtigkeit; 3. Die Authentizität des Radios (inkl. Unterkapitel zu Radioverhalten in Amerika, "War of the Worlds" mit detaillierter Analyse der Übertragung, auditiver Wahrnehmung, Illusion, Angst, Auswirkungen, und Zweifel am Ausmaß der Panik, sowie Welles' Karriere); 4. Zwischen Science Fiction und Newscast; 5. Fazit.
Wie wird die "War of the Worlds"-Übertragung analysiert?
Die Analyse der "War of the Worlds"-Übertragung konzentriert sich auf die auditive Wahrnehmung der Hörer, die durch die realistische Darstellung eine Illusion von Realität erzeugte. Die Arbeit untersucht, wie diese Illusion zu Angst und Panik führte und welche Auswirkungen die Übertragung hatte. Auch die Zweifel am tatsächlichen Ausmaß der Panik werden diskutiert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Authentizität, Radio, Massenmedien, Medienwirkung, „War of the Worlds“, Orson Welles, auditive Wahrnehmung, Illusion, Realität, Massenpanik, Medienallmacht, Medienohnmacht.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Authentizität des Radios zu untersuchen und die Wirkungsmacht von Massenmedien zu beleuchten, insbesondere anhand des Beispiels "War of the Worlds". Sie analysiert, wie eine Radioübertragung eine Massenpanik auslösen konnte und welche Faktoren dabei eine Rolle spielten.
Welche Zusammenfassung der Kapitel wird angeboten?
Es werden Zusammenfassungen aller Kapitel angeboten, welche die zentralen Inhalte und Argumente jedes Kapitels prägnant darstellen. Kapitel 1 beleuchtet den Einfluss von Massenmedien auf den Alltag, Kapitel 2 den Begriff der Authentizität in Medien, und die folgenden Kapitel befassen sich detailliert mit der "War of the Worlds"-Übertragung und deren Kontext.
- Citation du texte
- Christine Pensenstadler (Auteur), 2016, Die Authentizität des Radios am Beispiel des Hörspiels "War of the Worlds", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/918612