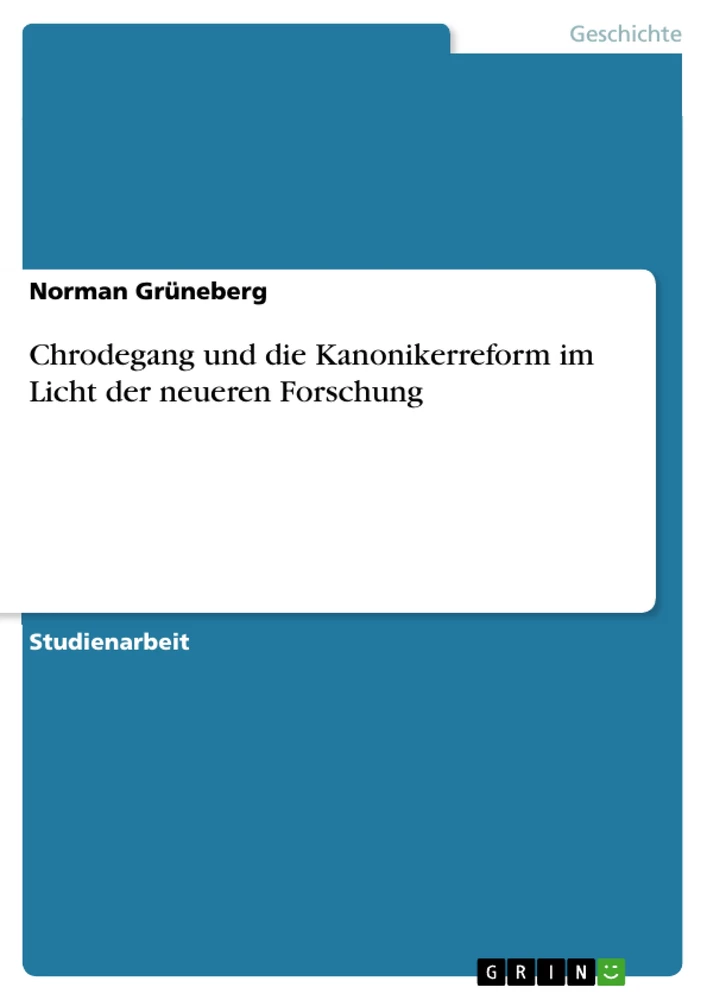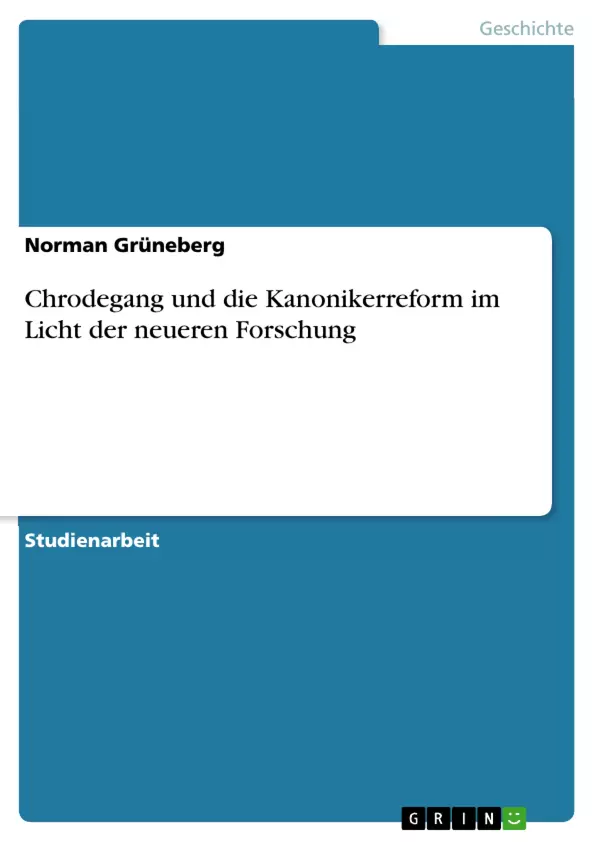Während des gesamten achten Jahrhunderts gab es im fränkischen Reich Bestrebungen zu einer Reform des Kanonikerwesens, also jener Lebensgemein-schaften von Klerikern, die nicht mönchischen Regeln verpflichtet waren. Dennoch bedurfte es einer klaren Abgrenzung der beiden klerikalen Lebensweisen – Mönchen und Kanonikern.
Am ausführlichsten haben dies Chrodegang von Metz in seiner „Regula canonicorum“ (755) und die Synodalen in Aachen 816 mit der „Institutio canonicorum Aquisgranense“ getan.
Vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Wirken Chrodegangs für die Kanonikerreform. Diese muss allerdings in den Kontext der fränkischen Kirchen-reform unter den karolingischen Herrschern gestellt werden. Der zeitliche Rahmen der Betrachtungen liegt daher zwischen der Reformsynode von Verneuill 755, in deren Verlauf Chrodegang seine Regel für den Metzer Kathedralklerus niederschrieb und der Aachener Synode von 816, die eine auf das gesamte fränkische Reich abzielende Regelung der kanonischen Lebensweise beabsichtigte.
Die Reform des Kanonikerwesens kann nicht losgelöst von der Entwicklung desselben betrachtet werden, weshalb diesem Aspekt ein eigenes Kapitel gewidmet wird.
Die Chrodegang-Regel stellt den ersten Versuch einer Reglementierung kanonischen Gemeinschafts-lebens dar. Eine Untersuchung des Inhalts mit verschiedenen Themenschwerpunkten sowie die Darstellung der Forschungsdebatte zur Chrodegang-Regel und ihrer Nachwirkung sollen im Mittelpunkt der Arbeit stehen.
Die Reglementierung des Kanonikerwesens ist mit der Aachener Regel von 816 über lange Zeit bindend gewesen. Inwieweit Chrodegangs Regel Eingang in die Aachener Regel gefunden hat, soll in einer abschließenden Betrachtung dargestellt werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. VORBEMERKUNGEN
- 2. KANONIKER IM 6. UND 7. JAHRHUNDERT
- 2.1 HERKUNFT UND BEGRIFF DES WORTES, KANONIKER'
- 2.2 LEBENSWEISE UND WIRKEN VON KANONIKERN
- 3. REFORM DES KANONIKERWESENS SEIT DEM 8. JAHRHUNDERT
- 3.1 BEWEGGRÜNDE
- 3.2 CHRODEGANG VON METZ (CA. 712-766)
- 4. DIE REGEL DES CHRODEGANG (REGULA CANONICORUM)
- 4.1 ENTSTEHUNG UND QUELLEN
- 4.2 PROBLEMATISIERUNG AUSGEWÄHLTER INHALTE DER REGULA CANONICORUM
- 4.2.1 VORBEMERKUNGEN
- 4.2.3 DIE REFORM DER KIRCHE
- 4.2.4 DAS PERSÖNLICHE EIGENTUM DER KANONIKER
- 4.2.5 DIE AUFGABEN DER KANONIKER - LITURGIE UND SEELSORGE
- 4.3 ZUM BEGRIFF MATRICULARII
- 4.4 WIRKSAMKEIT UND DAUERHAFTIGKEIT DER REGULA CANONICORUM
- 5. DAS KONZIL VON AACHEN 816 UND DIE INSTITUTIO CANONICORUM AQUISGRANENSE
- 5.1 HINTERGRÜNDE DES KONZILS VON AACHEN
- 5.2 DIE INSTITUTIO CANONICORUM AQUISGRANENSE
- 6. DER EINFLUSS DER REGULA CANONICORUM AUF DIE INSTITUTIO CANONICORUM AQUISGRANENSE
- 7. ZUSAMMENFASSUNG
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die Reform des Kanonikerwesens im Frankenreich, insbesondere die Rolle von Chrodegang von Metz und seine „Regula canonicorum“. Sie beleuchtet den historischen Kontext der fränkischen Kirchenreform unter den karolingischen Herrschern und setzt die Reformbemühungen im Rahmen der Unterscheidung zwischen Mönchen und Kanonikern. Die Arbeit fokussiert sich auf die Entstehung und den Inhalt der Chrodegang-Regel, ihre Nachwirkung und ihren Einfluss auf die „Institutio canonicorum Aquisgranense“ des Konzils von Aachen 816.
- Die Entwicklung des Kanonikerwesens im 6. und 7. Jahrhundert
- Die Reform des Kanonikerwesens im 8. Jahrhundert
- Der Inhalt und die Bedeutung der „Regula canonicorum“ von Chrodegang
- Die Auswirkungen der Chrodegang-Regel auf die spätere Kanonikerreform
- Der Einfluss der Chrodegang-Regel auf die „Institutio canonicorum Aquisgranense“
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 bietet eine Einführung in das Thema und erläutert den historischen Kontext der Kanonikerreform im fränkischen Reich. Kapitel 2 analysiert die Herkunft und die Lebensweise von Kanonikern im 6. und 7. Jahrhundert und zeigt die Entwicklung der Unterscheidung zwischen Mönchen und Kanonikern. Kapitel 3 beleuchtet die Beweggründe für die Kanonikerreform im 8. Jahrhundert und stellt Chrodegang von Metz als zentralen Akteur vor. Kapitel 4 behandelt die „Regula canonicorum“ von Chrodegang, ihre Entstehung, ihre Inhalte und ihre Problematik. Kapitel 5 diskutiert das Konzil von Aachen 816 und die „Institutio canonicorum Aquisgranense“. Kapitel 6 untersucht den Einfluss der Chrodegang-Regel auf die „Institutio canonicorum Aquisgranense“. Kapitel 7 fasst die zentralen Ergebnisse der Arbeit zusammen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Kanonikerwesen, Chrodegang von Metz, „Regula canonicorum“, fränkische Kirchenreform, karolingische Herrschaft, „Institutio canonicorum Aquisgranense“, Konzil von Aachen, Mönchstum, Klerikerstand, Liturgie, Seelsorge, Gemeinschaftsleben.
Häufig gestellte Fragen
Wer war Chrodegang von Metz?
Chrodegang (ca. 712–766) war Bischof von Metz und ein zentraler Akteur der fränkischen Kirchenreform unter den Karolingern.
Was ist die „Regula canonicorum“?
Es handelt sich um eine von Chrodegang um 755 verfasste Regel, die das Gemeinschaftsleben von Klerikern (Kanonikern) organisierte und von mönchischen Regeln abgrenzte.
Wie unterschieden sich Kanoniker von Mönchen?
Im Gegensatz zu Mönchen durften Kanoniker unter bestimmten Bedingungen persönlichen Besitz behalten, waren aber dennoch zu einem gemeinsamen Leben und liturgischen Dienst verpflichtet.
Welchen Einfluss hatte die Chrodegang-Regel auf spätere Reformen?
Sie diente als wesentliche Vorlage für die „Institutio canonicorum Aquisgranense“, die auf der Aachener Synode 816 für das gesamte Frankenreich verbindlich wurde.
Was bedeutet der Begriff „Matricularii“?
Der Begriff bezieht sich auf Personen, die in die Matrikel (Verzeichnis) einer Kirche eingetragen waren und aus deren Mitteln versorgt wurden, oft im Zusammenhang mit sozialen Aufgaben.
- Arbeit zitieren
- Norman Grüneberg (Autor:in), 2008, Chrodegang und die Kanonikerreform im Licht der neueren Forschung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/91931