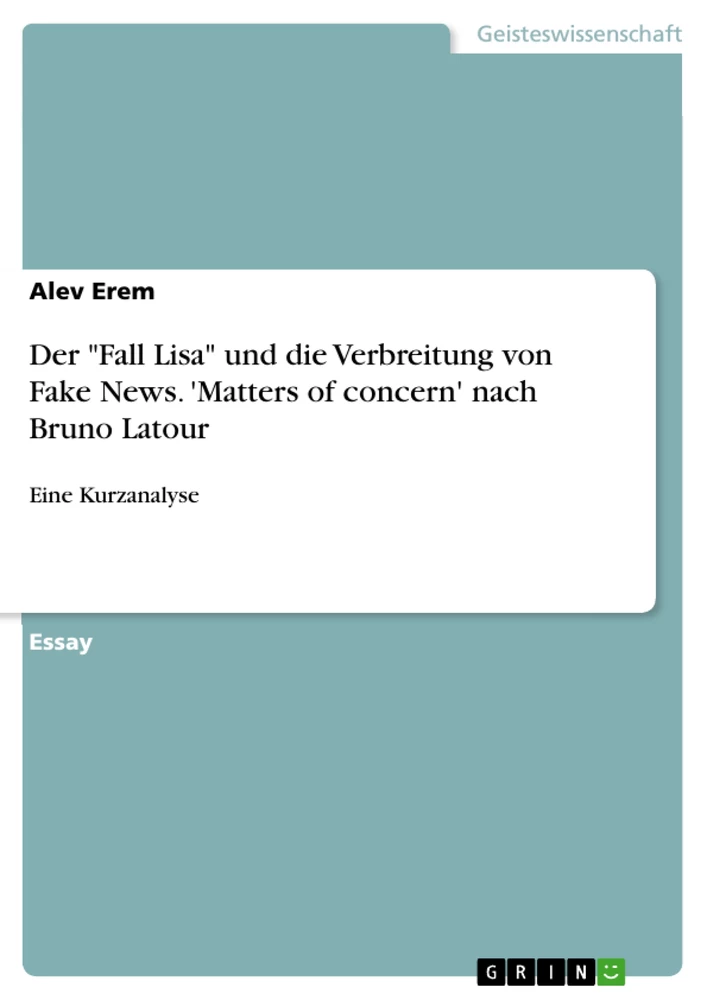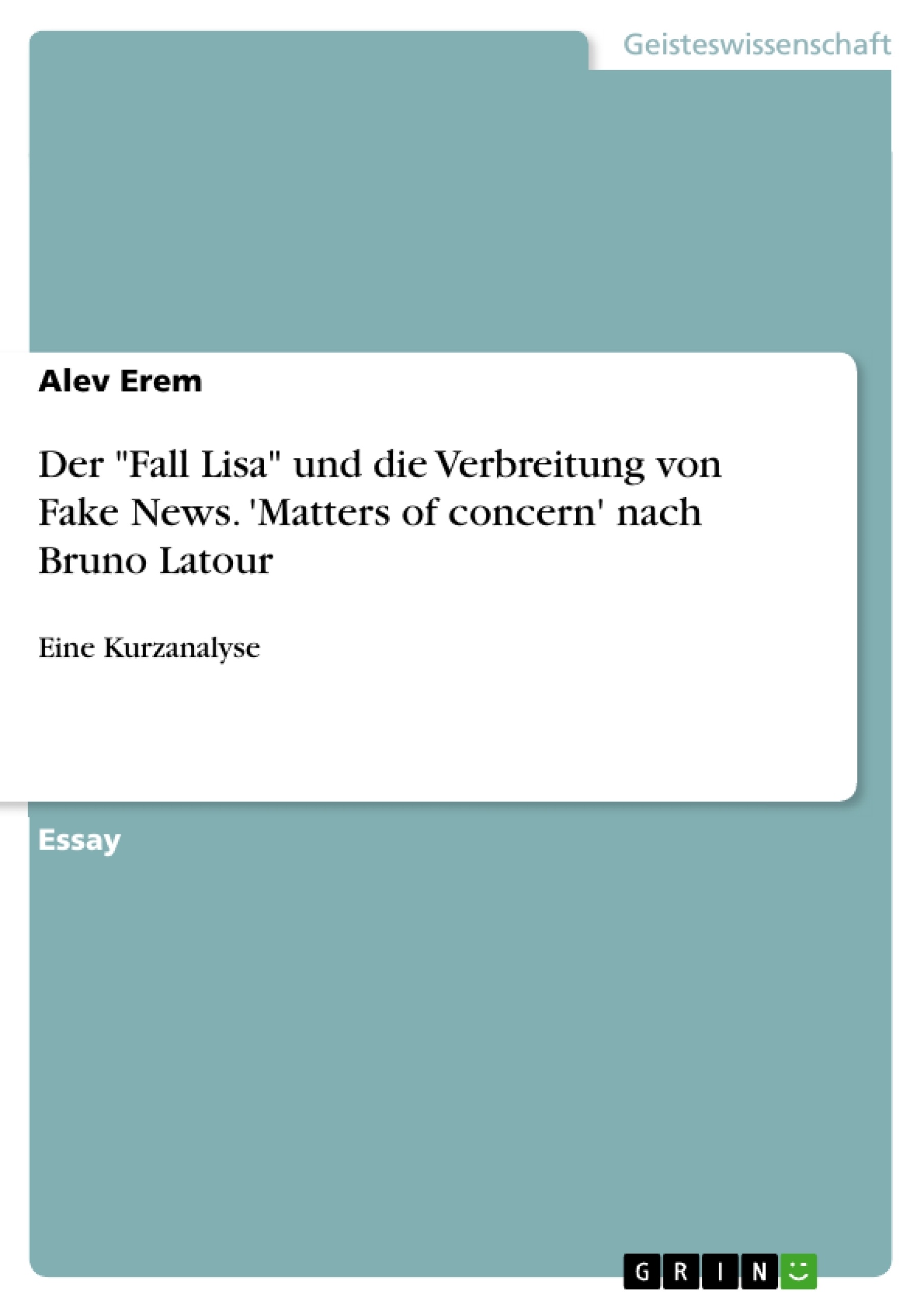In diesem Essay wird der theoretische Ansatz des "matters of concern" nach Latour skizziert und findet am Beispiel des Falls Lisa, welches 2017 viral ging.
Im Internet verbreiten sich Informationen in einem rasanten Tempo. Wen oder was können wir überhaupt noch glauben? Wer sagt die Wahrheit, wer lügt? Oder ist es wie Latour sagt, "that there is no sure ground anywhere"? Doch wenn es kein Fundament einer Wahrheit gibt, worauf vertrauen wir dann? Wie schützen wir uns vor Lügen und warum ist es so wichtig, die Wahrheit zu erkennen?
Die Beurteilung von wahr und falsch sollte über die kritische Beurteilung der jeweiligen Quellen erfolgen. Damit wird die Kritik zum methodischen Instrument des individuellen Beurteilungsvermögens und der Entscheidung über Wahrheit und Lüge.
In diesem Kontext stellt sich die Frage, ob die Kritik als Instrument zur Wahrheitsfindung taugt. Wenn es doch so einfach ist, warum wird dann offensichtlichen Falschmeldungen derart viel Aufmerksamkeit geschenkt?
Der „Fall Lisa“ demonstriert genau diesen Umstand. Die Lüge um die vermeintliche Vergewaltigung der 13-jährigen Deutschlandrussin aus Berlin-Marzahn, wird im russischen Staatsfernsehen einhergehend mit Staatsvertuschung und -versagen im Hin-blick auf die Flüchtlingskrise thematisiert.
Inhaltsverzeichnis
- Fake News: Durch Kritik zur Wahrheit?
- Die Checkliste als pädagogisches Mittel
- Kritik als methodisches Instrument
- Der „Fall Lisa“
- Latour's Kritik an der Kritik
- Kritik an der spezifischen Kritikform
- Soziale Erklärungen und Objekte
- Der „Fall Lisa“ im Kontext der russischen Medien
- Kritik an der Kritik – „Matters of Concern“
- Aktanten-Netzwerk-Theorie
- Das Ausgangsproblem der science studies
- Die neue Soziologie und die Aktanten-Netzwerk-Theorie (ANT)
- Das verallgemeinerte Symmetrieprinzip
- Handlungen und die ANT
- Beweise als Performanzen
- Die ANT und die Übersetzungsprozesse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Essay befasst sich mit der Frage, ob Kritik im digitalen Zeitalter, wo Fake News und Fehlinformationen weit verbreitet sind, als Instrument zur Wahrheitsfindung taugt. Der Autor analysiert die Rolle von Kritik im Kontext von „Fake News“ und beleuchtet die Grenzen der Kritik im Hinblick auf die Konstruktion sozialer Wirklichkeiten.
- Die Kritik als Methode zur Wahrheitsfindung im digitalen Zeitalter
- Die Grenzen der Kritik im Kontext von „Fake News“
- Die Konstruktion sozialer Wirklichkeiten durch Kritik
- Die Aktanten-Netzwerk-Theorie als Alternative zur Kritik
- Der „Fall Lisa“ als Fallbeispiel für die Problematik der Kritik
Zusammenfassung der Kapitel
- Der Essay beginnt mit der Einführung des Themas „Fake News“ und der Bedeutung von Kritik im Kontext der Verbreitung von Fehlinformationen.
- Es wird die „Checkliste“ der Bundeszentrale für politische Bildung als pädagogisches Mittel zur Beurteilung von Online-Quellen vorgestellt, die den kritischen Umgang mit Quellen schulen soll.
- Der Autor diskutiert, ob die Kritik als Instrument zur Wahrheitsfindung taugt und erläutert dies am Beispiel des „Falls Lisa“, der im russischen Staatsfernsehen als Beweis für staatliche Vertuschung und Versagen dargestellt wird.
- Der Autor stellt Latours Kritik an der Kritik vor, die sich auf die spezifische Form der Kritik bezieht, die sich auf unbestreitbare Tatsachen (matters of fact) stützt.
- Der Autor beleuchtet die Grenzen von Kritik im Hinblick auf die Konstruktion sozialer Wirklichkeiten, die durch das Ersetzen von Objekten durch soziale Entitäten entstehen.
- Es wird die Aktanten-Netzwerk-Theorie (ANT) als Alternative zur Kritik vorgestellt, die das dualistische Klassifizierungsproblem – Gesellschaft und Natur – auflöst und eine neue Soziologie einführt, die Handlungen nicht auf die Intentionalität von menschlichen oder nicht-menschlichen Entitäten reduziert.
- Der Essay betrachtet Beweise als Performanzen, die aus der Verbindung heterogener Entitäten hervorgehen, die ihre Fähigkeiten und Funktionen wechselseitig übertragen.
- Die ANT versucht, eine internalisierte Erklärung alleine durch empirische Tatsachen zu beschreiben und nicht zu analysieren, indem der Beobachter den Spuren des Sozialen folgt, die während der Übersetzungsprozesse entstehen.
Schlüsselwörter
Der Essay konzentriert sich auf die Themen „Fake News“, „Kritik“, „Wahrheit“, „Soziale Konstruktion von Wirklichkeit“, „Aktanten-Netzwerk-Theorie“, „Übersetzungsprozesse“, „Matters of Concern“, „Der „Fall Lisa““, „Russisches Staatsfernsehen“ und „Latours Kritik an der Kritik“. Die Untersuchung beleuchtet die Herausforderungen im Umgang mit Fehlinformationen im digitalen Zeitalter und die Grenzen der Kritik als Instrument der Wahrheitsfindung.
Häufig gestellte Fragen
Was war der "Fall Lisa" und warum ist er ein Beispiel für Fake News?
Der Fall betraf die erfundene Vergewaltigung einer 13-jährigen Deutschrussin im Jahr 2016, die vom russischen Staatsfernsehen instrumentalisiert wurde, um Unruhe zu stiften und Misstrauen gegen den deutschen Staat zu schüren.
Was versteht Bruno Latour unter "Matters of Concern"?
Im Gegensatz zu "Matters of Fact" (unbestreitbare Tatsachen) sind "Matters of Concern" Dinge, die uns angehen und die durch ein komplexes Netzwerk von Akteuren und Interessen konstruiert werden.
Warum reicht Kritik allein nicht aus, um Fake News zu bekämpfen?
Latour argumentiert, dass die radikale Kritik das Vertrauen in Fakten untergraben hat. Wenn alles nur als "soziale Konstruktion" entlarvt wird, verliert die Wahrheit ihr Fundament.
Was ist die Aktanten-Netzwerk-Theorie (ANT)?
Die ANT betrachtet sowohl Menschen als auch nicht-menschliche Dinge (Technik, Dokumente) als Akteure, die in Netzwerken zusammenwirken, um Wirklichkeit zu erzeugen.
Wie können wir uns im digitalen Zeitalter vor Lügen schützen?
Die Arbeit schlägt vor, über die bloße Quellenkritik hinaus die Netzwerke und Prozesse zu verstehen, durch die Informationen verbreitet und als "wahr" performt werden.
- Arbeit zitieren
- Alev Erem (Autor:in), 2017, Der "Fall Lisa" und die Verbreitung von Fake News. 'Matters of concern' nach Bruno Latour, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/919607