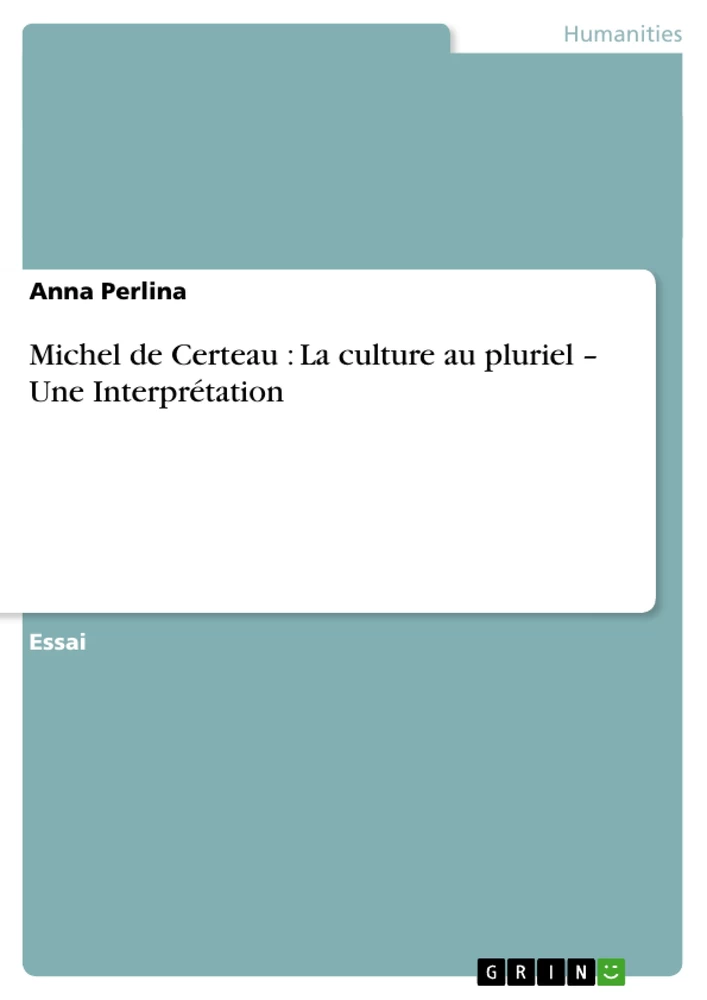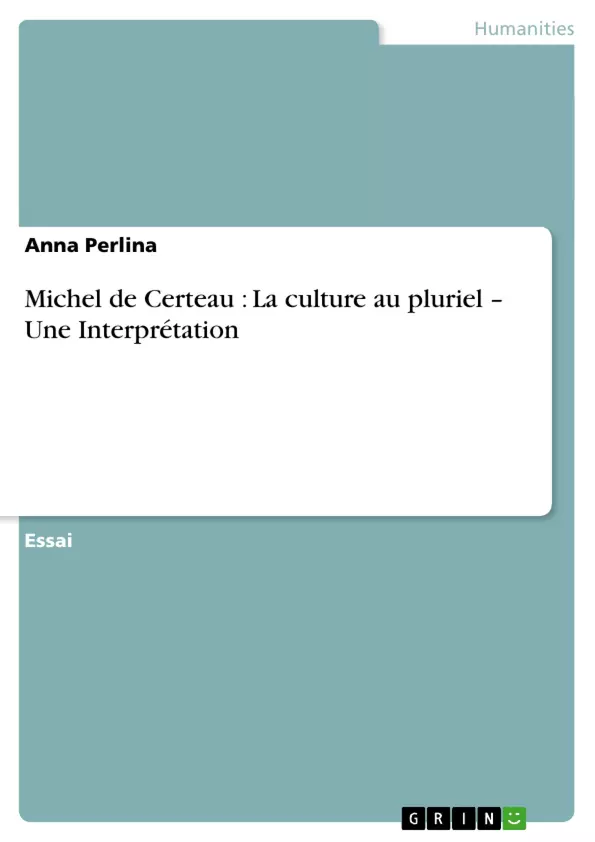La culture au pluriel est une réflexion sur la vie sociale et l'insertion de la culture dans cette vie, au centre se trouve la question de définition de la culture. Le livre présente en même temps un entrecroisement des disciplines et des méthodes, associant à l’histoire (l’auteur traite des divers cas historiques et politiques) et à l’anthropologie, les concepts et les procédures de la philosophie, de la politologie (des travaux de Marcuse, de Bour-dieu, d’Husserl et d’autres servent en tant que base), la linguistique (théories de la communica-tion) et la psychanalyse (l’auteur part de la psychanalyse freudienne).
Inhaltsverzeichnis
- Introduction: Essaie d'une définition de la culture
- Différents aspects de la culture
- Une société de mass média
- La revalorisation
- Conclusion: << La culture au pluriel » - qu'est-ce que cela veut dire ?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Michel de Certeaus "La culture au pluriel" untersucht die Rolle der Kultur in der modernen Gesellschaft und hinterfragt traditionelle Definitionen. Das Buch analysiert die Veränderung des Kulturverständnisses im 19. Jahrhundert und zeichnet die Entwicklung einer vielfältigen und dynamischen Kulturlandschaft nach, die durch den Einfluss von Massenmedien, sozialer und politischer Wandel geprägt ist.
- Die Definition von Kultur und ihre Entwicklung im Laufe der Geschichte
- Die Auswirkungen der Massenmedien auf die Kultur
- Die Bedeutung von Bildung und ihrer Rolle in der Gesellschaft
- Die Entstehung einer "Kultur der Masse" und ihre Folgen
- Der Wandel des Kulturverständnisses im Zusammenhang mit sozialen und politischen Prozessen
Zusammenfassung der Kapitel
Im ersten Kapitel stellt de Certeau die Frage nach einer Definition von Kultur und zeigt, wie diese im 19. Jahrhundert geprägt wurde. Er untersucht verschiedene Aspekte der Kultur, wie z. B. den Einfluss von Medien, die Bedeutung von Bildung und die Herausforderungen einer "Kultur der Masse".
Kapitel 2 beleuchtet die Rolle der Autorität und ihre Bedeutung in der Gesellschaft. De Certeau kritisiert den "Terrorismus einer Elite" und analysiert die Folgen des Vertrauensverlustes in etablierte Institutionen.
In Kapitel 3 geht de Certeau auf den Unterschied zwischen "volkstümlicher Kultur" und "gebildeter Kultur" ein. Er zeigt auf, wie diese Unterscheidung die Wahrnehmung von Kultur beeinflusst und argumentiert für die Anerkennung der "gewöhnlichen" Kultur des Alltags.
Kapitel 4 konzentriert sich auf den linguistischen Aspekt der kulturellen Unterdrückung. De Certeau argumentiert, dass ein durch die Machtverhältnisse geprägter Sprachgebrauch die freie Meinungsäußerung behindern kann.
Kapitel 5 beschäftigt sich mit der "Kultur der Masse" im Kontext der massiven Expansion von Bildungseinrichtungen. De Certeau untersucht die Herausforderungen, die sich aus der Einbindung der breiten Masse in den Bildungsprozess ergeben.
Im sechsten Kapitel beschreibt de Certeau die "Multilokation der Kultur", die sich durch die zunehmende Bedeutung von Bildungseinrichtungen außerhalb des traditionellen Schulsystems auszeichnet.
Schlüsselwörter
Kultur, Massenmedien, Bildung, Gesellschaft, Autorität, Elite, Volkstümliche Kultur, Gebildete Kultur, Sprache, Unterdrückung, Kultur der Masse, Multilokation.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Kernaussage von Michel de Certeaus „La culture au pluriel“?
Das Buch hinterfragt die traditionelle, elitäre Definition von Kultur und plädiert für ein Verständnis von Kultur als vielfältige, lebendige Praxis des Alltags („Kultur im Plural“), die durch soziale und politische Prozesse geprägt ist.
Welchen Einfluss haben Massenmedien laut de Certeau auf die Kultur?
De Certeau analysiert, wie Massenmedien zur Entstehung einer „Kultur der Masse“ beitragen, die einerseits manipulativ wirken kann, andererseits aber auch neue Räume für kulturelle Aneignung bietet.
Wie unterscheidet de Certeau zwischen „volkstümlicher“ und „gebildeter“ Kultur?
Er kritisiert die Abwertung der Alltagskultur gegenüber der elitären Hochkultur. Er argumentiert, dass auch die gewöhnlichen Handlungen der Menschen kulturelle Akte sind, die Anerkennung verdienen.
Was bedeutet der Begriff „Multilokation der Kultur“?
Dies beschreibt die Dezentralisierung von Bildung und Kultur. Kulturelle Bildung findet nicht mehr nur in staatlichen Schulen statt, sondern an vielen verschiedenen Orten der Gesellschaft, was die traditionelle Autorität schwächt.
Warum spielt Sprache eine Rolle bei kultureller Unterdrückung?
De Certeau zeigt auf, dass Machtverhältnisse sich in der Sprache widerspiegeln. Ein durch Eliten geprägter Sprachgebrauch kann die Ausdrucksmöglichkeiten anderer sozialer Gruppen einschränken und sie kulturell marginalisieren.
- Arbeit zitieren
- Anna Perlina (Autor:in), 2006, Michel de Certeau : La culture au pluriel – Une Interprétation, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/91979