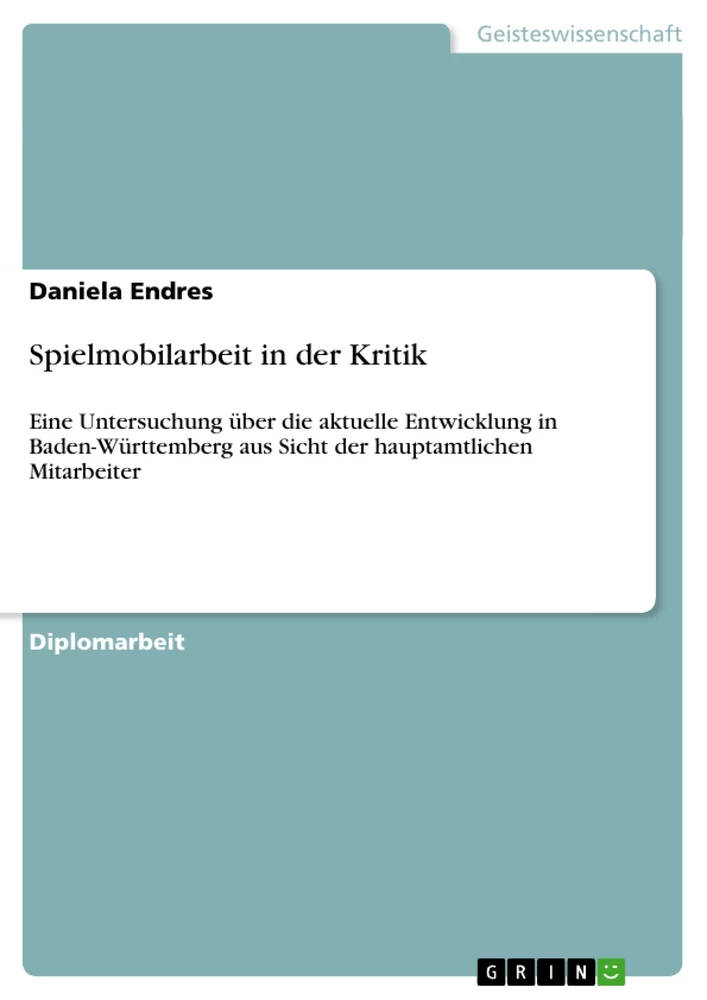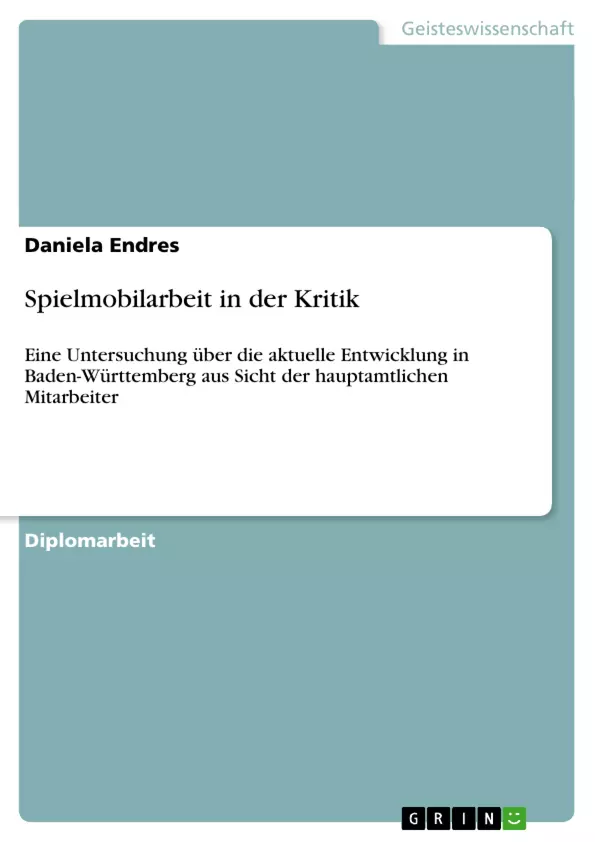«Ludus Mobilis – Quo Vadis». Unter diesem Titel veröffentlichte die Fachzeitschrift
„Spielmobilszene“ im Oktober 1993 einen Beitrag von Wolfgang Zacharias, in dem kritische Anmerkungen zur Spielmobilarbeit formuliert wurden. In diesem Artikel beschreibt der Autor Spielmobile „als eher langweilig, ein wenig abgeschlafft [und] in die Jahre gekommen [und sieht somit die] spiel- und kulturpädagogische Entwicklung als eher rückläufig an.“1 Seiner Meinung nach wird das Thema „Spiel“ von den Spielmobilen zunehmend vernachlässigt. Damals nahmen 19 hauptamtliche Mitarbeiter2 von Spielmobilen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz Stellung zu Zacharias Thesen und setzten damit eine wichtige Diskussion in Gang. Mehr als zehn Jahre später stellt sich nun die Frage: Wie sieht die aktuelle Entwicklung aus? Wofür steht das Spielmobil? Ist es Vorreiter in Sachen Spiel und Lobby für Kinderrechte oder doch nur Animationsspektakel und Lückenfüller für kommerzielle Festivitäten? Sind die zahlreichen Kritikpunkte am Ende berechtigt und es gibt gar keine zeitadäquate Innovation und Weiterentwicklung in der Spielmobilszene? Diese Fragen sollen in dieser Arbeit kritisch beleuchtet werden.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- 1 Einleitung
- 2 Entwicklung der Fragestellung
- 2.1 Eingrenzung des Themas
- 2.2 Relevanz für die Soziale Arbeit
- 2.3 Begriffsklärungen
- 2.3.1 „Spiel“
- 2.3.2 „Spielpädagogik“
- 2.3.3 „Spielmobil“
- 3 Spielmobilarbeit in der Kritik
- 3.1 Die Bedeutung des kindlichen Spiels
- 3.1.1 Der phänomenologische Ansatz nach Scheuerl
- 3.1.2 Die kognitive Spieltheorie nach Piaget
- 3.1.3 Motivationspsychologische Spieltheorie (Heckhausen)
- 3.1.4 Merkmale und Dimensionen
- 3.1.5 Ausblick
- 3.2 Die Entstehung der Spielmobilszene
- 3.2.1 Geschichte
- 3.2.2 Rechtliche Rahmenbedingungen
- 3.2.3 Der gesellschaftliche Auftrag
- 3.2.4 Ausblick
- 3.3 Spielmobile im Kontext gesellschaftlicher Veränderungen
- 3.3.1 Aktionsräume heute
- 3.3.2 „Errungenschaften“ für das moderne Kind
- 3.3.3 Spielmobilarbeit zwischen Trend und Tradition
- 3.3.4 Zusammenfassung
- 3.4 „Spielehaus & Spielbus Friedrichshafen“
- 3.4.1 Vorstellung der Einrichtung
- 3.4.2 Vorstellung der konzeptionellen Ziele
- 3.4.3 Kritische Überlegungen
- 3.4.4 Fazit
- 3.5 Zusammenfassung
- 3.1 Die Bedeutung des kindlichen Spiels
- 4 Erstellung der Hypothesen
- 4.1 These 1
- 4.2 These 2
- 4.3 These 3
- 4.4 These 4
- 4.5 Ausblick
- 5 Empirische Untersuchung
- 5.1 Auswahl der Untersuchungsgruppe
- 5.2 Auswahl des Erhebungsinstruments
- 5.3 Konstruktion des Erhebungsinstruments
- 5.4 Vortest
- 5.5 Durchführung der Hauptuntersuchung
- 6 Auswertung und Interpretation
- 6.1 These 1
- 6.2 These 2
- 6.3 These 3
- 6.4 These 4
- 6.5 Zusätzliche Interviewergebnisse
- 6.6 Zusammenfassung
- 7 Folgerungen
- 7.1 Gesellschaftliche Folgen
- 7.2 Folgen für die Spielmobilarbeit
- 8 Schlusswort
- 9 Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit befasst sich mit der Spielmobilarbeit in Baden-Württemberg und untersucht die aktuelle Entwicklung aus Sicht der hauptamtlichen Mitarbeiter. Sie analysiert die Kritik an der Spielmobilarbeit, die Bedeutung des Spiels für die kindliche Entwicklung und den gesellschaftlichen Wandel, der die Arbeit der Spielmobile beeinflusst.
- Die Bedeutung des Spiels für die kindliche Entwicklung und die verschiedenen Spieltheorien
- Die Entstehung der Spielmobilszene, ihre Geschichte und rechtliche Rahmenbedingungen
- Die Rolle der Spielmobile im Kontext gesellschaftlicher Veränderungen
- Die Kritik an der Spielmobilarbeit und die Herausforderungen, die sich für die Einrichtungen stellen
- Die empirische Untersuchung der aktuellen Entwicklung der Spielmobilarbeit in Baden-Württemberg
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Thematik der Spielmobilarbeit einführt und die Relevanz des Themas für die Soziale Arbeit beleuchtet. Anschließend werden die wichtigsten Begriffe definiert und die Entwicklung der Fragestellung dargestellt. Das dritte Kapitel widmet sich der Kritik an der Spielmobilarbeit und beleuchtet die Bedeutung des kindlichen Spiels aus verschiedenen Perspektiven. Es wird die Entstehung der Spielmobilszene sowie ihre Geschichte und rechtlichen Rahmenbedingungen betrachtet. Weiterhin werden die Herausforderungen der Spielmobilarbeit im Kontext gesellschaftlicher Veränderungen und die Entwicklungen im Aktionsraum der Spielmobile analysiert. Das Kapitel beleuchtet das Beispiel des „Spielehaus & Spielbus Friedrichshafen“ und analysiert die konzeptionellen Ziele und die kritischen Überlegungen, die mit dieser Einrichtung verbunden sind.
Im vierten Kapitel werden die Hypothesen der Arbeit aufgestellt, die im weiteren Verlauf empirisch untersucht werden. Das fünfte Kapitel befasst sich mit der empirischen Untersuchung, wobei die Auswahl der Untersuchungsgruppe, des Erhebungsinstruments und die Durchführung der Untersuchung im Detail dargestellt werden. Das sechste Kapitel analysiert und interpretiert die Ergebnisse der empirischen Untersuchung und überprüft die zuvor aufgestellten Hypothesen. Es werden außerdem zusätzliche Interviewergebnisse beleuchtet.
Das siebte Kapitel fasst die wichtigsten Ergebnisse der Untersuchung zusammen und zieht Schlussfolgerungen für die gesellschaftlichen Folgen und für die Spielmobilarbeit. Die Arbeit endet mit einem Schlusswort, das die gewonnenen Erkenntnisse zusammenfasst und die Bedeutung der Spielmobilarbeit für die Gesellschaft hervorhebt.
Schlüsselwörter
Spielmobilarbeit, Spielpädagogik, kindliche Entwicklung, Spieltheorien, gesellschaftliche Veränderungen, Aktionsräume, Kritik, empirische Untersuchung, Baden-Württemberg, Soziale Arbeit, Friedrichshafen.
- Quote paper
- Daniela Endres (Author), 2006, Spielmobilarbeit in der Kritik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/92004