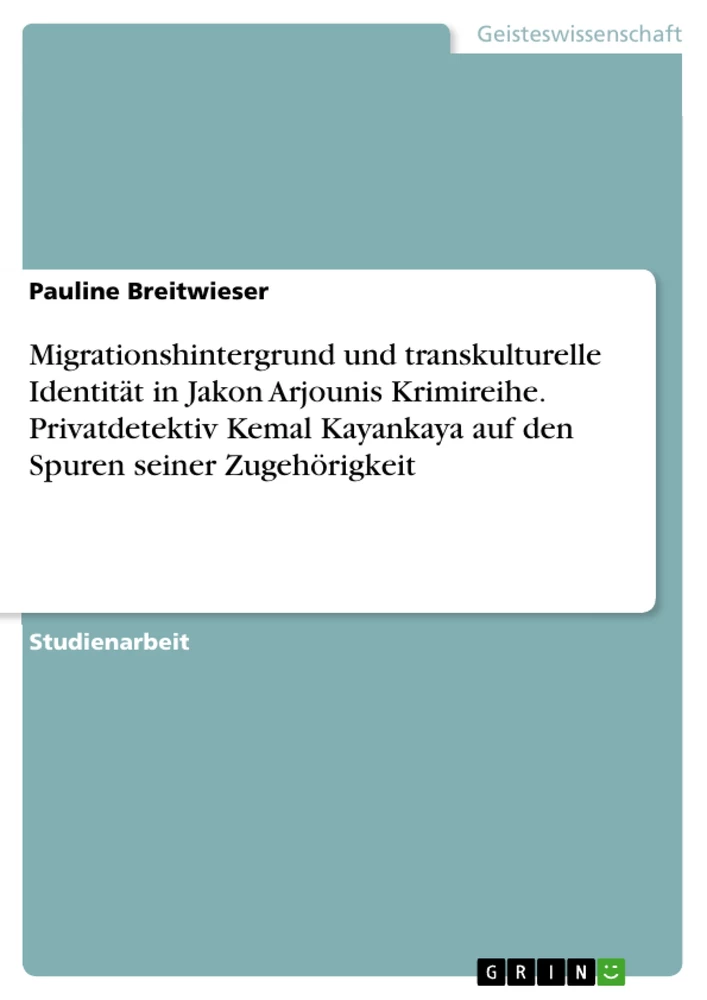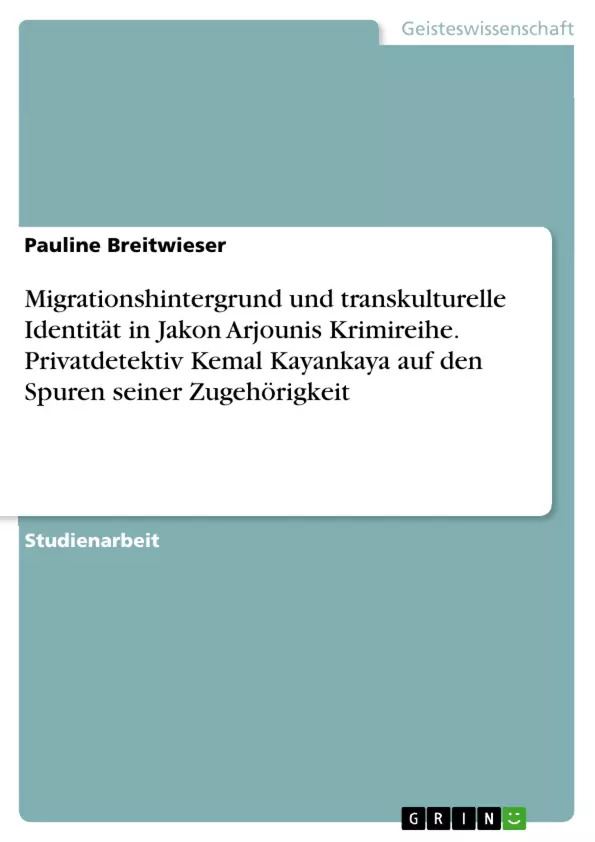Diese Arbeit behandelt Identitätsbildung und Zugehörigkeitszuschreibung bei Personen mit Migrationshintergrund in einem ominösen Kontext wie dem Frankfurter Bahnhofsviertel. Hierfür werden der erste und letzte Band der Krimi-Reihe von Jakob Arjouni und dem Privatdetektiv Kemal Kayankaya betrachtet.
Es soll zunächst die historische Perspektive der Migration in Deutschland beziehungsweise Frankfurt nach 1945 beleuchtet werden. Anschließend folgt eine kritische Charakterisierung des Stadtteils Bahnhofsviertel, um die Arbeit mit dem Primärtext zu untermauern.
Die Gattung des Kriminalromans stellt die Voraussetzung dar und gibt dem Protagonisten dabei seine primären Persönlichkeitseigenschaften. Für die Darstellung in der Entwicklung Kemal Kayankayas und seine Zugehörigkeit beziehungsweise Identität wurden der erste und der letzte Band der Reihe gewählt. Anhand von Textbeispielen soll die Problematik des Einzelgängers, aufgrund seines Migrationshintergrundes charakterisiert werden. Für den Gesamtkontext liegt eine kurze inhaltliche Zusammenfassung der ganzen Reihe vor.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Historischer Hintergrund
- Migration in Deutschland
- Brennpunkt Frankfurter Bahnhofsviertel
- Populärkulturelle Darstellung: Gattung der Kriminalliteratur
- Tradition der Hardboiled-School und Identität
- Autor Jakob Arjouni und Protagonist der Kayankaya-Reihe Kemal Kayankaya
- Analyse und Darstellung der Migrationsthematik
- 'Happy Birthday, Türke!' (1985)
- 'Bruder Kemal' (2012)
- Veränderung der Darstellung von Migration und Diversität in den Romanen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Darstellung von Identitätsbildung und Zugehörigkeitszuschreibung bei Personen mit Migrationshintergrund im Kontext des Frankfurter Bahnhofsviertels anhand der Krimi-Reihe von Jakob Arjouni um den Privatdetektiv Kemal Kayankaya. Zunächst wird der historische Hintergrund der Migration nach Deutschland und speziell nach Frankfurt beleuchtet. Anschließend wird das Bahnhofsviertel kritisch charakterisiert. Die Analyse konzentriert sich auf die Darstellung der Thematik in den Romanen "Happy Birthday, Türke!" und "Bruder Kemal", um die Entwicklung von Kemal Kayankayas Identität und Zugehörigkeit zu analysieren.
- Identitätsbildung von Migranten in Deutschland
- Darstellung von Migration und Zugehörigkeit in der Populärkultur
- Das Frankfurter Bahnhofsviertel als literarischer Schauplatz
- Charakterisierung von Kemal Kayankaya als Privatdetektiv mit Migrationshintergrund
- Vergleich der Darstellung von Migration in verschiedenen Romanen der Reihe
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt den Fokus der Arbeit dar: die Analyse der Darstellung von Identitätsbildung und Zugehörigkeit bei Personen mit Migrationshintergrund im Frankfurter Bahnhofsviertel anhand der Krimi-Reihe von Jakob Arjouni. Sie thematisiert die öffentliche Wahrnehmung des Bahnhofsviertels als "Hauptstadt des Verbrechens" und den damit verbundenen Ängsten und Vorurteilen. Der Bezug zu populärkulturellen Darstellungen wie Haftbefehls "069" wird hergestellt, um den Kontext der Arbeit zu verdeutlichen. Die Arbeit konzentriert sich auf die Analyse der Romane "Happy Birthday, Türke!" und "Bruder Kemal", um die Entwicklung des Protagonisten Kemal Kayankaya zu verfolgen.
Historischer Hintergrund: Dieses Kapitel beleuchtet die Geschichte der Migration nach Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg. Es beschreibt die verschiedenen Phasen der Migration, beginnend mit der Zeit nach dem Krieg und dem geringen Rückreisewillen von Überlebenden der Konzentrationslager, über die Gastarbeiterzeit bis hin zu den Migrationswellen der späteren Jahrzehnte. Der Abschnitt beschreibt die Komplexität des Begriffs „Migrationshintergrund“ und die Schwierigkeiten bei seiner Definition. Der Fokus liegt auf der Entwicklung der Migrationsgesellschaft und ihrer vielfältigen Ursachen. Der Zusammenhang mit der Kriminalität wird angedeutet aber nicht detailliert ausgeführt.
Populärkulturelle Darstellung: Gattung der Kriminalliteratur: Dieses Kapitel analysiert die Gattung des Kriminalromans und insbesondere der "Hardboiled-School" als Rahmen für die Darstellung der Migrationstematik. Es führt den Autor Jakob Arjouni und seinen Protagonisten Kemal Kayankaya ein und erläutert die Bedeutung des Genres für die Charakterisierung des Protagonisten und seiner Identität. Das Kapitel legt die Grundlage für die folgende detaillierte Analyse der ausgewählten Romane.
Analyse und Darstellung der Migrationsthematik: Dieses Kapitel präsentiert eine detaillierte Analyse der Romane "Happy Birthday, Türke!" und "Bruder Kemal", wobei die jeweiligen Darstellungen von Migration und Identität im Fokus stehen. Es werden Textbeispiele herangezogen, um die Problematik des Einzelnen aufgrund seines Migrationshintergrundes zu charakterisieren. Die Kapitel untersuchen, wie Arjouni die Herausforderungen und Erfahrungen von Kemal Kayankaya als Migrant in einer komplexen und oft feindseligen Umgebung darstellt.
Veränderung der Darstellung von Migration und Diversität in den Romanen: Dieses Kapitel beschreibt die Entwicklung der Darstellung von Migration und Diversität in den Romanen der Kayankaya-Reihe im Laufe der Zeit. Es untersucht, ob und wie sich Arjouni's Sichtweise und die Darstellung seines Protagonisten im Umgang mit seiner Identität und Zugehörigkeit verändert haben. Der Fokus liegt auf dem Vergleich zwischen den unterschiedlichen Romanen und der Entwicklung der Charaktere.
Schlüsselwörter
Migrationshintergrund, Identitätsbildung, Zugehörigkeit, Frankfurter Bahnhofsviertel, Populärkultur, Kriminalliteratur, Jakob Arjouni, Kemal Kayankaya, Hardboiled, Deutschland, Integration, Diversität.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Darstellung von Migration und Identität im Frankfurter Bahnhofsviertel anhand der Krimi-Reihe von Jakob Arjouni
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Darstellung von Identitätsbildung und Zugehörigkeit bei Personen mit Migrationshintergrund im Frankfurter Bahnhofsviertel anhand der Krimi-Reihe von Jakob Arjouni um den Privatdetektiv Kemal Kayankaya. Der Fokus liegt auf den Romanen "Happy Birthday, Türke!" und "Bruder Kemal".
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die historische Migration nach Deutschland, insbesondere nach Frankfurt, die Charakterisierung des Bahnhofsviertels, die Gattung des Kriminalromans (Hardboiled), die Identitätsbildung von Migranten, die Darstellung von Migration und Zugehörigkeit in der Populärkultur und den Vergleich der Migrationsdarstellung in verschiedenen Romanen der Kayankaya-Reihe.
Welche Romane werden analysiert?
Die Analyse konzentriert sich auf Jakob Arjouni's Romane "Happy Birthday, Türke!" (1985) und "Bruder Kemal" (2012).
Wer ist Kemal Kayankaya?
Kemal Kayankaya ist der Protagonist der Krimi-Reihe von Jakob Arjouni und ein Privatdetektiv mit Migrationshintergrund, dessen Identität und Zugehörigkeit im Mittelpunkt der Analyse stehen.
Wie wird das Frankfurter Bahnhofsviertel dargestellt?
Das Frankfurter Bahnhofsviertel wird als literarischer Schauplatz kritisch charakterisiert, wobei die öffentliche Wahrnehmung als "Hauptstadt des Verbrechens" und die damit verbundenen Ängste und Vorurteile thematisiert werden.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Arbeit untersucht, wie Identitätsbildung und Zugehörigkeitszuschreibung bei Personen mit Migrationshintergrund in den Romanen dargestellt werden und wie sich diese Darstellung im Laufe der Zeit verändert hat.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Migrationshintergrund, Identitätsbildung, Zugehörigkeit, Frankfurter Bahnhofsviertel, Populärkultur, Kriminalliteratur, Jakob Arjouni, Kemal Kayankaya, Hardboiled, Deutschland, Integration, Diversität.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zum historischen Hintergrund der Migration, ein Kapitel zur populärkulturellen Darstellung im Kontext der Kriminalliteratur, eine detaillierte Analyse der ausgewählten Romane, ein Kapitel zum Vergleich der Migrationsdarstellung in verschiedenen Romanen und ein Fazit.
Welche Veränderungen der Darstellung von Migration werden untersucht?
Die Arbeit untersucht, ob und wie sich Arjouni's Sichtweise und die Darstellung seines Protagonisten im Umgang mit seiner Identität und Zugehörigkeit in den verschiedenen Romanen der Kayankaya-Reihe verändert haben.
- Arbeit zitieren
- Pauline Breitwieser (Autor:in), 2019, Migrationshintergrund und transkulturelle Identität in Jakon Arjounis Krimireihe. Privatdetektiv Kemal Kayankaya auf den Spuren seiner Zugehörigkeit, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/920346