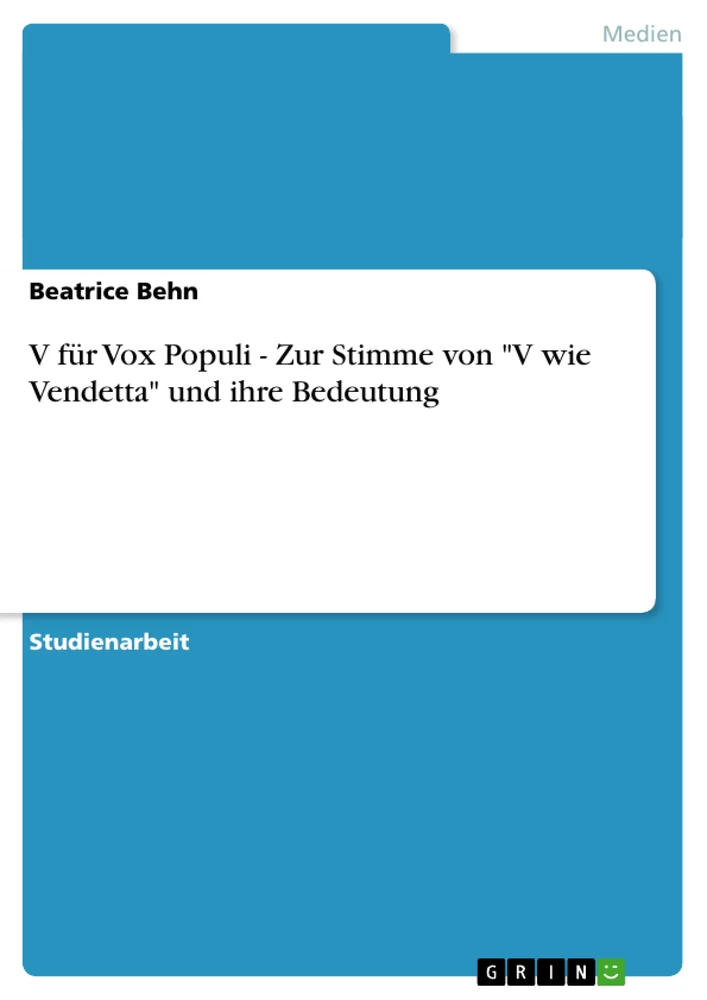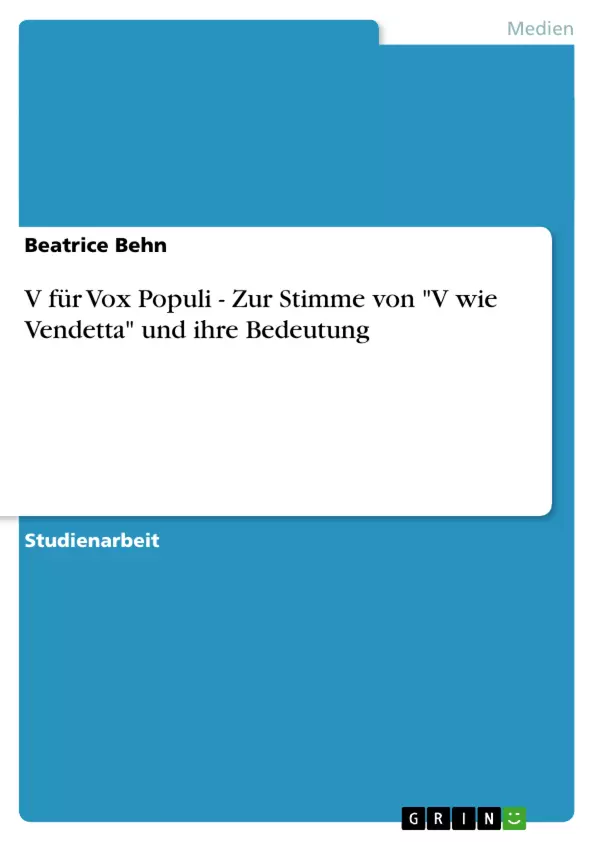Die menschliche Stimme definiert sich als das Vermögen, Töne und Laute zu erzeugen. Diese Laute wurden im Laufe der Evolution mit konnotativen und denotativen Bedeutungen verknüpft und es entwickelte sich die Sprache.
Doch die menschliche Stimme ist noch viel mehr als nur Träger der Sprache.
Psychoanalytisch betrachtet ist sie gleichzeitig ein Objekt (Jacques Lacan betrachtet sie sogar als ein objet (a)) , welches Begierde hervorruft und als Fetisch fungieren kann.
Schon in der pränatalen Phase ist der Fötus umgeben von Stimmen, die (retrospektiv betrachtet) von scheinbar überall herkommen und deren Quelle stets im Dunkeln liegt.
Dieses Phänomen, welches sich oft im Medium Film wieder findet, nennt Michel Chion in seinem Buch The Voice in Cinema die akusmatische Stimme, also eine Stimme, deren Herkunft unbekannt ist und die keinem menschlichen Körper zugeordnet werden kann. Chion konstatiert weiterhin, dass diese Stimme ausgestattet ist mit gottesähnlichen Attributen. Sie ist allgegenwärtig, allwissend, allsehend und damit allmächtig.
...
1.1 Die akusmatische Stimme und ihre vermeintliche Quelle
Die Einführung der Figur beginnt mit einer Stimme, deren zugehörige Quelle in Form eines menschlichen Körpers vorerst nicht im Bildbereich sichtbar ist. Somit tritt die Stimme als akusmatische Stimme in die Diegese ein.
Klar und deutlich hörbar flotiert sie über das gesamte Bild und macht es dem Rezipienten unmöglich, auch nur die Richtung zu orten, aus der sie kommt.
Erst danach erscheint ein Körper auf der Leinwand, der aus dem Dunkeln in eine spärlich beleuchtete Gasse tritt. Er ist durch das Halbdunkel und den Nebel um ihn herum zwar als menschliche Figur erkennbar, Einzelheiten lassen sich jedoch noch nicht feststellen. Trotz der nur vagen Andeutung des Körpers und der uneindeutigen Präsentation der Stimme, lässt sich ein Zusammenhang zwischen beiden sofort vermuten, da es einer der klassischen Regeln des Films entspricht, den Sprechenden gleichzeitig visuell zu repräsentieren.
Laut Chion entsteht die Bereitschaft, eine Stimme und einen Körper einander zuzuordnen und damit die Stimme zu deakusmatisieren, sobald man sieht, wie sich die Lippen bewegen und dabei die Stimme erklingt. In diesem Fall jedoch wird diese Erwartung nicht erfüllt. Lediglich die Montage suggeriert dem Rezipienten, dass der gezeigte Körper die tatsächliche Quelle der Stimme sein könnte.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG: DIE AKUSMATISCHE STIMME.
- 1. DIE EINFÜHRUNG VON STIMME UND KÖRPER IN DIE DIEGESE.
- 1.1 DIE AKUSMATISCHE STIMME UND IHRE VERMEINTLICHE QUELLE
- 1.2 SCHAUSPIEL UND SPRACHE ALS WEITERE INDIZIEN FÜR DIE TRENNUNG VON STIMME UND KÖRPER.
- 2. DER URSPRUNG UND DIE BEDEUTUNG DER STIMME VS
- 2.1 DIE ZWEI EBENEN DER DIEGESE
- 2.1.1 Die metakommunikative Ebene.
- 2.1.2 Die Ebene der diegetischen Realität (Plot).
- 2.2 DIE KOLLEktive VerkÖRPERUNG
- 3. SCHLUSSFOLGERUNG
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Analyse von „V wie Vendetta“ konzentriert sich auf die akusmatische Stimme des Protagonisten V und deren Bedeutung für die politikphilosophische Ebene des Films. Die Arbeit untersucht die Einführung der Stimme in die Diegese, ihre vermeintliche Quelle und die Gründe, warum sie nicht deakusmatisiert wird, d.h. warum sie nicht einem sichtbaren Körper zugeordnet wird. Darüber hinaus werden die Rolle der Stimme als Träger der Politikphilosophie und deren Auswirkungen auf die Rezeption des Films beleuchtet.
- Die akusmatische Stimme und ihre vermeintliche Quelle
- Die Deakusmatisierung und ihre Bedeutung für die Filmsprache
- Die politische und philosophische Bedeutung der akusmatischen Stimme in „V wie Vendetta“
- Die Rolle der Stimme in der Konstruktion der Figur V
- Die Rezeption der akusmatischen Stimme und ihre Auswirkungen auf das Publikum
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt die akusmatische Stimme als ein wichtiges filmisches Element ein und beleuchtet ihre Bedeutung im Kontext der Psychoanalyse und der Filmgeschichte. Kapitel 1 untersucht die Einführung von Stimme und Körper in die Diegese von „V wie Vendetta“, wobei insbesondere die akusmatische Stimme des Protagonisten V in den Fokus gerückt wird. Es wird analysiert, wie die Stimme in die Diegese eintritt und welche Faktoren die Deakusmatisierung verhindern. Kapitel 2 befasst sich mit dem Ursprung und der Bedeutung der Stimme. Hier werden die zwei Ebenen der Diegese, die metakommunikative und die diegetische Realität, sowie die kollektive Verkörperung der Stimme untersucht. Der Fokus liegt auf der Frage, wie die akusmatische Stimme die politische und philosophische Botschaft des Films trägt.
Schlüsselwörter
Akusmatische Stimme, Deakusmatisierung, Diegese, „V wie Vendetta“, Politikphilosophie, Filmsprache, Rezeption, Figur V, Metakommunikation, Kollektive Verkörperung, Hollywoodfilm, Vokozentrismus, Tonbearbeitung, -mischung, Ideologie des Sichtbaren.
Häufig gestellte Fragen
Was ist eine "akusmatische Stimme" im Film?
Nach Michel Chion ist eine akusmatische Stimme eine Stimme, deren Quelle im Bild nicht sichtbar ist. Sie wirkt oft allmächtig, allwissend und gottesähnlich.
Warum wird die Stimme von V in "V wie Vendetta" nicht deakusmatisiert?
V trägt ständig eine Maske. Da man seine Lippenbewegungen nie sieht, bleibt die Stimme vom Körper getrennt, was seine Rolle als Symbol und Träger einer politischen Philosophie verstärkt.
Welche symbolische Bedeutung hat Vs Stimme?
Die Stimme fungiert als "Vox Populi" (Stimme des Volkes). Sie ist nicht an ein Individuum gebunden, sondern verkörpert eine kollektive Idee und eine Ideologie des Widerstands.
Wie wird die Trennung von Stimme und Körper filmisch umgesetzt?
Durch Tonmischung und Montage wird suggeriert, dass der Körper die Quelle ist, aber das Fehlen sichtbarer Artikulation verhindert die vollständige Zuordnung (Deakusmatisierung).
Welche Rolle spielt die Psychoanalyse bei der Betrachtung der Stimme?
Die Stimme kann als "objet (a)" nach Lacan betrachtet werden – ein Objekt, das Begierde hervorruft und als Fetisch fungieren kann, besonders wenn ihre Quelle im Dunkeln bleibt.
- Arbeit zitieren
- Beatrice Behn (Autor:in), 2008, V für Vox Populi - Zur Stimme von "V wie Vendetta" und ihre Bedeutung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/92035