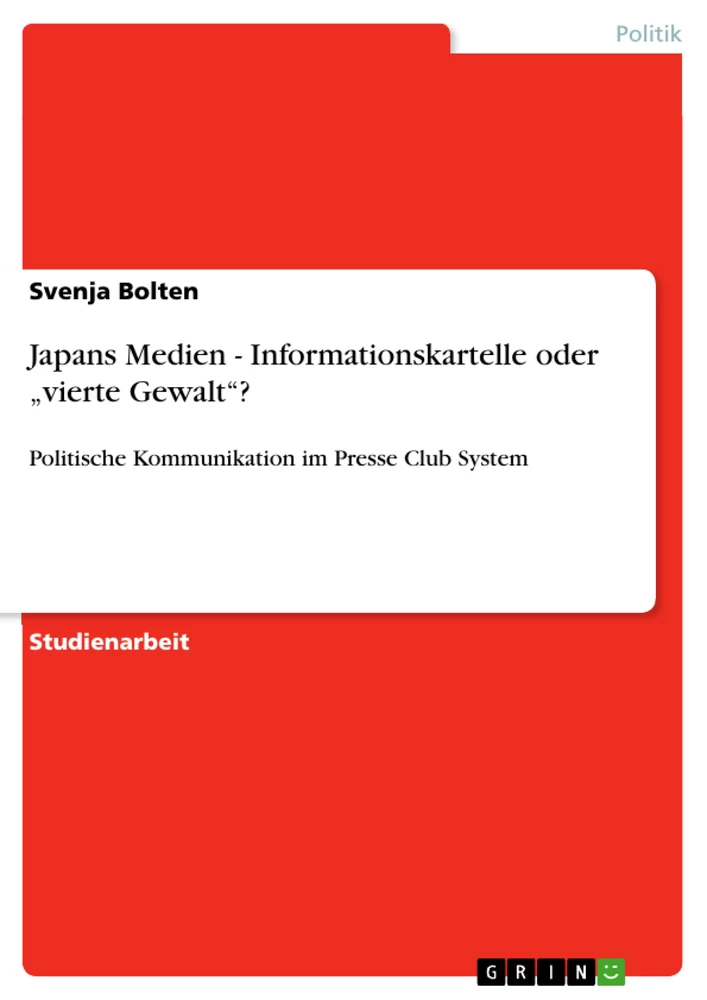In demokratischen Verfassungsstaaten kontrollieren und begrenzen freie und unabhängige Medien die Macht der Regierung, indem sie durch die Erfüllung ihrer Kritikfunktion gegenüber der Regierung den öffentlichen Diskurs beeinflussen und die Chancen auf einen Machtwechsel in der Wahl erhöhen. Sie handeln idealerweise als politisch unabhängige Institutionen und beteiligen sich aktiv als Wächter der Demokratie. Sie bilden somit eine weitere Säule des Demokratiegefüges, neben der Legislative, der Judikative und der Exekutive, eine „vierte Gewalt“.
Inwieweit lenken japanischen Medien ihre Wirkungs- und Funktionsweise auf den Demokratisierungsprozess? Interpretieren japanische Journalisten ihre Rolle als Kontrollinstitution des Staates im Sinne einer „vierten Gewalt“, oder sind die Prinzipien gesellschaftlicher Konsens und Harmoniestreben von größerer Bedeutung? Ergeben sich aus den spezifisch japanischen Charakteristika der Medienlandschaft und der besonderen Institution des Presse Clubs Funktionsstörungen, welche sogar eine Kartellisierung der Medien bewirken?
Die vorliegende Arbeit setzt sich mit einem der möglichen Gründe für die Ein-Parteien Dominanz im demokratischen System Japans auseinander: Die Rolle der Medien in der politischen Kommunikation und die Vernachlässigung ihrer politischen Funktionen. Zunächst wird die japanische Institution des Presse Clubs analysiert. Der Einfluss der Presse Clubs auf die politische Berichterstattung und somit auf die Inhalte des öffentlichen Diskurses, den Agenda Setting-Prozess, wird dargestellt. Geleitet von der Frage, ob die Berichterstattung auf den demokratischen Grundlagen einer freien Presse beruht und ob sie sich an einem westlich geprägten Funktionsverständnisses der Medien messen lässt, wird die These der „vierten Gewalt“ überprüft.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Funktionen der Medien im politischen Prozess
- Informationsfunktion
- Artikulationsfunktion
- Kritik und Kontrollfunktion
- Dilemma: Wahrung der Unabhängigkeit bei gleichzeitiger Abhängigkeit
- Einflussgrößen auf die politischen Funktionen japanischer Medien
- Das gesetzliche Rahmenwerk japanischer Medien
- Beziehungsnetzwerke der Medien
- Japans Medienlandschaft
- Historische Entwicklung der Presse Clubs
- Tokugawa Shogunat (1603-1868)
- Meiji Ära (1868-1912)
- Taisho-Ära (1912-1926) und Vorkriegszeit
- Nachkriegszeit
- Presse Clubs heute
- Presse Clubs als Informationskartelle
- Formelle Clubregeln
- Informelle und andere Regeln
- Sanktionen
- Zukünftige Herausforderungen an das Presse Club System Japans
- Externer Druck
- Interner Druck
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Rolle der Medien im demokratischen System Japans und untersucht, inwieweit sie ihre politischen Funktionen erfüllen. Der Fokus liegt dabei auf der Institution der Presse Clubs und deren Einfluss auf die politische Berichterstattung, den öffentlichen Diskurs und den Agenda Setting Prozess. Die Arbeit analysiert, ob die japanischen Medien ihrer Rolle als Kritiker und Kontrollinstitution des Staates als „vierte Gewalt“ gerecht werden oder ob sie dem Prinzip des gesellschaftlichen Konsenses und Harmoniebestreben Vorrang einräumen. Darüber hinaus wird die Frage untersucht, ob die japanspezifischen Charakteristika der Medienlandschaft und der Presse Clubs zu Funktionsstörungen und einer möglichen Kartellisierung der Medien führen.
- Die Rolle der Medien in der politischen Kommunikation und die Erfüllung ihrer politischen Funktionen
- Die Institution der Presse Clubs in Japan und deren Einfluss auf die politische Berichterstattung
- Der Einfluss der Presse Clubs auf den öffentlichen Diskurs und den Agenda Setting Prozess
- Die Funktionsweise der Medien im Vergleich zu einem westlich geprägten Funktionsverständnis
- Die Frage der „vierten Gewalt“ in Japan und die Funktionsstörungen, die durch die Presse Clubs entstehen können
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung skizziert den Kontext der Arbeit, indem sie die Bedeutung freier und unabhängiger Medien in demokratischen Verfassungsstaaten und die Besonderheiten der japanischen Medienlandschaft beleuchtet. Sie stellt die Frage, ob die japanischen Medien die „vierte Gewalt“ darstellen, und setzt den Fokus auf die Presse Clubs als ein wesentliches Element der politischen Kommunikation in Japan.
Kapitel 2 erläutert die zentralen politischen Funktionen der Massenmedien in demokratischen Systemen. Diese beinhalten die Informationsfunktion, die Artikulationsfunktion und die Kritik- und Kontrollfunktion. Darüber hinaus wird das Dilemma zwischen der Unabhängigkeit der Berichterstattung und der Abhängigkeit von Informationen beleuchtet.
Kapitel 3 beleuchtet die Einflussfaktoren auf die politischen Funktionen japanischer Medien. Dazu gehören das gesetzliche Rahmenwerk und die Beziehungsnetzwerke der Medien.
Kapitel 4 gibt einen Überblick über die japanische Medienlandschaft.
Kapitel 5 zeichnet die historische Entwicklung der Presse Clubs von der Tokugawa-Zeit bis zur Nachkriegszeit nach. Es beschreibt den Aufbau und die Funktionsweise der Presse Clubs im heutigen Japan.
Kapitel 6 geht genauer auf die Presse Clubs als Informationskartelle ein und beleuchtet die formalen und informellen Regeln sowie die Sanktionen, die innerhalb des Systems gelten.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Medien, Politik, Kommunikation, Presse Clubs, Japan, Demokratie, „vierte Gewalt“, Informationskartelle, öffentlicher Diskurs, Agenda Setting, Funktionsstörungen, westliches Funktionsverständnis, Liberal Demokratische Partei (LDP), gesellschaftlicher Konsens, Harmoniebestreben, Einflussfaktoren, gesetzliches Rahmenwerk, Beziehungsnetzwerke.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die japanischen Presse Clubs (Kisha Kurabu)?
Das sind exklusive Vereinigungen von Journalisten großer Medienhäuser, die an Ministerien oder Institutionen angegliedert sind und den Zugang zu Informationen kontrollieren.
Warum werden Presse Clubs als "Informationskartelle" bezeichnet?
Weil sie den Informationsfluss monopolisieren, ausländische Journalisten oder Freelancer oft ausschließen und durch informelle Regeln eine regierungsnahe Berichterstattung fördern.
Sind japanische Medien eine "vierte Gewalt"?
Die Arbeit untersucht kritisch, ob japanische Medien ihre Kontrollfunktion wahrnehmen oder ob Harmoniestreben und enge Beziehungen zur Politik (Agenda Setting) diese Funktion behindern.
Welche Sanktionen gibt es in Presse Clubs?
Journalisten, die gegen Clubregeln verstoßen oder zu kritisch berichten, riskieren den Ausschluss vom Informationszugang, was für ihre Arbeit existenzbedrohend sein kann.
Wie beeinflussen Presse Clubs den demokratischen Prozess?
Durch die Vereinheitlichung der Nachrichten und die Vernachlässigung der Kritikfunktion können sie zur Dominanz einer einzelnen Partei (wie der LDP) beitragen.
- Quote paper
- Svenja Bolten (Author), 2005, Japans Medien - Informationskartelle oder „vierte Gewalt“?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/92088