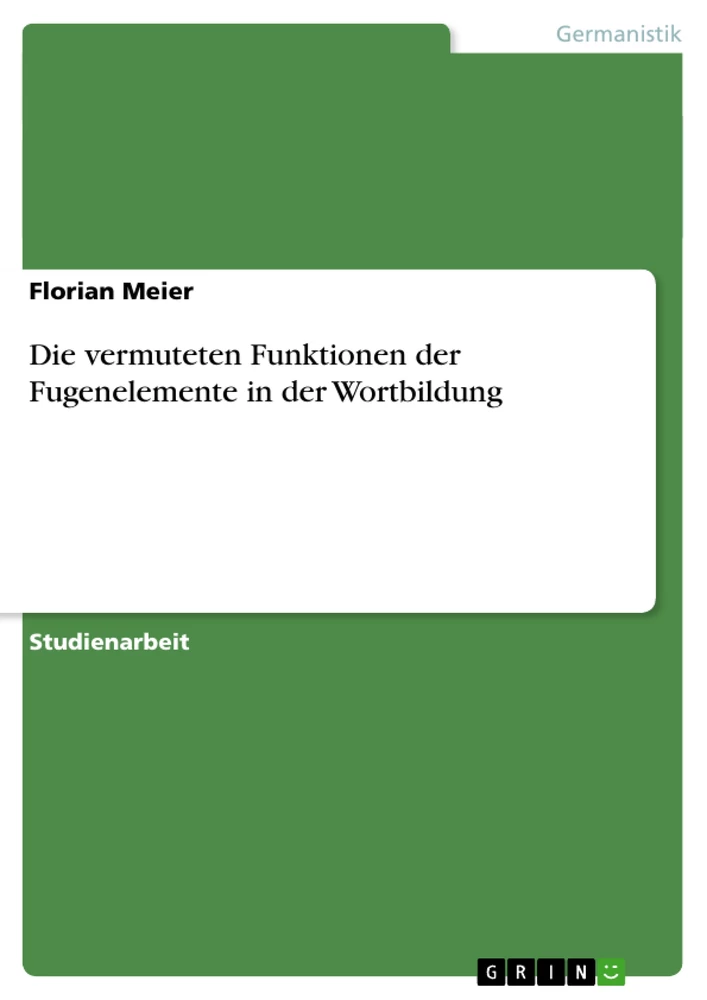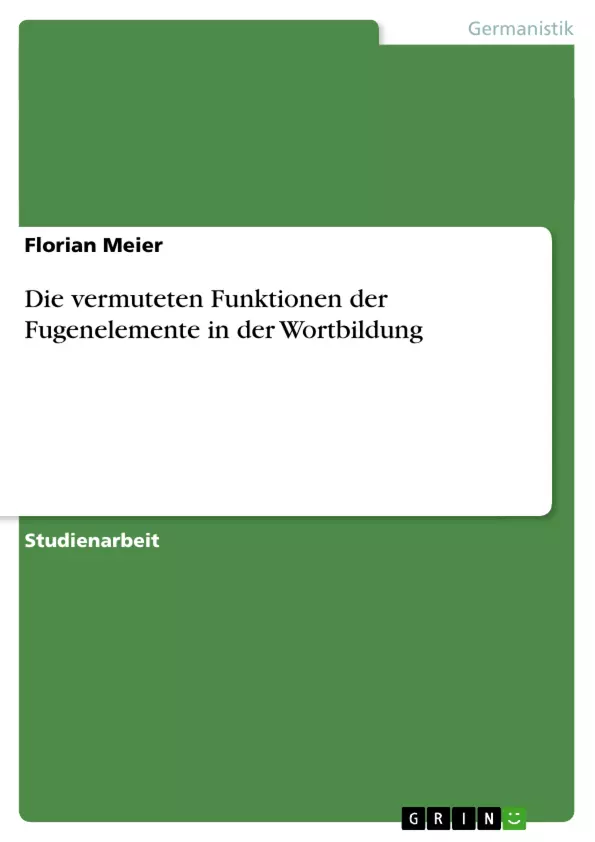„Was ein Wort bedeutet, kann ein Satz nicht sagen“. Diese Aussage stammt von Ludwig Wittgenstein und beschreibt wohl umfassender wie alle anderen Versuche, was es mit der wissenschaftlichen Analyse von Sprache auf sich hat. Ein Wort oder ein sprachliches Phänomen kann niemals vollständig in seiner Bedeutung wiedergegeben werden, doch die Linguistik möchte wenigstens eine Annäherung schaffen und bestimmte Eigenheiten und Besonderheiten der Sprache aufdecken, systematisieren und kategorisieren. So versucht sie dies auch in der deutschen Wortbildung, indem sie untersucht, welche Gesetzmäßigkeiten die deutsche Sprache bei der Bildung von Worteinheiten aufweist. Untersuchungsgegenstand ist beispielsweise die Komposition. Hier wird die Zusammensetzung mehrerer Wörter und Wortstämme analysiert und kategorisiert. Es gibt aber auch Analysen zur Derivation, bei denen die Zusammensetzung von einem eigenständigen Grundmorphem und einem meist unselbstständigen Affix untersucht werden. Das Thema dieser Ausarbeitung widmet sich aber einer anderen Erscheinung der deutschen Wortbildung:
In Kompositionen und Derivationen treten zwischen den Gliedern sehr häufig sogenannte Fugenelemente auf. Fugenelement soll in dieser Arbeit sein, was über die Form des Nominativ Singular des substantivischen Erstgliedes in einer Komposition oder Derivation hinausgeht (vgl. Eisenberg 2004: 227). Fugenelemente können sein -n-, -ns-, -e-, -er-, -en-, -es-, -ens- und das einfache -s-. Weitere mögliche Fugen sind -i- und -o-, diese werden hier aber ausgeblendet, da sie eigentlich nur bei Wörtern vorkommen, die aus anderen Sprachen entlehnt worden sind. Deswegen werden sie auch als „Lehnfugenelemente“ bezeichnet (vgl. Donalies 2007: 33).
In dieser Ausarbeitung wird näher erläutert, ob die Fugenelemente bestimmte Funktionen und damit verbundene Regelhaftigkeiten aufweisen und ob daraus bestimmte Gesetzmäßigkeiten erschlossen werden können, wann welche Fugen wo auftreten. Diese vermuteten Funktionen werden kritisch hinterfragt und auch Ausnahmen sowie Nicht-Entsprechungen näher erläutert um am Ende zu einem begründetem Fazit zu gelangen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die vermuteten Funktionen der Fuge
- Die vermuteten Funktionen der Fuge
- Morphologische Funktion: Gliederung
- Semantische Funktion: Plural
- Syntaktische Funktion: Genitiv
- Ergebnis
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Ausarbeitung beschäftigt sich mit der Frage, ob die Fugenelemente in der deutschen Wortbildung bestimmte Funktionen und damit verbundene Regelhaftigkeiten aufweisen. Die Analyse der vermuteten Funktionen soll dabei helfen, Gesetzmäßigkeiten für das Auftreten von Fugenelementen zu erschließen.
- Morphologische Funktion der Gliederung
- Semantische Funktion als Pluralmarker
- Syntaktische Funktion aus dem genitivischen Begriffsverhältnis
- Kritische Betrachtung der vermuteten Funktionen
- Analyse von Beispielen und Nicht-Entsprechungen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und beschreibt die Problematik der Funktionszuschreibung von Fugenelementen. Im zweiten Kapitel werden die von Nanna Fuhrhop (1996) aufgestellten Funktionen, nämlich die morphologische, semantische und syntaktische Funktion, kritisch beleuchtet und mit Beispielen und Nicht-Entsprechungen belegt.
Schlüsselwörter
Fugenelemente, Wortbildung, Komposition, Derivation, morphologische Funktion, semantische Funktion, syntaktische Funktion, Gliederung, Plural, Genitiv, Regelhaftigkeiten, Produktivität, Nicht-Entsprechungen
Was sind Fugenelemente in der deutschen Sprache?
Fugenelemente sind Laute wie -s-, -n- oder -er-, die zwischen den Teilen eines zusammengesetzten Wortes (Kompositum) auftreten, z.B. das „s“ in „Geburt-s-tag“.
Welche Funktion hat die morphologische Gliederung?
Sie dient dazu, die Grenzen zwischen den einzelnen Wortbestandteilen deutlicher zu machen und die Aussprache zu erleichtern.
Können Fugenelemente den Plural anzeigen?
Es gibt die Vermutung einer semantischen Funktion, bei der z.B. das -er- in „Kindergarten“ auf einen Plural hindeutet, was jedoch wissenschaftlich kritisch hinterfragt wird.
Was ist die syntaktische Funktion der Fuge?
Manche Fugen wie das -s- lassen sich historisch auf Genitivendungen zurückführen, die ein Besitzverhältnis innerhalb des Wortes anzeigen.
Gibt es feste Regeln für das Auftreten von Fugen?
Die Linguistik sucht nach Gesetzmäßigkeiten, stellt aber fest, dass es viele Ausnahmen gibt und die Verwendung oft von regionalen Gewohnheiten oder der Analogie abhängt.