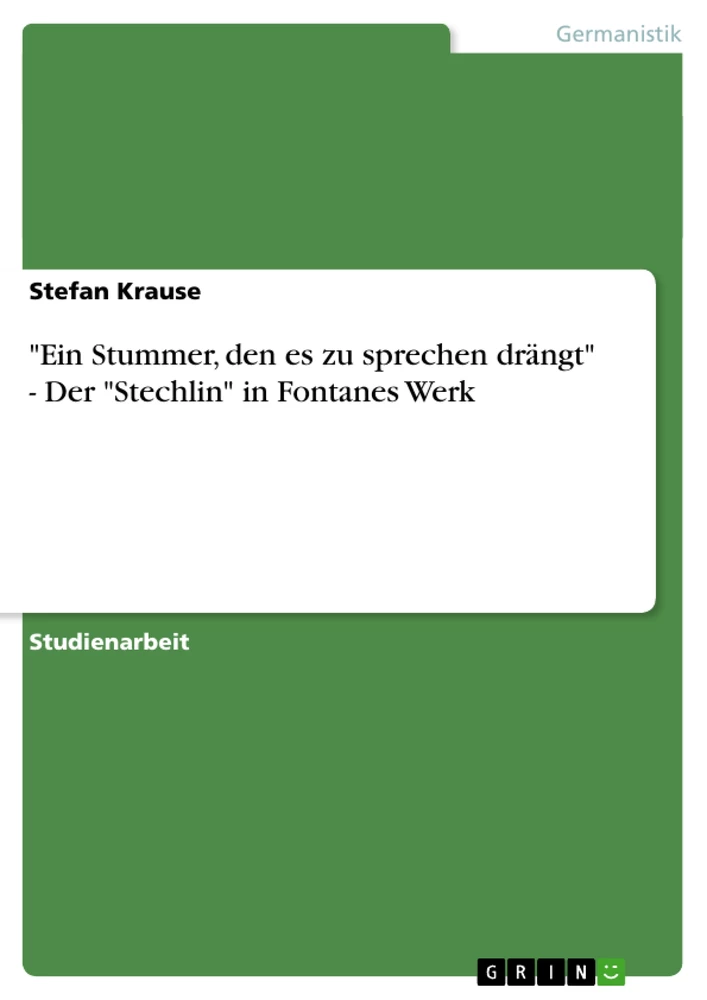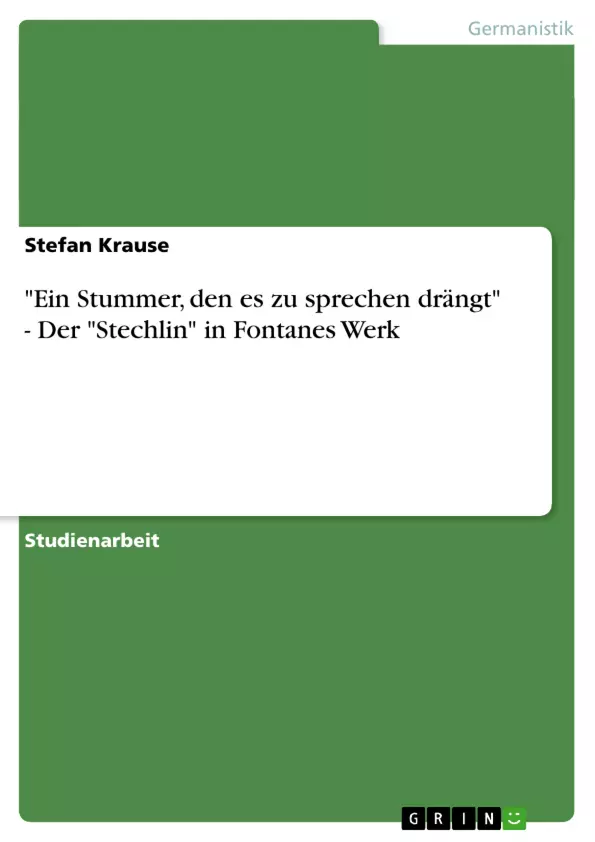Wohl keinem anderen seiner Werke widmete Theodor Fontane mehr Zeit und Engagement als seinen ‚Wanderungen durch die Mark Brandenburg’. Bereits 1859 unternahm er erste Reisen in die Grafschaft Ruppin, aus denen bis 1862 der Band ‚Wanderungen durch die Mark Brandenburg’ erwachsen sollte, später unter dem Titel ‚Die Grafschaft Ruppin’ der erste Teil der insgesamt vierbändigen Wanderungen. Noch kurz vor seinem Tod 1898 beschäftigte sich Fontane mit einem weiteren Werk über Friesack und die Familie Bredow. Es zu vollenden, war ihm jedoch nicht mehr vergönnt.
Nachdem Fontane lange, auch zu seinem eigenen Leidwesen, primär als Reiseschriftsteller wahrgenommen worden war, wertete die Forschung die ‚Wanderungen’ später zunehmend ab, bis sie innerhalb des Gesamtwerkes als kaum mehr galten, denn „als interessante Stoffsammlung für seine Romane“.
Erst die zunehmende Beachtung der Reiseliteratur bescherte den ‚Wanderungen’ eine Renaissance, die sie manchem heutigen Forscher gar wieder als ein „neu zu entdeckende[s] Hauptwerk[…]“ erscheinen lassen.
Diese Arbeit hat sich das Ziel gesetzt, am Fallbeispiel des Stechlin-Sees, den Fontane im ersten Band seiner Wanderungen beschrieb und später zum Titel gebenden Leitmotiv des gleichnamigen Romans machte, zu untersuchen, in welchem Umfang der Autor die in den ‚Wanderungen’ entwickelte Charakterisierung des Sees für sein Romanwerk adaptierte, welche Veränderungen und Ergänzungen er vornahm und wie es ihm dadurch gelang, einen bereisten realen Ort für die Romanfiktion zu instrumentalisieren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 2.1 Der Stechlin in den "Wanderungen"
- 2.1.1 Die Menzer Forst
- 2.1.2 Die Fahrt durch den Forst
- 2.1.3 Der Große Stechlin
- 2.1.4 Globsow
- 2.1.5 Groß-Menz
- 2.2 Zwischenfazit
- 3.1 Der Stechlin in "Der Stechlin"
- 3.1.1 Der Stechlin als Romananfang
- 3.1.2 Czako und der Stechlinkarpfen
- 3.1.3 Der winterliche Besuch am Stechlinsee
- 3.1.4 Schlussworte
- 3.2 Fazit
- 4 Autor und Erzähler: einige Fragen über die Realität
- 5 Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Rolle des Stechlin-Sees im Werk Theodor Fontanes, insbesondere im Vergleich zwischen den „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ und dem Roman „Der Stechlin“. Ziel ist es, zu untersuchen, wie Fontane die in den „Wanderungen“ entwickelte Charakterisierung des Sees für sein Romanwerk adaptierte, welche Veränderungen und Ergänzungen er vornahm und wie er den realen Ort für die Romanfiktion instrumentalisierte.
- Die Entwicklung des Stechlin-Sees als Motiv in Fontanes Werken.
- Der Einfluss der „Wanderungen“ auf den Roman „Der Stechlin“
- Die Adaption des realen Ortes in die Romanfiktion.
- Die Rolle des Sees als Symbol in Fontanes Werk.
- Die Bedeutung der Landschaft für Fontanes Erzählweise.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Bedeutung der „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ im Gesamtwerk Fontanes beleuchtet. Es wird auf die Rezeption der „Wanderungen“ als „Stoffsammlung“ für seine Romane eingegangen und ihre Renaissance als „neu zu entdeckendes Hauptwerk“ hervorgehoben.
Im ersten Teil wird der Stechlin-See in den „Wanderungen“ untersucht. Das Kapitel „Die Menzer Forst und der Große Stechlin“ wird analysiert, um zu zeigen, wie der See in Szene gesetzt wird und welche Rolle er in der Textkomposition spielt.
Der zweite Teil beschäftigt sich mit dem Stechlin-See im Roman „Der Stechlin“. Es wird betrachtet, wie der See als Romananfang dient, wie er im Zusammenhang mit der Figur Czako steht und wie er in der winterlichen Episode des Romans erscheint.
Die Arbeit schließt mit einem Abschnitt über Autor und Erzähler, der einige Fragen über die Realität in Fontanes Werk aufwirft.
Schlüsselwörter
Theodor Fontane, „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“, „Der Stechlin“, Stechlin-See, Landschaft, Realismus, Romanfiktion, Symbol, Motiv, Erzählweise.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielt der Stechlin-See in Fontanes Werk?
Der See dient sowohl als real beschriebener Ort in den „Wanderungen“ als auch als zentrales, titelgebendes Leitmotiv und Symbol in Fontanes berühmtem Roman „Der Stechlin“.
Wie unterscheiden sich die „Wanderungen“ vom Roman „Der Stechlin“?
Während die „Wanderungen“ eine reiseschriftstellerische Charakterisierung des realen Ortes bieten, instrumentalisierte Fontane diese Beschreibungen im Roman für eine tiefgründige Fiktion.
Was symbolisiert der Stechlin-See im Roman?
Er steht für die Verbindung von lokaler Tradition und weltweiten Ereignissen (z.B. das Aufwallen des Sees bei fernen Naturkatastrophen) und spiegelt die innere Verfassung der Figuren wider.
War Fontane primär ein Reiseschriftsteller?
Lange Zeit wurde er so wahrgenommen, doch die neuere Forschung sieht in den „Wanderungen“ ein eigenständiges Hauptwerk, das weit über eine bloße „Stoffsammlung“ hinausgeht.
Was hat es mit dem „Stechlinkarpfen“ auf sich?
Der Stechlinkarpfen ist ein erzählerisches Element im Roman, das in einer Szene mit der Figur Czako vorkommt und die lokale Identität sowie die Naturverbundenheit thematisiert.
Wie ging Fontane mit der Realität in seinen Romanen um?
Fontane adaptierte reale Orte wie Globsow oder Groß-Menz detailgetreu, veränderte sie aber so, dass sie perfekt in die symbolische Struktur seiner literarischen Fiktion passten.
- Quote paper
- Stefan Krause (Author), 2007, "Ein Stummer, den es zu sprechen drängt" - Der "Stechlin" in Fontanes Werk, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/92108