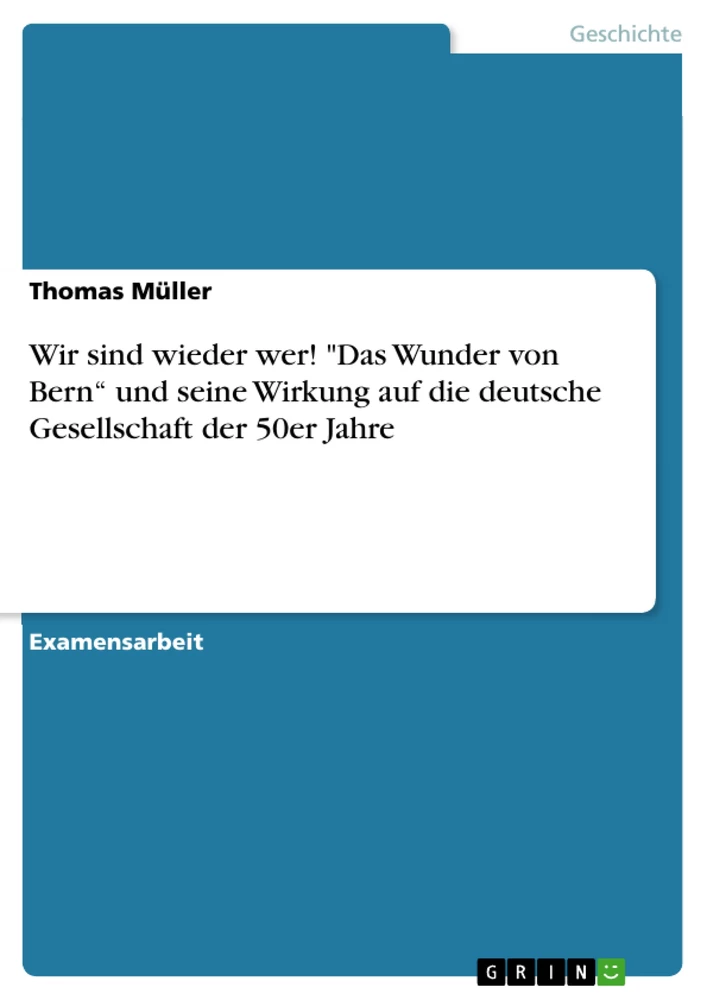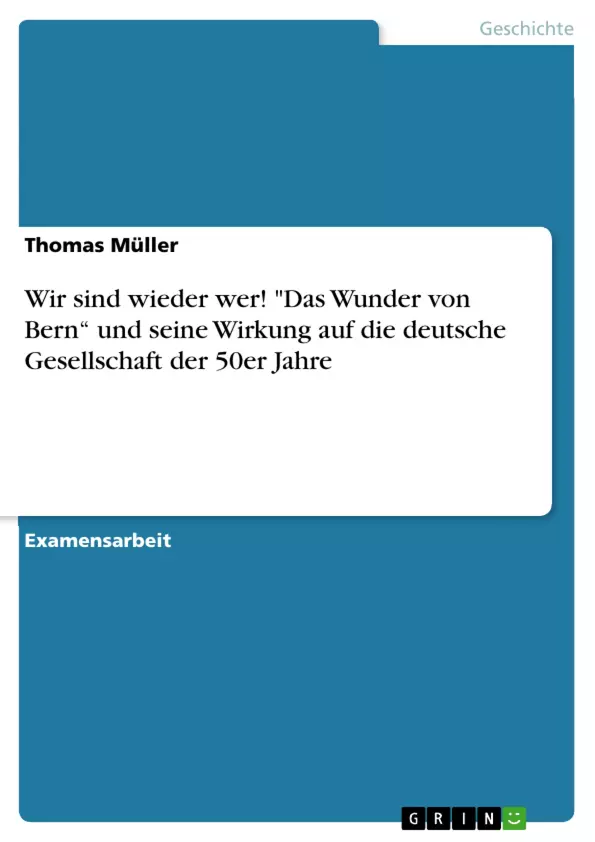„(…) Bozsik, immer wieder Bozsik, der rechte Läufer der Ungarn am Ball. Er hat den Ball verloren, diesmal gegen Schäfer – Schäfer nach innen geflankt – Kopfball – abgewehrt – aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen - Rahn schießt! – Tooor! Tooor! Tooor! Tooor! …“
… 3:2 für Deutschland im Fußball-Weltmeisterschaftsfinale 1954. Der krasse Außenseiter stand kurz vor der großen Sensation, der Sieg über die für unschlagbar gehaltenen Ungarn war zum Greifen nah. Nur noch sechs Minuten galt es zu überstehen. Radioreporter Herbert Zimmermann bekniete den Minutenzeiger schneller zu wandern, doch der leistete seinen Dienst „streng nach Vorschrift“. Noch einmal mussten die Deutschen eine Schrecksekunde überstehen, als der ungarische Star Ferenc Puskás den vermeintlichen Ausgleich erzielte. Aber Abseits, kein Tor! Wenig später pfiff der englische Schiedsrichter Ling die Partie ab – und Deutschland war Fußballweltmeister 1954.
In der Heimat feierten die Menschen den Erfolg ausgelassen. Das Ausmaß der Begeisterung sollten die Helden auf ihrer Rückreise erleben. Menschenaufläufe und frenetischer Jubel überall da, wo sie auftauchten. Weniger als zwanzig Jahre zuvor gerieten die Deutschen schon einmal angesichts sportlicher Erfolge in Ekstase. Damals verstand die politische Führung um Adolf Hitler, sich diese Triumphe zu Eigen zu machen. Dem Jubel über Max Schmelings Sieg über den für unbezwingbar gehaltenen „braunen Bomber“ Joe Louis (USA) am 19. Juni 1936 und dem guten Abschneiden der deutschen Olympioniken im gleichen Jahr haftete daher ein „… über alles in der Welt “-Beigeschmack an.
Wie aber ist der Jubel von 1954 einzuordnen? Kehrte mit der Freude über den WM-Gewinn der deutsche Chauvinismus zurück - eine Renaissance nationalsozialistischer Ideale? Oder hatten sich bereits neun Jahre nach Kriegsende demokratische Strukturen etabliert?
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitende Fragestellung
- 2. Die deutsche Gesellschaft der Nachkriegszeit bis 1954
- 2.1. Die Nachkriegsgesellschaft
- 2.2. Auseinandersetzung mit der Vergangenheit
- 2.3. Die Situation im Sport
- 2.4. Die Neugründung des DFB
- 3. Der lange Weg zur Weltmeisterschaft 1954
- 3.1. Sepp Herberger und Fritz Walter: „Der Chef und sein Vasall“
- 3.2. Der Weg zum „3:2“
- 3.3. Der Geist von Spiez
- 3.4. Die Spiele
- 3.5. Das Finale
- 4. Begeisterung nach dem Finale
- 4.1. Triumphale Heimkehr der Weltmeister
- 4.2. Jubel in der nationalen Presse
- 4.3. Internationale Anerkennung: Reaktionen der ausländischen Presse
- 5. Nationale Töne und die Reaktionen
- 5.1. Misstöne nach dem Finale
- 5.2. „Gutes Kicken“ und „gute Politik“ - Reaktionen der Politiker
- 5.3. Reaktionen der Presse
- 5.4. Reaktionen der Bevölkerung
- 6. Die DDR und das Wunder von Bern
- 7. Der Mythos vom „Wunder von Bern“
- 7.1. Die Entwicklung des Mythos
- 8. Wir sind wieder wer
- 9. Rezeption des „Wunders von Bern“
- 10. Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Wirkung des „Wunders von Bern“, des deutschen Sieges bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1954, auf die deutsche Gesellschaft der 1950er Jahre. Sie beleuchtet die gesellschaftlichen, politischen und medialen Reaktionen auf diesen sportlichen Erfolg und hinterfragt die Interpretation des Ereignisses als Ausdruck eines „Wir sind wieder wer“-Gefühls. Die Arbeit analysiert, ob der Jubel nationalistische Tendenzen wiederbelebte oder ob demokratische Strukturen bereits gefestigt waren.
- Die deutsche Nachkriegsgesellschaft und ihre Auseinandersetzung mit der Vergangenheit
- Die mediale Darstellung und Verarbeitung des WM-Sieges
- Die Reaktionen der Politik und der Bevölkerung auf den Erfolg
- Der Vergleich der Reaktionen im Westen und Osten Deutschlands
- Die Entstehung und Entwicklung des Mythos „Wunder von Bern“
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitende Fragestellung: Die Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Bedeutung des „Wunders von Bern“ für die deutsche Gesellschaft der 1950er Jahre. Sie thematisiert den unerwarteten Sieg der deutschen Nationalmannschaft gegen die favorisierten Ungarn und den damit verbundenen gesellschaftlichen Jubel. Die Frage, ob dieser Jubel nationalistische Tendenzen wiederbelebte oder Ausdruck eines demokratischen Bewusstseins war, wird als zentrale Forschungsfrage formuliert und die verschiedenen Untersuchungsebenen (Presse, Politik, Bevölkerung, Ausland, DDR) angedeutet.
2. Die deutsche Gesellschaft der Nachkriegszeit bis 1954: Dieses Kapitel analysiert die soziale, politische und wirtschaftliche Situation in Westdeutschland bis 1954. Es beleuchtet die Herausforderungen der Nachkriegsgesellschaft, wie die Bewältigung der Vergangenheit und den Aufbau eines neuen politischen Systems. Die Situation im Sport, insbesondere die Neugründung des DFB, wird im Kontext des gesellschaftlichen Wiederaufbaus betrachtet. Das Kapitel legt den Grundstein für das Verständnis des Kontextes, in dem der WM-Sieg stattfand.
3. Der lange Weg zur Weltmeisterschaft 1954: Dieses Kapitel beschreibt den Weg der deutschen Nationalmannschaft zur Weltmeisterschaft 1954. Es fokussiert auf die Rolle von Sepp Herberger und Fritz Walter, die Herausforderungen während des Turniers und die entscheidenden Spiele bis zum Finale. Die Kapitel beschreibt den "Geist von Spiez" und analysiert die taktischen und strategischen Aspekte des Erfolgs, um die Bedeutung des Sieges im sportlichen Kontext besser zu verstehen. Es liefert wichtige Hintergrundinformationen für die Analyse der gesellschaftlichen Reaktionen.
4. Begeisterung nach dem Finale: Dieses Kapitel schildert die überwältigende Begeisterung in Deutschland nach dem WM-Sieg. Es beleuchtet die Reaktionen der Bevölkerung, der Presse und des Auslandes, um das Ausmaß des Ereignisses zu verdeutlichen. Die triumphale Heimkehr der Weltmeister wird detailliert beschrieben, ebenso wie der Jubel in den Medien. Internationalen Reaktionen werden ebenfalls untersucht, um ein umfassendes Bild des gesellschaftlichen Einflusses des Ereignisses zu zeichnen.
5. Nationale Töne und die Reaktionen: Dieses Kapitel analysiert kritische Stimmen und differenzierte Reaktionen auf den WM-Sieg. Es beleuchtet sowohl die positiven als auch die negativen Aspekte der öffentlichen Meinungsbildung und untersucht die Reaktionen der Politik, Presse und Bevölkerung. Das Kapitel untersucht die Verwendung des Sieges für politische Zwecke und die Frage, inwieweit der Triumph für die Wiederherstellung des nationalen Selbstbewusstseins genutzt wurde. Die vielschichtigen und teilweise widersprüchlichen Reaktionen werden ausführlich diskutiert.
6. Die DDR und das Wunder von Bern: Dieses Kapitel untersucht die Reaktionen in der DDR auf den WM-Sieg Westdeutschlands. Es beleuchtet die politische und gesellschaftliche Bedeutung des Ereignisses im Kontext des Ost-West-Konflikts und der unterschiedlichen politischen Systeme. Es analysiert die Reaktionen der Bevölkerung, der Medien und der SED-Führung und stellt diese den Reaktionen im Westen gegenüber. Die Analyse zeigt die unterschiedlichen Interpretationen des sportlichen Erfolgs in den beiden deutschen Staaten.
7. Der Mythos vom „Wunder von Bern“: Dieses Kapitel analysiert die Entwicklung des „Wunders von Bern“ als Mythos. Es untersucht die Entstehung und Verbreitung dieses Mythos und seine Bedeutung für das kollektive Gedächtnis der Deutschen. Die verschiedenen Interpretationen und die Kontroversen um die Bedeutung des Ereignisses werden diskutiert. Das Kapitel beleuchtet, wie der Sieg im Laufe der Zeit zu einem Symbol für den gesellschaftlichen Wiederaufbau und das erneute Selbstbewusstsein der Deutschen wurde.
8. Wir sind wieder wer: Dieses Kapitel befasst sich mit der Interpretation des WM-Sieges als Ausdruck eines „Wir sind wieder wer“-Gefühls. Es untersucht die historische Entwicklung dieses Gefühls und seine Bedeutung im Kontext der deutschen Geschichte. Das Kapitel beleuchtet die unterschiedlichen Perspektiven auf diese Interpretation und analysiert die Ambivalenz dieses Gefühls im Kontext der Aufarbeitung der NS-Vergangenheit.
Schlüsselwörter
Wunder von Bern, Fußball-Weltmeisterschaft 1954, Nachkriegsgesellschaft, Bundesrepublik Deutschland, DDR, Medien, Politik, Bevölkerung, Nationalismus, „Wir sind wieder wer“, Mythenbildung, kollektives Gedächtnis, nationale Identität, Sport und Politik.
Häufig gestellte Fragen zum "Wunder von Bern"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Auswirkungen des deutschen Sieges bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1954 ("Wunder von Bern") auf die deutsche Gesellschaft der 1950er Jahre. Im Fokus stehen die gesellschaftlichen, politischen und medialen Reaktionen auf diesen Erfolg und die Hinterfragung der Interpretation des Ereignisses als Ausdruck eines „Wir sind wieder wer“-Gefühls. Analysiert wird, ob der Jubel nationalistische Tendenzen wiederbelebte oder ob demokratische Strukturen bereits gefestigt waren.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: die deutsche Nachkriegsgesellschaft und ihre Auseinandersetzung mit der Vergangenheit; die mediale Darstellung und Verarbeitung des WM-Sieges; die Reaktionen der Politik und der Bevölkerung auf den Erfolg; ein Vergleich der Reaktionen im Westen und Osten Deutschlands; und die Entstehung und Entwicklung des Mythos "Wunder von Bern".
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in ihnen?
Die Arbeit gliedert sich in zehn Kapitel: Kapitel 1 formuliert die zentrale Forschungsfrage. Kapitel 2 analysiert die deutsche Nachkriegsgesellschaft bis 1954. Kapitel 3 beschreibt den Weg der deutschen Nationalmannschaft zum WM-Sieg. Kapitel 4 schildert die Begeisterung nach dem Finale. Kapitel 5 analysiert kritische Stimmen und differenzierte Reaktionen. Kapitel 6 untersucht die Reaktionen in der DDR. Kapitel 7 analysiert die Entwicklung des "Wunders von Bern" als Mythos. Kapitel 8 befasst sich mit der Interpretation des Sieges als Ausdruck eines „Wir sind wieder wer“-Gefühls. Kapitel 9 behandelt die Rezeption des "Wunders von Bern". Kapitel 10 bietet ein Resümee.
Wie wird der "Mythos Wunder von Bern" behandelt?
Die Arbeit untersucht die Entstehung und Verbreitung des Mythos "Wunder von Bern" und seine Bedeutung für das kollektive Gedächtnis der Deutschen. Verschiedene Interpretationen und Kontroversen um die Bedeutung des Ereignisses werden diskutiert, inklusive der Frage, wie der Sieg im Laufe der Zeit zu einem Symbol für den gesellschaftlichen Wiederaufbau und das erneute Selbstbewusstsein der Deutschen wurde.
Welche Rolle spielt die DDR in der Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Reaktionen in der DDR auf den WM-Sieg Westdeutschlands, beleuchtet die politische und gesellschaftliche Bedeutung des Ereignisses im Kontext des Ost-West-Konflikts und der unterschiedlichen politischen Systeme. Die Reaktionen der Bevölkerung, der Medien und der SED-Führung werden analysiert und mit den Reaktionen im Westen verglichen.
Welche Quellen werden verwendet?
Die konkrete Quellenangabe ist nicht im bereitgestellten HTML-Code enthalten. Um dies zu erfahren, müsste man auf das vollständige Dokument zurückgreifen.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die konkreten Schlussfolgerungen sind nicht im bereitgestellten HTML-Code enthalten. Um dies zu erfahren, müsste man auf das vollständige Dokument zurückgreifen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Wunder von Bern, Fußball-Weltmeisterschaft 1954, Nachkriegsgesellschaft, Bundesrepublik Deutschland, DDR, Medien, Politik, Bevölkerung, Nationalismus, „Wir sind wieder wer“, Mythenbildung, kollektives Gedächtnis, nationale Identität, Sport und Politik.
- Quote paper
- Thomas Müller (Author), 2007, Wir sind wieder wer! "Das Wunder von Bern“ und seine Wirkung auf die deutsche Gesellschaft der 50er Jahre, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/92179