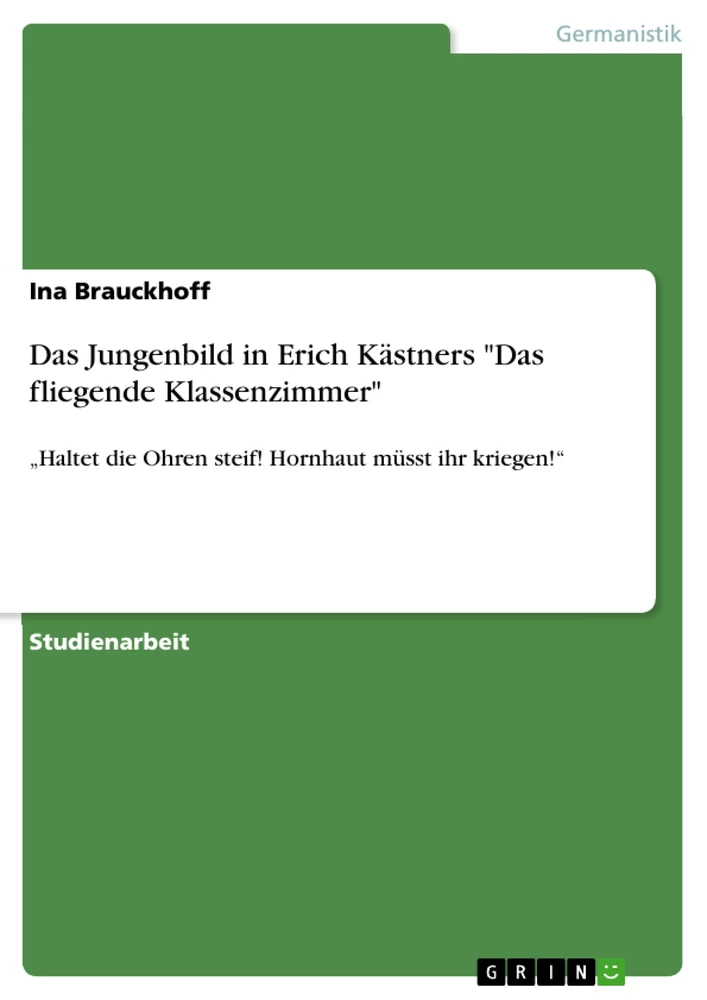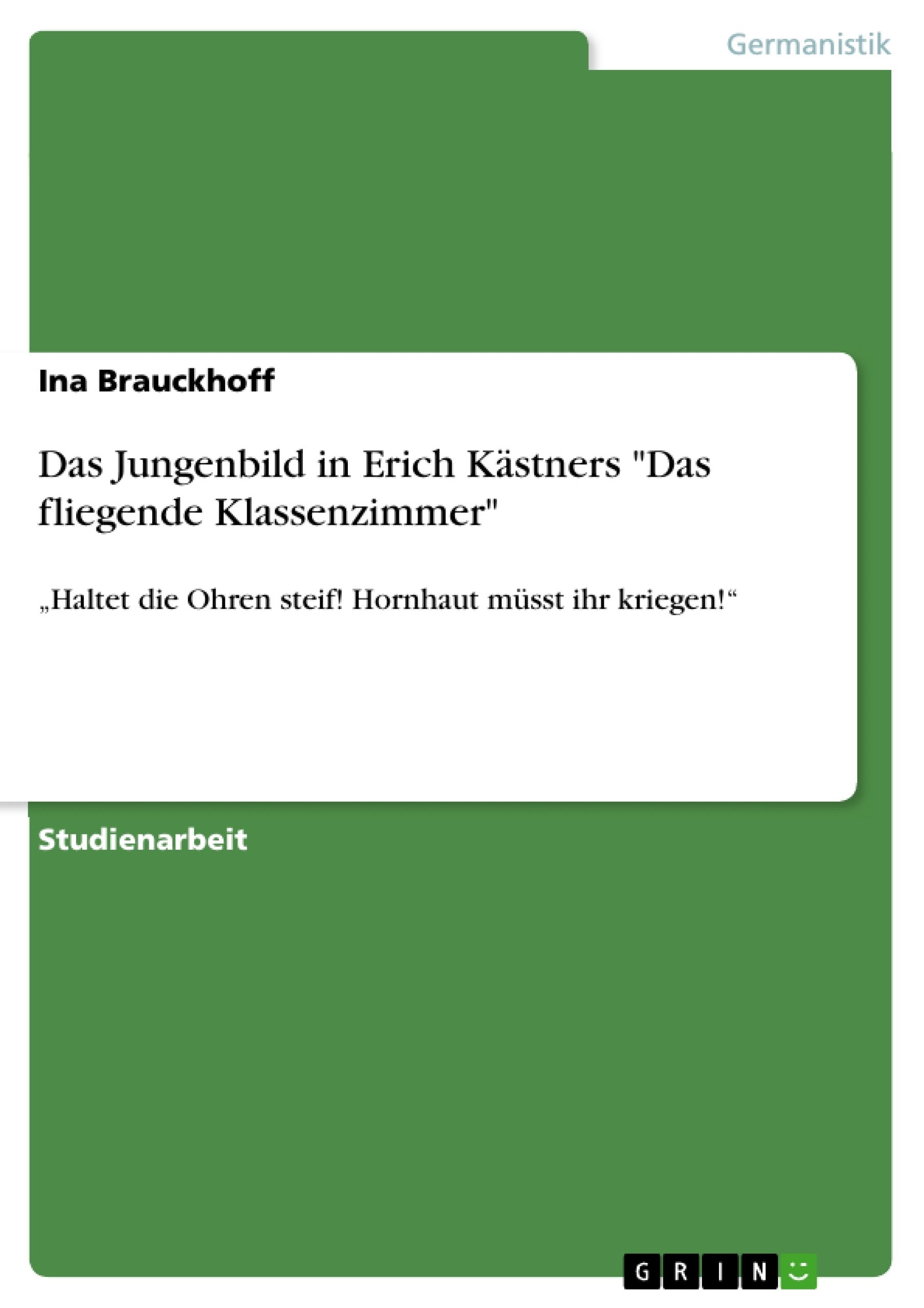„Haltet die Ohren steif! Hornhaut müsst ihr kriegen! Ihr sollt hart im Nehmen werden […]. Ihr sollt lernen, Schläge einzustecken und zu verdauen.“
Mit diesem Appell wendet sich Erich Kästner im Vorwort an die Leser des Kinderbuchs „Das fliegende Klassenzimmer“. Eine pädagogische Maxime, die Marianne Bäumler als „defensive Konfliktvermeidungsstrategie“ bezeichnet. „Selbstbeherrschung um den Preis eigensinniger Widerstandsfähigkeit fordert Kästner als vorzeigbare Tugend; genau so zielt auch sein oft belehrender Erzählton auf eine Konditionierung zu probatem Stillhalten ab.“
Welches Jungenbild vermittelt Kästner in „Das fliegende Klassenzimmer“? Wie verhalten sich die Jungen in Interaktion innerhalb der Gruppe, im Zusammensein mit Erwachsen und wenn sie allein sind? Welche Tugenden propagiert Kästner und welche erzieherische Absicht scheint sich dahinter zu verbergen? Wie ist sein Jungenbild in Hinblick auf die gesellschaftlichen Zusammenhänge der Weimarer Republik zu verstehen?
Diesen Fragen möchte ich in meiner Arbeit nachgehen.
Ich werde zuerst einige Hintergrundinformationen zur Entstehungszeit des Kinderbuchs geben, im Hauptteil der Arbeit eine Analyse in Hinblick auf die oben genannten Fragen durchführen und zuletzt Rückschlüsse auf Kästners Jungenbild und die beabsichtigten Wirkungen seines Werks ziehen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Entstehungszeit des Kinderromans „Das fliegende Klassenzimmer“
- Analyse des Jungenbilds in „Das fliegende Klassenzimmer“
- Die Hauptfiguren
- Die Hierarchie innerhalb der homogenen Jungengruppe
- Die Rolle der Erwachsenen
- Konditionierung zum Stillhalten
- Das von Kästner entworfene Jungenbild
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Jungenbild in Erich Kästners "Das fliegende Klassenzimmer", indem sie die Interaktionen der Jungen untereinander, mit Erwachsenen und in alleinigen Situationen analysiert. Es werden Kästners propagierte Tugenden und die dahinterliegenden erzieherischen Absichten beleuchtet, sowie der Kontext der Weimarer Republik berücksichtigt. Aufgrund des begrenzten Umfangs werden Themen wie der Bezug zur Jugendbewegung oder das bürgerliche Selbstverständnis nur am Rande gestreift.
- Das Jungenbild in "Das fliegende Klassenzimmer"
- Interaktionen der Jungen innerhalb der Gruppe und mit Erwachsenen
- Kästners erzieherische Intentionen und propagierte Tugenden
- Der gesellschaftliche Kontext der Weimarer Republik
- Die Darstellung von Konflikten und deren Bewältigung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und benennt die Forschungsfragen, die im Laufe der Arbeit beantwortet werden sollen. Der Fokus liegt auf der Analyse des Jungenbildes in Kästners Roman, unter Berücksichtigung der Interaktionen der Jungen untereinander, mit Erwachsenen und in einsamen Situationen. Die Arbeit untersucht Kästners propagierte Tugenden und die dahinterliegende pädagogische Absicht im Kontext der Weimarer Republik. Einige relevante Themen, wie der Zusammenhang zur Jugendbewegung, werden aufgrund des begrenzten Umfangs nur am Rande erwähnt.
Die Entstehungszeit des Kinderromans „Das fliegende Klassenzimmer“: Dieses Kapitel beleuchtet den Entstehungskontext des Romans im Kontext der späten Weimarer Republik. Es beschreibt die gesellschaftlichen und politischen Umbrüche dieser Zeit und deren Einfluss auf Kästners Werk. Die sich widersprechenden Wertvorstellungen zwischen traditionellen und modernen Ideen werden hervorgehoben, sowie Kästners Ziel, die nachfolgende Generation durch seine Bücher zu beeinflussen und an den bestehenden Status Quo anzupassen. Der Fokus liegt dabei auf der Zielgruppe bürgerlicher Jungen und dem Bedürfnis nach neuen Vorbildern in einer Zeit gesellschaftlicher Veränderungen.
Analyse des Jungenbilds in „Das fliegende Klassenzimmer“: Dieser Abschnitt analysiert die Darstellung der Jungenfiguren im Roman. Es werden die Hauptfiguren vorgestellt, ihre Charaktereigenschaften beschrieben und deren Beziehungen zueinander untersucht. Der Kampf gegen die Realschüler, Martins Sorgen und Ulis Mutprobe werden als zentrale Handlungsstränge hervorgehoben und analysiert. Die Analyse berücksichtigt die unterschiedlichen Charaktere, ihre Stärken und Schwächen, sowie die Hierarchie innerhalb der Gruppe und die Rolle der Erwachsenen. Es wird untersucht, wie Kästner bestimmte Verhaltensweisen und Tugenden fördert und welche erzieherische Absicht dahintersteckt.
Schlüsselwörter
Erich Kästner, Das fliegende Klassenzimmer, Jungenbild, Weimarer Republik, Kinderliteratur, Erziehung, pädagogische Intention, Jugendliteratur, Charakteranalyse, gesellschaftlicher Kontext.
Erich Kästner: "Das fliegende Klassenzimmer" - Häufige Fragen (FAQ)
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert das Jungenbild in Erich Kästners Roman "Das fliegende Klassenzimmer". Sie untersucht die Interaktionen der Jungen untereinander, mit Erwachsenen und in einsamen Situationen, beleuchtet Kästners erzieherische Absichten und propagierte Tugenden und betrachtet den Kontext der Weimarer Republik. Themen wie der Bezug zur Jugendbewegung werden aufgrund des begrenzten Umfangs nur am Rande behandelt.
Welche Kapitel beinhaltet die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel über die Entstehungszeit des Romans im Kontext der Weimarer Republik, eine detaillierte Analyse des Jungenbildes in "Das fliegende Klassenzimmer" und eine Zusammenfassung der Schlüsselwörter.
Was wird in der Einleitung behandelt?
Die Einleitung führt in die Thematik ein und benennt die Forschungsfragen. Der Fokus liegt auf der Analyse des Jungenbildes unter Berücksichtigung der Interaktionen der Jungen und dem pädagogischen Hintergrund im Kontext der Weimarer Republik.
Worauf konzentriert sich das Kapitel über die Entstehungszeit des Romans?
Dieses Kapitel beleuchtet den Entstehungskontext des Romans in der späten Weimarer Republik, beschreibt die gesellschaftlichen und politischen Umbrüche und deren Einfluss auf Kästners Werk. Es hebt widersprüchliche Wertvorstellungen hervor und betrachtet Kästners Ziel, die nachfolgende Generation zu beeinflussen.
Wie wird das Jungenbild in "Das fliegende Klassenzimmer" analysiert?
Dieser Abschnitt analysiert die Darstellung der Jungenfiguren, beschreibt ihre Charaktereigenschaften und Beziehungen. Zentrale Handlungsstränge wie der Kampf gegen die Realschüler werden hervorgehoben. Die Analyse betrachtet die Hierarchie innerhalb der Gruppe und die Rolle der Erwachsenen, sowie die erzieherische Absicht Kästners.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Die Arbeit wird durch folgende Schlüsselwörter beschrieben: Erich Kästner, Das fliegende Klassenzimmer, Jungenbild, Weimarer Republik, Kinderliteratur, Erziehung, pädagogische Intention, Jugendliteratur, Charakteranalyse, gesellschaftlicher Kontext.
Welche Aspekte des Jungenbildes werden besonders untersucht?
Die Arbeit untersucht die Hauptfiguren, die Hierarchie innerhalb der homogenen Jungengruppe, die Rolle der Erwachsenen und die Konditionierung zum Stillhalten, um das Jungenbild in Kästners Roman umfassend zu analysieren.
Welche erzieherischen Intentionen Kästners werden beleuchtet?
Die Arbeit beleuchtet die von Kästner propagierten Tugenden und die dahinterliegenden erzieherischen Absichten, die im Kontext der Weimarer Republik zu verstehen sind.
- Quote paper
- Ina Brauckhoff (Author), 2006, Das Jungenbild in Erich Kästners "Das fliegende Klassenzimmer", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/92202