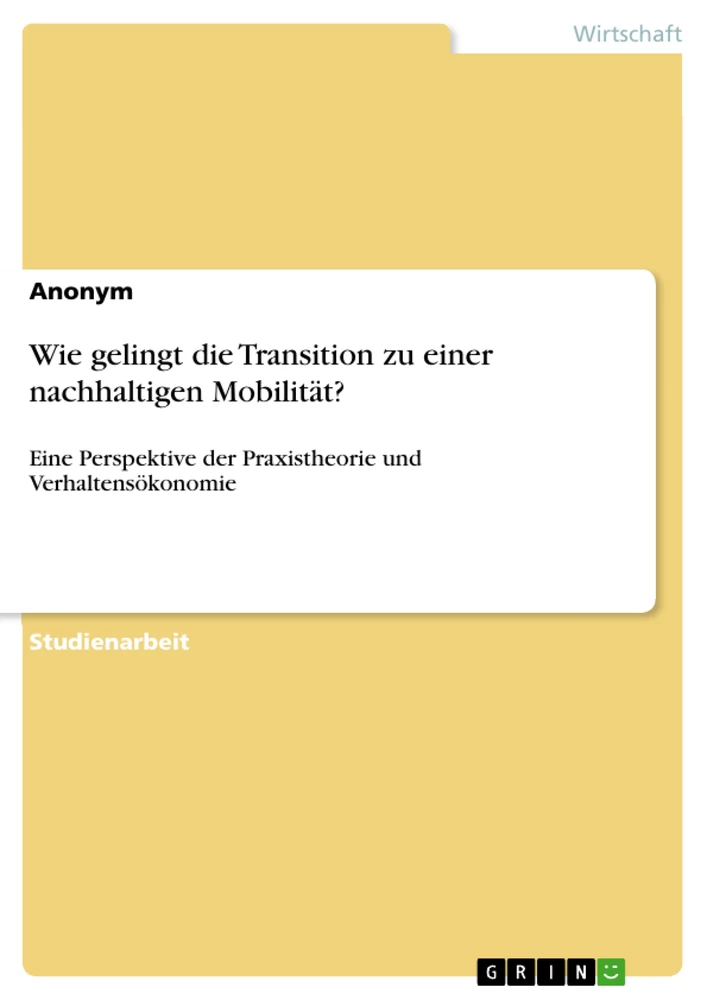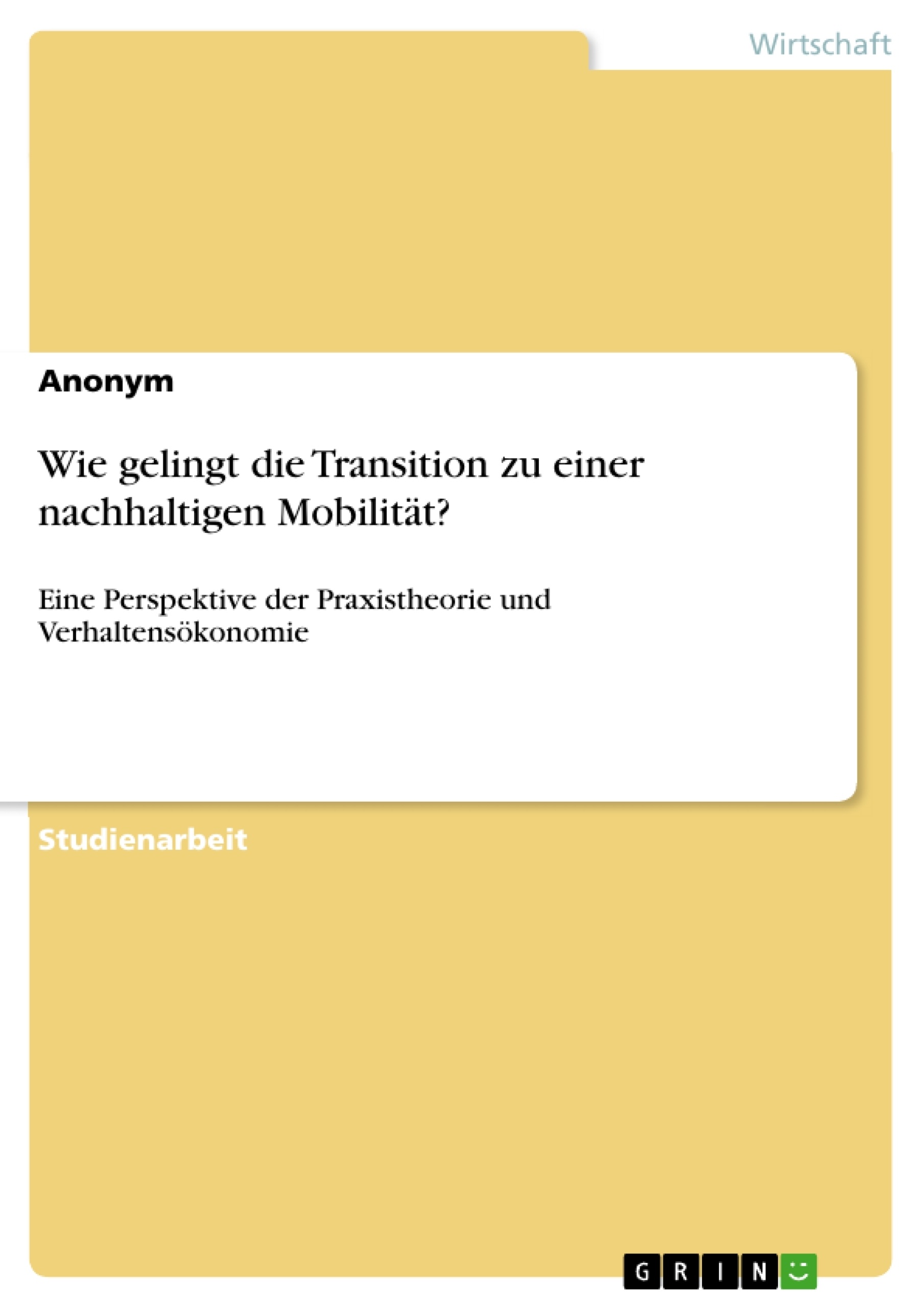Wie kann der modal shift zu nachhaltigen Verkehrsträgern im Individualverkehr aus der Perspektive von Praxistheorie und Verhaltensökonomie gelingen?
Das Ziel der Arbeit ist es, das Verhalten im Bereich der Mobilität bezüglich der verschiedenen Verkehrsträger mithilfe verschiedener theoretischer Ansätze zu untersuchen und Ausblicke auf mögliche Nachhaltigkeitstransitionen auf Grundlage der theoretischen Basis zu geben.
Da es von diversen Faktoren abhängt, ob Individuen sich für das Automobil, das Fahrrad, den öffentlichen Nahverkehr oder andere Formen der Mobilität entscheiden sollen diese Entscheidungen anhand von praxistheoretischen und verhaltensökonomischen Ansätzen analysiert werden, um eine möglichst breite Perspektive auf das Thema zu ermöglichen. Hierfür sollen die Ansätze der Praxistheorie und Verhaltensökonomie skizziert und anschließend mit der Fragestellung in Beziehung gesetzt werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretische Grundlagen
- 2.1. Praxistheorie
- 2.2 Praxistheorie und Mobilität
- 2.3 Verhaltensökonomie
- 2.4 Verhaltensökonomie und Mobilität
- 3. Zusammenfassung, Diskussion und Ausblick
- 4. Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Mobilitätsverhalten hinsichtlich verschiedener Verkehrsmittel unter Anwendung praxistheoretischer und verhaltensökonomischer Ansätze. Ziel ist es, Möglichkeiten für eine nachhaltige Mobilitätstransition aufzuzeigen. Die Analyse konzentriert sich auf die Verlagerung des Individualverkehrs auf nachhaltige Alternativen.
- Analyse des Mobilitätsverhaltens anhand praxistheoretischer und verhaltensökonomischer Modelle
- Untersuchung der Faktoren, die die Wahl des Verkehrsmittels beeinflussen
- Bewertung des Potenzials von nachhaltigen Mobilitätslösungen
- Herausarbeitung der Rolle von Praktiken und Routinen im Mobilitätsverhalten
- Diskussion der Grenzen staatlicher Eingriffe in die Gestaltung nachhaltiger Mobilität
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema nachhaltige Mobilität ein und hebt die Bedeutung des motorisierten Individualverkehrs und des Flugverkehrs als nicht-nachhaltige Verkehrsmittel hervor. Sie definiert die zentrale Forschungsfrage: Wie kann eine Verlagerung des Individualverkehrs auf nachhaltige Verkehrsmittel aus der Perspektive der Praxistheorie und Verhaltensökonomie gelingen? Das Ziel der Arbeit wird als Untersuchung des Mobilitätsverhaltens mit Hilfe verschiedener theoretischer Ansätze und die Ableitung von Ausblicken auf mögliche Nachhaltigkeitstransitionen formuliert. Die Einleitung betont die Komplexität der Entscheidungsfindung im Bereich der Mobilität und kündigt die Anwendung praxistheoretischer und verhaltensökonomischer Ansätze an, um eine umfassende Perspektive zu ermöglichen.
2. Theoretische Grundlagen: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen der Arbeit dar. Es beschreibt zunächst die Praxistheorie, wobei die Ansätze von Bourdieu, Giddens und Schatzki vorgestellt und miteinander verglichen werden. Besondere Aufmerksamkeit wird der Bedeutung alltäglicher, oft unreflektierter Praktiken für den Ressourcenverbrauch gewidmet, wie am Beispiel des täglichen Pendelns mit dem PKW verdeutlicht wird. Kritisiert wird der sogenannte ABC-Ansatz, der den Fokus auf individuelle Einstellungen legt, anstatt auf die systemische Veränderung von Praktiken. Der Abschnitt über die Verhaltensökonomie ist (im vorliegenden Auszug) noch nicht vorhanden. Das Kapitel endet mit einer Diskussion der Anwendung der Praxistheorie auf den Bereich der Mobilität und betont die Notwendigkeit, die Beziehungen zwischen etablierten Praktiken und den sie beeinflussenden Faktoren (Märkte, Technologien, Werte, Infrastrukturen) zu betrachten.
Schlüsselwörter
Nachhaltige Mobilität, Praxistheorie, Verhaltensökonomie, Modal Shift, Individualverkehr, Ressourcenverbrauch, Nachhaltigkeitstransition, soziale Praktiken, Routinen, staatliche Interventionen.
Häufig gestellte Fragen zu: Nachhaltige Mobilität - Praxistheoretische und verhaltensökonomische Ansätze
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht das Mobilitätsverhalten im Hinblick auf nachhaltige Verkehrsmittel. Sie analysiert die Verlagerung des Individualverkehrs auf nachhaltige Alternativen unter Anwendung praxistheoretischer und verhaltensökonomischer Ansätze.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Ziel ist es, Möglichkeiten für eine nachhaltige Mobilitätstransition aufzuzeigen. Die Arbeit analysiert das Mobilitätsverhalten anhand der genannten theoretischen Modelle, untersucht die Faktoren, die die Verkehrsmittelwahl beeinflussen, bewertet das Potential nachhaltiger Lösungen und diskutiert die Rolle von Praktiken und Routinen sowie die Grenzen staatlicher Eingriffe.
Welche theoretischen Ansätze werden verwendet?
Die Arbeit verwendet praxistheoretische und verhaltensökonomische Ansätze. Im Detail werden verschiedene Praxistheorien (Bourdieu, Giddens, Schatzki) vorgestellt und verglichen. Kritisiert wird dabei der ABC-Ansatz, der zu stark auf individuelle Einstellungen fokussiert. Die Verhaltensökonomie wird im vorliegenden Auszug noch nicht ausführlich behandelt.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zu den theoretischen Grundlagen (Praxistheorie und Verhaltensökonomie), eine Zusammenfassung, Diskussion und Ausblick sowie ein Literaturverzeichnis. Die Einleitung definiert die zentrale Forschungsfrage und das Ziel der Arbeit. Das Kapitel zu den theoretischen Grundlagen beschreibt die verwendeten Ansätze und deren Anwendung auf das Thema Mobilität.
Welche Kapitel gibt es und worum geht es darin?
Kapitel 1 (Einleitung): Einführung in das Thema nachhaltige Mobilität, Definition der Forschungsfrage (Verlagerung des Individualverkehrs auf nachhaltige Alternativen), Formulierung des Arbeitsziels und Beschreibung der angewandten Methoden. Kapitel 2 (Theoretische Grundlagen): Darstellung der Praxistheorie (Bourdieu, Giddens, Schatzki), Vergleich der Ansätze, Kritik am ABC-Ansatz und Anwendung der Praxistheorie auf Mobilität. Die Verhaltensökonomie wird hier nur angedeutet. Kapitel 3 (Zusammenfassung, Diskussion und Ausblick): Zusammenfassung der Ergebnisse, Diskussion der Ergebnisse im Kontext der Fragestellung und Ausblick auf zukünftige Forschungsfragen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Nachhaltige Mobilität, Praxistheorie, Verhaltensökonomie, Modal Shift, Individualverkehr, Ressourcenverbrauch, Nachhaltigkeitstransition, soziale Praktiken, Routinen, staatliche Interventionen.
Was ist die zentrale Forschungsfrage?
Wie kann eine Verlagerung des Individualverkehrs auf nachhaltige Verkehrsmittel aus der Perspektive der Praxistheorie und Verhaltensökonomie gelingen?
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2020, Wie gelingt die Transition zu einer nachhaltigen Mobilität?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/922022