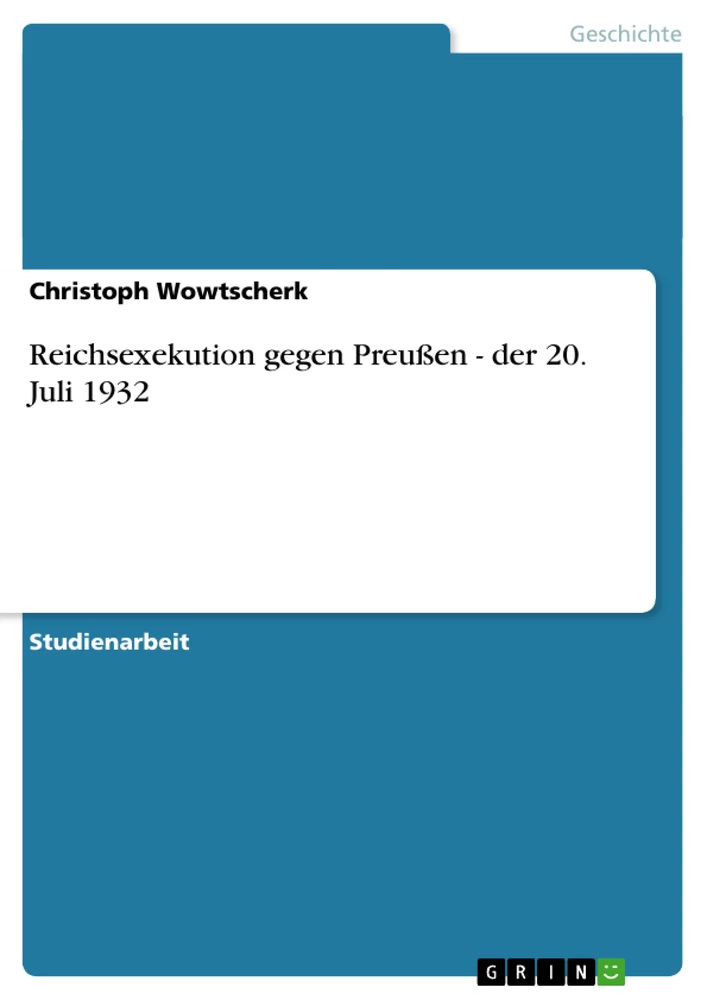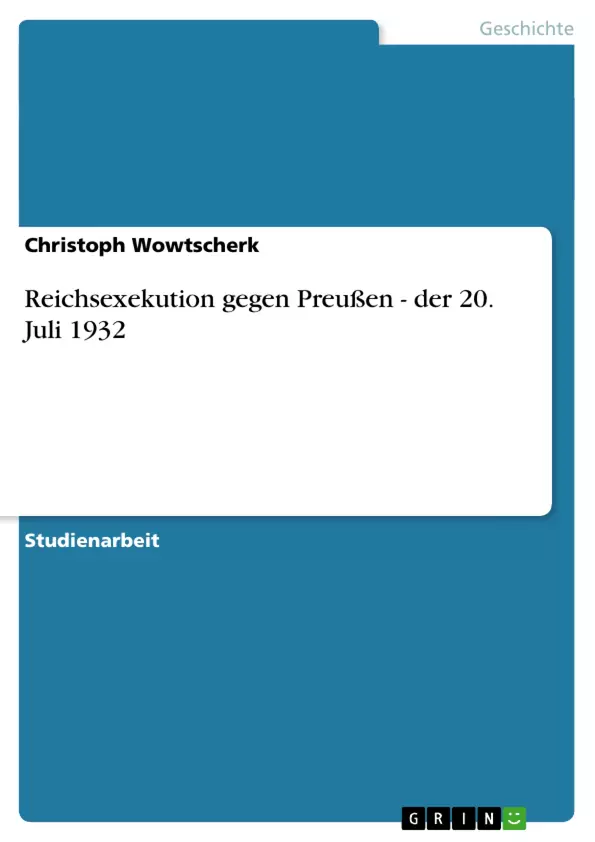Während der Weimarer Republik galt Preußen als „Bollwerk der Demokratie“: Hier gab es meist stabile Regierungen auf demokratischer Mehrheitsbasis, der Beamtenapparat wurde nach dem Kapp-Putsch demokratisch umgestaltet. Somit herrschte über fast der gesamten Dauer der Republik über zwei Drittel des Reichsgebietes eine feste, demokratische Regierung. Ihr gegenüber stand die Reichsregierung. Sie wollte das ganze Reich beherrschen, war aber auf die preußische Regierung zur Durchführung ihrer Anweisungen angewiesen. Als zum Ende der Republik zunehmend rechte Strömungen die Reichspolitik bestimmte, wuchs dieser Gegensatz zu einer Spannung heraus. Dieser Konflikt wurde am 20. Juli 1932 dahingegen gelöst, dass mit Hilfe einer Einsetzung eines Reichskommissars Preußen und das Reich quasi gleichgeschaltet wurden.
Um die ausdauernden Bemühungen der Papenregierung, Preußen unter seine Kontrolle zu bringen, zu veranschauliche, sollen zunächst detailliert die Ereignisse beginnend mit der Änderung der Geschäftsordnung des preußischen Landtags bis einschließlich des 20. Julis geschildert werden. Im Anschluss daran wird der Frage, warum die abgesetzte Regierung keinen gewaltsamen Widerstand leistete, Beachtung geschenkt. Zum Schluss sollen kurz die Folgen der Reichsexekution dargestellt werden. Diese Arbeit will besonderen Augenmerk auf die Motive Papens legen.
Der sog. Preußenschlag, wie die gesamte Epoche der Weimarer Republik, ist Gegenstand zahlreicher Publikationen gewesen. Die angegebene Literatur soll nur einen Einblick geben. Am 24. April 1932 standen in Preußen Landtagswahlen an. In der Befürchtung, die Wahl könne eine relative Mehrheit der äußersten Rechten und somit einen NSDAP- Ministerpräsident ergeben, änderte die Regierung Braun am letzten Sitzungstag des Parlamentes am 12. April die Geschäftsordnung des Landtages . Bisher hatte es in Paragraph 20 „Der Landtag wählt mit verdeckten Stimmzetteln den Ministerpräsidenten“ in den Absätzen eins und zwei geheißen: „[…]Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhält. Ergibt sich keine solche Mehrheit, so kommen die beiden Anwärter mit den höchsten Stimmenzahlen in die engere Wahl […]“. Das heißt nichts anderes, als das im ersten Wahlgang zur Ministerpräsidentenwahl die absolute Mehrheit der abgegebenen Stimmen, im zweiten jedoch nur eine relative von Nöten war.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Weg zum 20. Juli
- Die Lage in Preußen nach der Landtagswahl 1932
- Papen gegen Preußen
- Die Vorbereitungen zum 20. Juli
- Die Absetzung der geschäftsführenden Regierung Braun
- Die Ereignisse am 20. Juli
- Warum es keinen Widerstand gab
- Nachspiel
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit befasst sich mit der Reichsexekution gegen Preußen am 20. Juli 1932. Ziel ist es, die Ereignisse, die zu diesem Schritt führten, zu analysieren und die Hintergründe der Absetzung der preußischen Regierung unter Otto Braun aufzuzeigen. Im Mittelpunkt steht dabei die Rolle des Reichskanzlers Franz von Papen und seine Motive, Preußen unter die Kontrolle des Reiches zu bringen. Darüber hinaus wird der Frage nachgegangen, warum es keinen Widerstand gegen die Absetzung gab.
- Die politische Situation in Preußen nach der Landtagswahl 1932
- Die Rolle des Reichskanzlers Franz von Papen bei der Reichsexekution
- Die Absetzung der preußischen Regierung unter Otto Braun
- Der fehlende Widerstand gegen die Reichsexekution
- Die Folgen der Reichsexekution für Preußen und das Deutsche Reich
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den historischen Kontext und den Konflikt zwischen Reich und Preußen in der Weimarer Republik beleuchtet. Anschließend wird der Weg zum 20. Juli detailliert beschrieben, wobei die Situation in Preußen nach der Landtagswahl 1932, die Rolle von Papen und die Vorbereitungen zur Reichsexekution im Fokus stehen. Der dritte Abschnitt beschäftigt sich mit den Ereignissen am 20. Juli selbst und der Absetzung der Regierung Braun, sowie der Frage nach den Gründen für den fehlenden Widerstand. Schließlich werden im Nachspiel die Folgen der Reichsexekution kurz dargestellt.
Schlüsselwörter
Reichsexekution, Preußen, Weimarer Republik, Otto Braun, Franz von Papen, NSDAP, Landtagswahl 1932, politische Krise, Machtverschiebung, Demokratie, Widerstand, Folgen.
Häufig gestellte Fragen
Was war der "Preußenschlag" vom 20. Juli 1932?
Es war die Absetzung der demokratischen preußischen Regierung durch Reichskanzler Franz von Papen mittels eines Reichskommissars, was Preußen faktisch gleichschaltete.
Warum galt Preußen als "Bollwerk der Demokratie"?
In Preußen herrschten über fast die gesamte Dauer der Weimarer Republik stabile demokratische Mehrheiten, während die Reichsregierungen oft instabil waren.
Was waren die Motive von Franz von Papen?
Papen wollte die Kontrolle über den preußischen Staatsapparat und die Polizei gewinnen, um seine autoritäre Reichspolitik ohne Widerstand des größten Bundeslandes durchzusetzen.
Warum leistete die Regierung Braun keinen gewaltsamen Widerstand?
Die Arbeit untersucht die Gründe für das Ausbleiben von Widerstand, zu denen rechtliche Bedenken, die Angst vor einem Bürgerkrieg und die Hoffnung auf ein Urteil des Staatsgerichtshofs gehörten.
Welche Folgen hatte die Reichsexekution für die Republik?
Sie schwächte den Föderalismus und die demokratischen Kräfte massiv und ebnete den Weg für die spätere vollständige Machtübernahme durch die Nationalsozialisten.
- Citar trabajo
- Christoph Wowtscherk (Autor), 2006, Reichsexekution gegen Preußen - der 20. Juli 1932, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/92219