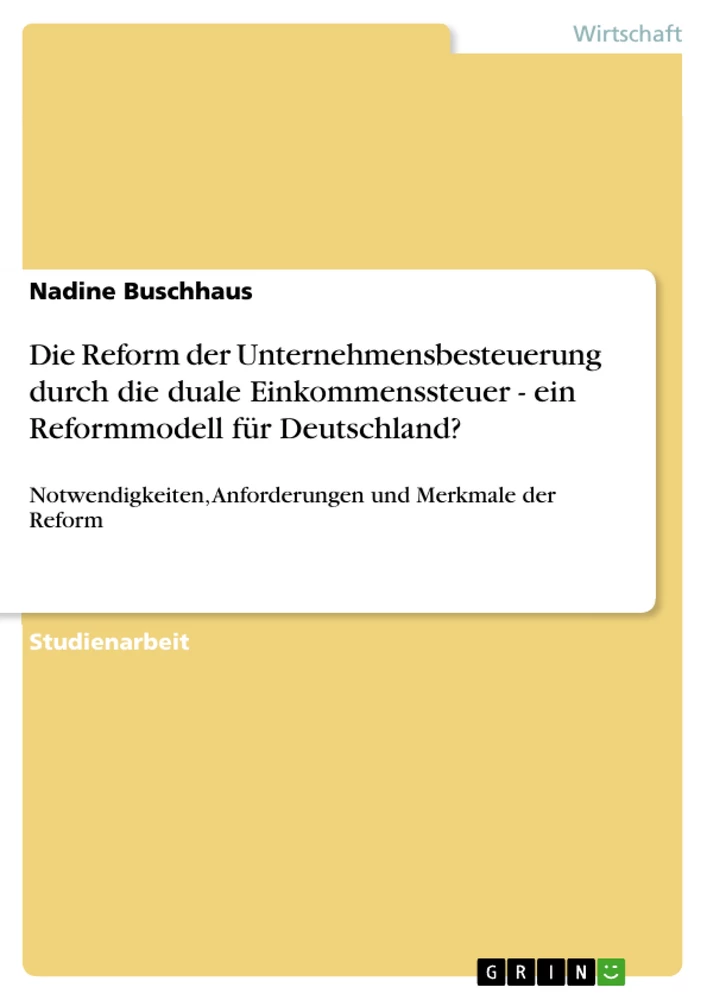In der öffentlichen Debatte um aktuelle steuerpolitische Reformkonzepte hat vor allem das Reformmodell von Paul Kirchhof eine große Rolle gespielt. Das Reformmodell einer Dualen Einkommenssteuer des Sachverständigenrates ist hingegen eher in den Hintergrund getreten und so erregte auch die Zusage der Regierung, eine Grundsatzentscheidung zwischen synthetischer und dualer Einkommensbesteuerung zu treffen, wenig Aufmerksamkeit. Trotzdem und gerade deshalb erscheint es notwendig, das vorgelegte Steuermodell des Sachverständigenrates einer kritischen Analyse zu unterziehen. Inwieweit erreicht der Vorschlag die selbst gesteckten Reformziele, und werden mit der Reform die steuerlichen Rahmenbedingungen am Standort Deutschland wirklich verbessert? Im Folgenden geht es darum diese Fragen zu klären, wobei zunächst ein theoretischer Zugang zum Problem gewählt wird. Nach einer Analyse der Reformnotwendigkeit, die sich aus Sicht des Sachverständigenrates ergibt, werden die Anforderungen, die an ein modernes Steuersystem gestellt werden, näher beleuchtet. Was versteht man in der einschlägigen Literatur unter „gerechter Besteuerung“? Was besagt das „Postulat der Entscheidungsneutralität“ und was bedeutet Investitions-, Finanzierungs- und Rechtsformneutralität? Anschließend wird dann die Reform der Unternehmensbesteuerung durch die duale Einkommenssteuer erläutert. Im Vordergrund dabei steht die Besteuerung der Kapitalgesellschaften und der Personenunternehmen. Wie sollen Kapitalgesellschaften laut Sachverständigenrat besteuert werden? Wie sieht das Grundkonzept der Gewinnspaltung im Bereich der Personenunternehmen aus? Im Anschluss der Analyse dieser Fragen wird – im Sinne der Anforderungen, die sich an ein modernes Steuersystem ergeben – zunächst die Umsetzung der verfassungsrechtlichen Grundsätze betrachtet. Ist die Gleichbehandlung der Steuerpflichtigen gewährleistet? Anschließend wird die Umsetzung der Neutralitätspostulate näher analysiert. Abschließend soll dann untersucht werden, inwieweit das Reformmodell des Sachverständigenrates ein Reformmodell für Deutschland ist. Wie nimmt die deutsche Regierung dieses Reformmodell auf und wie stellt sie sich den Weg aus den Reformbaustellen vor? Gibt es die Notwendigkeit für einen „Wettlauf nach unten“ ? Diese abschließende Diskussion versteht sich als Einstieg in eine Debatte über den politischen Umgang mit einem zunehmenden Steuerwettbewerb, die wohl in Zukunft nicht oft genug geführt werden kann.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung und Fragestellung
- 2. Reformnotwendigkeit
- 3. Anforderungen an ein modernes Steuersystem
- 3.1. Verfassungsrechtliche Anforderungen
- 3.2. Das Ziel der Entscheidungsneutralität
- 3.2.1. Investitions- und Finanzierungsneutralität
- 3.2.2. Rechtsformneutralität
- 3.3. Steuervereinfachung
- 4. Die Reform der Unternehmensbesteuerung – Grundzüge der dualen Einkommenssteuer
- 4.1. Die Besteuerung von Kapitalgesellschaften
- 4.2. Die Besteuerung von Personenunternehmen
- 5. Die Umsetzung der definierten Anforderungen mit Hilfe der Integration der Körperschaftssteuer in die Einkommenssteuer
- 5.1. Verfassungsrechtliche Beurteilung
- 5.2. Die Umsetzung der Neutralitätspostulate
- 5.3. Die steuerliche Vereinfachung
- 6. Der Vorschlag des Sachverständigenrates zur Reform der Unternehmensbesteuerung - ein Reformmodell für Deutschland?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die Notwendigkeit einer Reform der Unternehmensbesteuerung in Deutschland und untersucht das von dem Sachverständigenrat vorgeschlagene Modell der Dualen Einkommenssteuer. Ziel ist es, die Reformziele des Modells im Hinblick auf die Anforderungen an ein modernes Steuersystem zu beurteilen.
- Reformnotwendigkeit des deutschen Steuersystems
- Anforderungen an ein modernes Steuersystem
- Grundzüge der dualen Einkommenssteuer
- Umsetzung der Reformziele im Modell
- Bewertung des Modells als Reformmodell für Deutschland
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Die Einleitung beleuchtet die Notwendigkeit einer Steuerreform in Deutschland und stellt das Reformmodell der dualen Einkommenssteuer des Sachverständigenrates vor.
- Kapitel 2: Die Reformnotwendigkeit wird aus der Sicht des Sachverständigenrates beleuchtet. Dabei werden die Nachteile des bestehenden Halbeinkünfteverfahrens, wie die Förderung der Selbstfinanzierung gegenüber der Fremdfinanzierung und die fehlende Steuergerechtigkeit, dargelegt.
- Kapitel 3: Die Anforderungen an ein modernes Steuersystem werden in drei Kategorien unterteilt: Verfassungsrechtliche Anforderungen, Entscheidungsneutralität und Steuervereinfachung.
- Kapitel 4: Die Grundzüge der dualen Einkommenssteuer werden erläutert. Im Mittelpunkt steht die Besteuerung von Kapitalgesellschaften und Personenunternehmen.
- Kapitel 5: Die Umsetzung der definierten Anforderungen mit Hilfe der Integration der Körperschaftssteuer in die Einkommenssteuer wird untersucht. Dabei werden die verfassungsrechtlichen Grundsätze, die Neutralitätspostulate und die Steuerliche Vereinfachung betrachtet.
Schlüsselwörter
Steuerreform, Unternehmensbesteuerung, duale Einkommenssteuer, Entscheidungsneutralität, Investitions- und Finanzierungsneutralität, Rechtsformneutralität, Steuervereinfachung, Halbeinkünfteverfahren, Sachverständigenrat.
Häufig gestellte Fragen
Was ist eine duale Einkommenssteuer?
Das Modell der dualen Einkommenssteuer sieht vor, Arbeitseinkommen progressiv und Kapitaleinkommen mit einem niedrigeren, proportionalen Steuersatz zu besteuern. Dies soll die Kapitalflucht verhindern und Investitionen fördern.
Warum wird eine Reform der Unternehmensbesteuerung in Deutschland gefordert?
Kritisiert werden vor allem die mangelnde Rechtsformneutralität und die Bevorzugung von Fremdfinanzierung gegenüber Eigenfinanzierung. Das Ziel ist ein Steuersystem, das Investitionsentscheidungen nicht verzerrt.
Was bedeutet „Entscheidungsneutralität“ im Steuerrecht?
Entscheidungsneutralität bedeutet, dass steuerliche Regelungen die wirtschaftlichen Entscheidungen von Unternehmen (z. B. Standortwahl oder Finanzierungsart) nicht beeinflussen sollten, um eine effiziente Allokation von Kapital zu gewährleisten.
Wie sollen Kapitalgesellschaften laut Sachverständigenrat besteuert werden?
Das Reformmodell schlägt eine stärkere Integration der Körperschaftssteuer in die Einkommenssteuer vor, um die steuerliche Belastung über verschiedene Unternehmensformen hinweg anzugleichen.
Was ist das Halbeinkünfteverfahren?
Es handelt sich um das zum Zeitpunkt der Arbeit bestehende Verfahren zur Besteuerung von Dividenden, bei dem nur die Hälfte der Ausschüttungen steuerpflichtig war. Der Sachverständigenrat sah hierin jedoch erhebliche Nachteile für die Steuergerechtigkeit.
- Quote paper
- Nadine Buschhaus (Author), 2006, Die Reform der Unternehmensbesteuerung durch die duale Einkommenssteuer - ein Reformmodell für Deutschland?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/92239