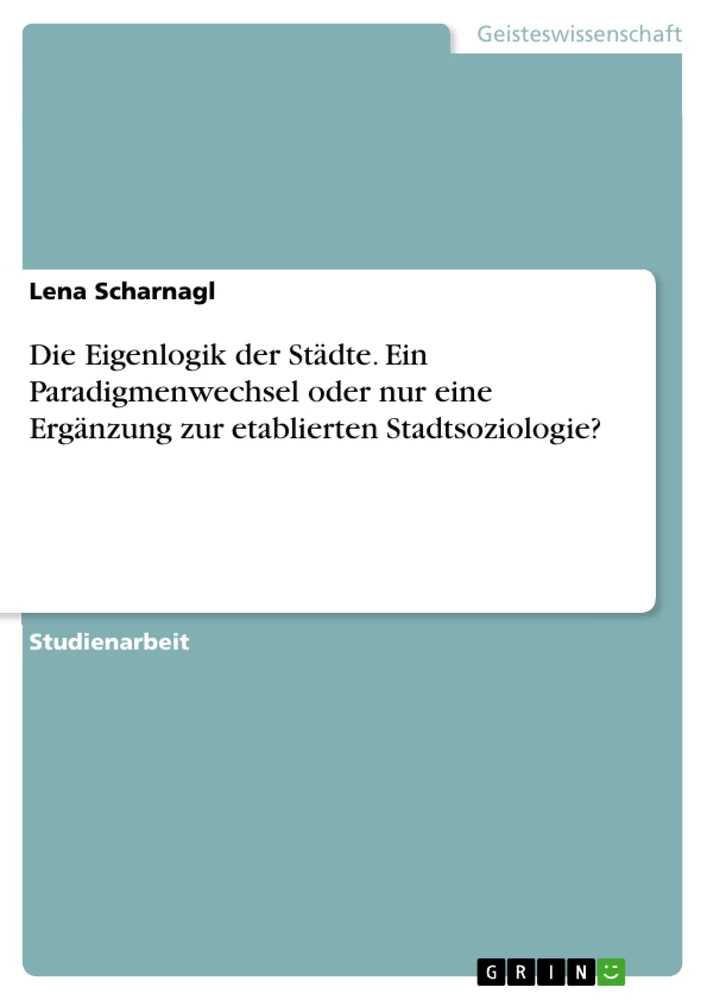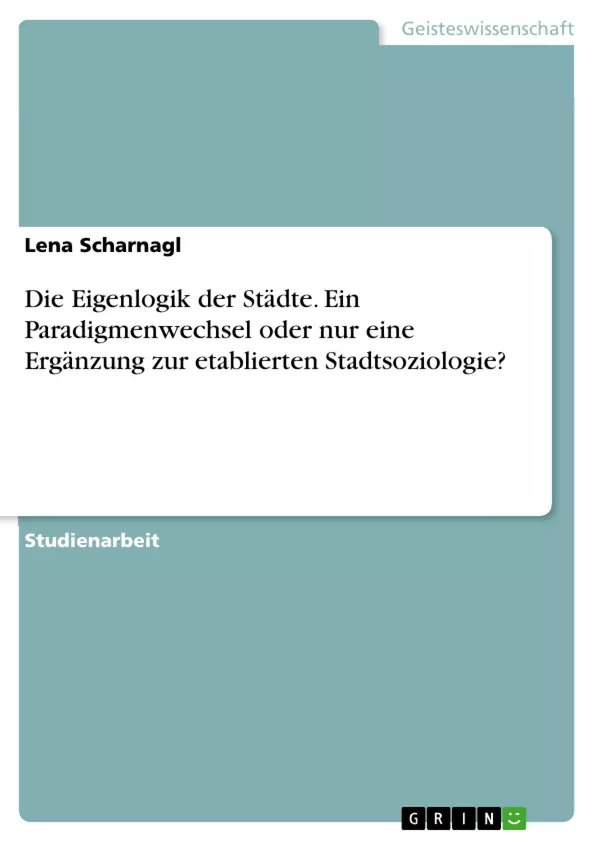Im weiteren Verlauf dieser Arbeit soll der Eigenlogikansatz der Städte genauer definiert und erklärt werden. Außerdem wird eine Fallstudie zur Eigenlogik von München und Frankfurt am Main vorgestellt, um das Eigenlogikkonzept noch ausführlicher zu konkretisieren. Anschließend soll auf die allgemeine Kritik des Eigenlogikkonzepts eingegangen und ein abschließendes Fazit gezogen werden, ob die Eigenlogik einen Paradigmenwechsel bedeutet, oder ob sie nur als Ergänzung für die bisherige Stadtsoziologie gezählt werden kann.
Um die Entstehung des Konzepts der Eigenlogik der Städte besser zu verstehen, soll kurz auf die bisherigen Ansätze der Stadtsoziologie eingegangen werden. Bislang wurde der Fokus in der Stadtsoziologie auf gesellschaftliche Prozesse anstatt auf die "Stadt" selbst gelegt. Bei der "Subsumptionslogik", die von der New Urban Sociology vertreten wird, wird die Stadt der Gesellschaft untergeordnet und dient somit als sekundärer Forschungsgegenstand. Ein anderer Ansatz, bei dem die Stadt nicht im Vordergrund steht, beschreibt die, "Konkretionslogik", die Studien der Chicago School zum Inhalt hat. Dabei wird nicht die Stadt als Ganzes untersucht, sondern das Interesse fällt auf ein bestimmtes Milieu oder eine ,"konkrete Lebenswelt", wie zum Beispiel ein Einwandererviertel.
Bei den beiden Konzepten steht die Stadt nur im Forschungskontext und kann als eine Erforschung der Stadt, ohne diese selbst zu untersuchen, betrachtet werden. Die Stadt als eigenes Forschungsobjekt wirft somit eine neue Perspektive in der Stadtsoziologie auf. Der Raum ist demzufolge mehr als ein Ort, an dem sich gesellschaftliche Prozesse abspielen. Durch die konsistente Beschaffenheit der Infrastruktur und durch die "Heterogenität" zusammenkommender Menschen können verschiedene Differenzen von Städten herausgearbeitet werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung.
- 2 Die Eigenlogik der Städte....
- 3 Eigenlogik der Städte: München und Frankfurt am Main ………………………….
- 4 Kritik der Eigenlogik der Städte.
- 5 Fazit .........
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Konzept der Eigenlogik der Städte und seine Bedeutung für die Stadtsoziologie. Sie analysiert, inwiefern das Konzept einen Paradigmenwechsel darstellt oder ob es lediglich eine Ergänzung zur etablierten Stadtsoziologie bietet.
- Die Entwicklung des Konzepts der Eigenlogik der Städte
- Die Bedeutung der räumlichen Struktur und der städtischen Sinnstrukturen
- Die Rolle von Habitus und Doxa in der Entstehung städtischer Eigenlogiken
- Die empirischen Verfahren zur Untersuchung der Eigenlogik
- Die Bedeutung der Eigenlogik für die Stadtentwicklung und das städtische Leben
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung Dieses Kapitel führt in die Thematik der Eigenlogik der Städte ein und stellt die bisherigen Ansätze der Stadtsoziologie vor, insbesondere die Subsumptionslogik und die Konkretionslogik.
- Kapitel 2: Die Eigenlogik der Städte Dieses Kapitel definiert und erklärt das Konzept der Eigenlogik der Städte und erläutert die drei Perspektiven, die es einschließt: das Thomas-Theorem, die Selbstorganisation des Raumes und die Entstehung kollektiver Routinen.
- Kapitel 3: Eigenlogik der Städte: München und Frankfurt am Main Dieses Kapitel stellt eine Fallstudie zur Eigenlogik von München und Frankfurt am Main vor, um das Konzept der Eigenlogik zu konkretisieren.
Schlüsselwörter
Eigenlogik der Städte, Stadtsoziologie, Subsumptionslogik, Konkretionslogik, Thomas-Theorem, Habitus, Doxa, kumulative Textur, Homologien, städtische Sinnstrukturen, räumliche Form, Stadtentwicklung, städtisches Leben
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet der Begriff „Eigenlogik der Städte“?
Er beschreibt die spezifischen Sinnstrukturen, Routinen und Identitäten einer Stadt, die sie von anderen Städten unterscheiden.
Wie unterscheiden sich München und Frankfurt in ihrer Eigenlogik?
Die Arbeit nutzt diese beiden Städte als Fallstudien, um zu zeigen, wie unterschiedliche Traditionen, Infrastrukturen und soziale Milieus eine eigene „Stadt-Persönlichkeit“ prägen.
Was ist der Unterschied zur klassischen Stadtsoziologie?
Bisherige Ansätze sahen die Stadt oft nur als Ort für allgemeine gesellschaftliche Prozesse; der Eigenlogik-Ansatz macht die Stadt selbst zum primären Forschungsgegenstand.
Welche Rolle spielen „Habitus“ und „Doxa“?
Diese Begriffe beschreiben die verinnerlichten Einstellungen und das als selbstverständlich vorausgesetzte Wissen der Bewohner, die die Eigenlogik ihrer Stadt stützen.
Ist die Eigenlogik ein Paradigmenwechsel?
Die Arbeit diskutiert, ob dieser neue Fokus die bisherige Soziologie ablöst oder lediglich als wertvolle Ergänzung zu verstehen ist.
- Citar trabajo
- Lena Scharnagl (Autor), 2015, Die Eigenlogik der Städte. Ein Paradigmenwechsel oder nur eine Ergänzung zur etablierten Stadtsoziologie?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/922572