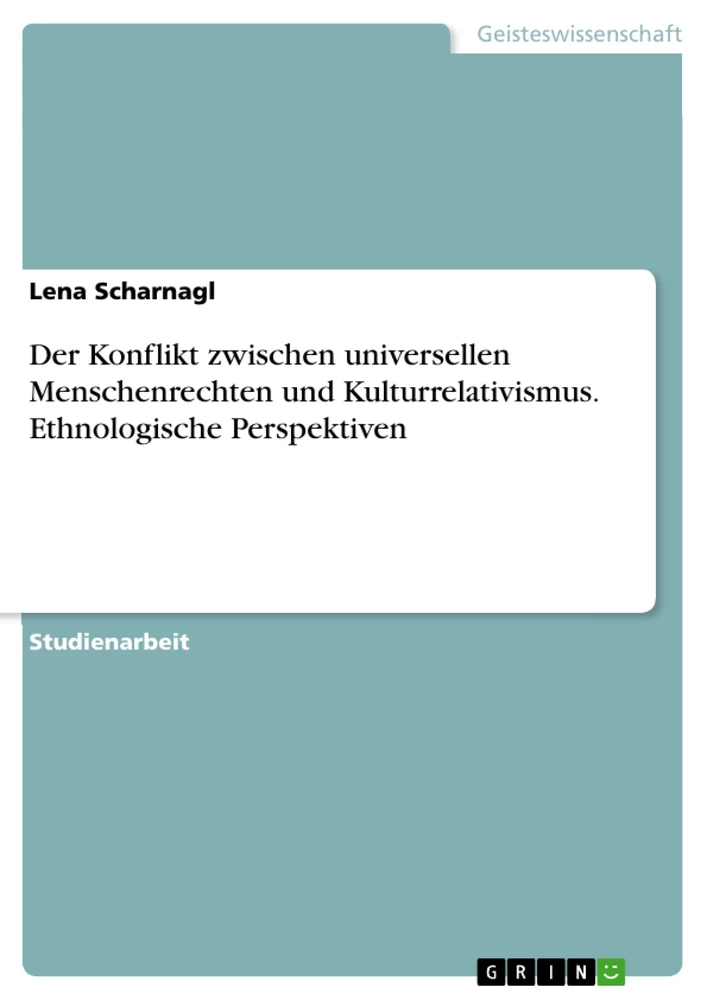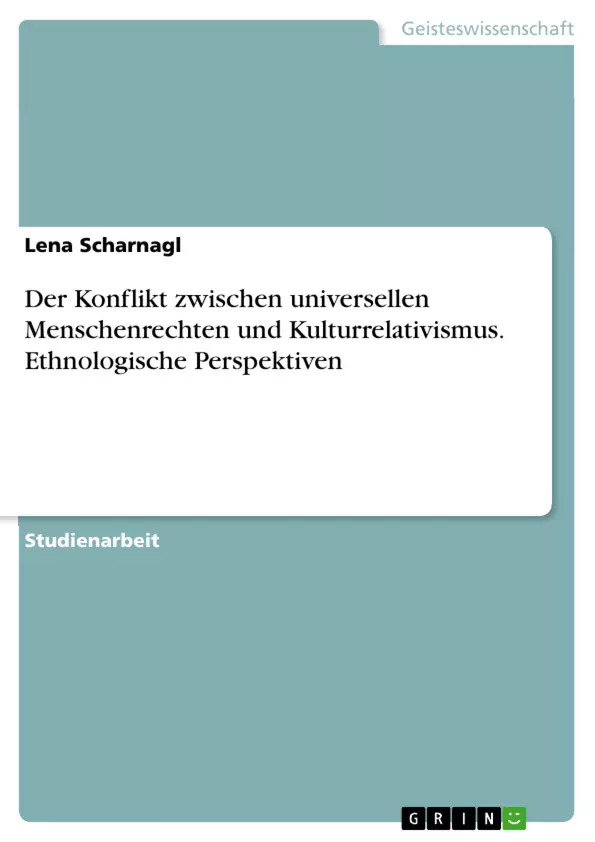Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit folgender Frage: Wie entwickelte und verändert sich die Debatte von universellen Menschenrechten im Gegensatz zu kulturrelativistischen Positionen?
Universelle Menschenrechtsprinzipien tauchen in verschiedenen vergangenen und teilweise heute noch bestehenden Bevölkerungsgruppen auf und sind nicht erst seit heute ein aktuelles Diskussionsthema. Um die Menschenrechte, welche gegenwärtig im internationalen und nationalen Gesetz Bestand sind, zu schützen, kämpften viele Individuen über Jahrtausende für Wohlergehen und Gerechtigkeit. Einige handelten aus religiöser Überzeugung, während die Anderen aufgrund von Verantwortung und Mitgefühl agierten. Bevor die Debatte von universellen Menschenrechten und dem gegenüberstehenden Kulturrelativismus erläutert wird, soll ein kurzer Einblick über menschenrechtliche Gedanken in der Geschichte gegeben werden.
Wichtige Hinweise zu menschenrechtlichem Pflichtgefühl machen sich schon in den Weltreligionen erkennbar. Im Hinduismus wird beispielsweise neben der Unumgänglichkeit moralischen Verhaltens ein gutes Benehmen gegenüber anderen notbedürftigen Personen betont. Jedes einzelne Leben ist zudem ehrwürdig und soll respektiert werden. Neben den Religionen haben menschenrechtliche Ideen frühe Wurzeln in der Philosophie und Kultur. In der griechischen Philosophie entwickelte sich die Grundvorstellung eines Naturrechts, das den gleichen Respekt für alle Bürger zum Inhalt hat. Des Weiteren galt die Gleichberechtigung in politischen Angelegenheiten, welche ein einheitliches Wahlrecht und eine Übereinstimmung aller Bürgerrechte zur Voraussetzung inkludierte. Auch im nationalen Recht können die Grundzüge von Menschenrechten nachverfolgt werden. Eine der ältesten Erfassungen von Rechtssprüchen ist der babylonische Kodex Hammurabi. Auch wenn manche Gesetze, die dort niedergeschrieben wurden, mit den heutigen Menschenrechten unvereinbar wären (wie die Todesstrafe), gibt es viele Vorschriften, die auf menschenrechtliche Werte aufmerksam machen. Zum Beispiel muss den Gefangenen, die Opfer einer Misshandlung gewesen sind, Hilfe geleistet werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Zwei verschiedene Ansätze: Universalismus versus Kulturrelativismus
- 2.1 Die Merkmale des Universalismus
- 2.2 Zum Inhalt des Kulturrelativismus
- 2.3 Unterschiede und Gemeinsamkeiten der beiden Konzepte
- 3. Die Erklärung der Menschenrechte aus Sicht der American Anthropological Association
- 3.1 Die Stellungnahme zu den Menschenrechten im Jahr 1947
- 3.2 Die Äußerung zu den Menschenrechten im Jahr 1999
- 3.3 Die wesentlichen Unterschiede und Kritikpunkte der Erklärungen
- 4. Derzeitige Schwerpunkte in der Ethnologie: Lokale Auffassung von Menschenrechten
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Entwicklung des Konflikts zwischen universellen Menschenrechten und Kulturrelativismus aus ethnologischer Sicht. Ziel ist es, die beiden Konzepte historisch zu definieren, ihre Merkmale zu analysieren und die Unterschiede und Gemeinsamkeiten herauszuarbeiten.
- Die historische Entwicklung des Konflikts zwischen Universalismus und Kulturrelativismus
- Die Merkmale des Universalismus und des Kulturrelativismus
- Die Erklärungen der Menschenrechte durch die American Anthropological Association
- Die lokale Auffassung von Menschenrechten in der Ethnologie
- Die Bedeutung der Berücksichtigung lokaler Perspektiven in der Diskussion um Menschenrechte
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung bietet einen kurzen Überblick über die Geschichte von Menschenrechten und beleuchtet die Präsenz von menschenrechtlichen Gedanken in verschiedenen Kulturen und Epochen.
Kapitel 2 analysiert die Konzepte Universalismus und Kulturrelativismus und beleuchtet deren historische Entwicklung sowie die jeweiligen Inhalte. Es werden die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der beiden Ansätze betrachtet.
Kapitel 3 widmet sich den Erklärungen der Menschenrechte durch die American Anthropological Association in den Jahren 1947 und 1999. Die wichtigsten Unterschiede und Kritikpunkte der Erklärungen werden dargestellt.
Kapitel 4 beleuchtet die aktuellen Schwerpunkte in der Ethnologie, die sich auf die lokale Auffassung von Menschenrechten konzentrieren.
Schlüsselwörter
Menschenrechte, Universalismus, Kulturrelativismus, Ethnologie, American Anthropological Association, Lokale Perspektive, Menschenrechte im lokalen Kontext, Geschichte der Menschenrechte.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Hauptkonflikt zwischen Universalismus und Kulturrelativismus?
Der Universalismus geht davon aus, dass Menschenrechte weltweit für alle gleich gelten, während der Kulturrelativismus argumentiert, dass Rechte im Kontext der jeweiligen Kultur und Tradition gesehen werden müssen.
Wo finden sich historische Wurzeln für menschenrechtliche Gedanken?
Frühe Ansätze finden sich in Weltreligionen (z.B. Hinduismus), der griechischen Philosophie (Naturrecht) und alten Gesetzestexten wie dem babylonischen Kodex Hammurabi.
Wie hat sich die American Anthropological Association (AAA) zu den Menschenrechten geäußert?
Die AAA gab 1947 und 1999 Stellungnahmen ab, die den Wandel in der ethnologischen Sichtweise widerspiegeln – von einer starken Betonung kultureller Unterschiede hin zu einer differenzierteren Betrachtung.
Welche Rolle spielt die lokale Auffassung von Menschenrechten in der Ethnologie?
Moderne Ethnologie untersucht, wie globale Menschenrechtsnormen in lokalen Kontexten verstanden, abgelehnt oder angepasst werden, um universelle Prinzipien mit kultureller Identität zu vereinen.
Warum ist die Berücksichtigung lokaler Perspektiven wichtig?
Ohne lokale Akzeptanz bleiben Menschenrechte oft wirkungslos. Die Berücksichtigung lokaler Werte hilft dabei, den Vorwurf des "Kulturimperialismus" zu entkräften und den Schutz der Individuen zu stärken.
- Citar trabajo
- Lena Scharnagl (Autor), 2016, Der Konflikt zwischen universellen Menschenrechten und Kulturrelativismus. Ethnologische Perspektiven, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/922580