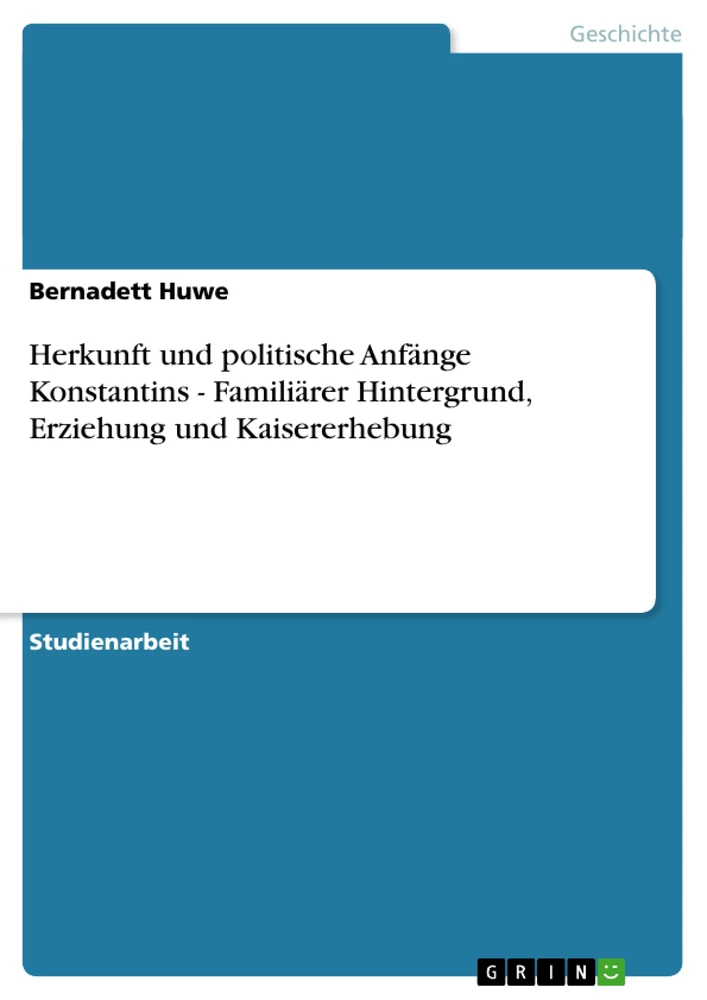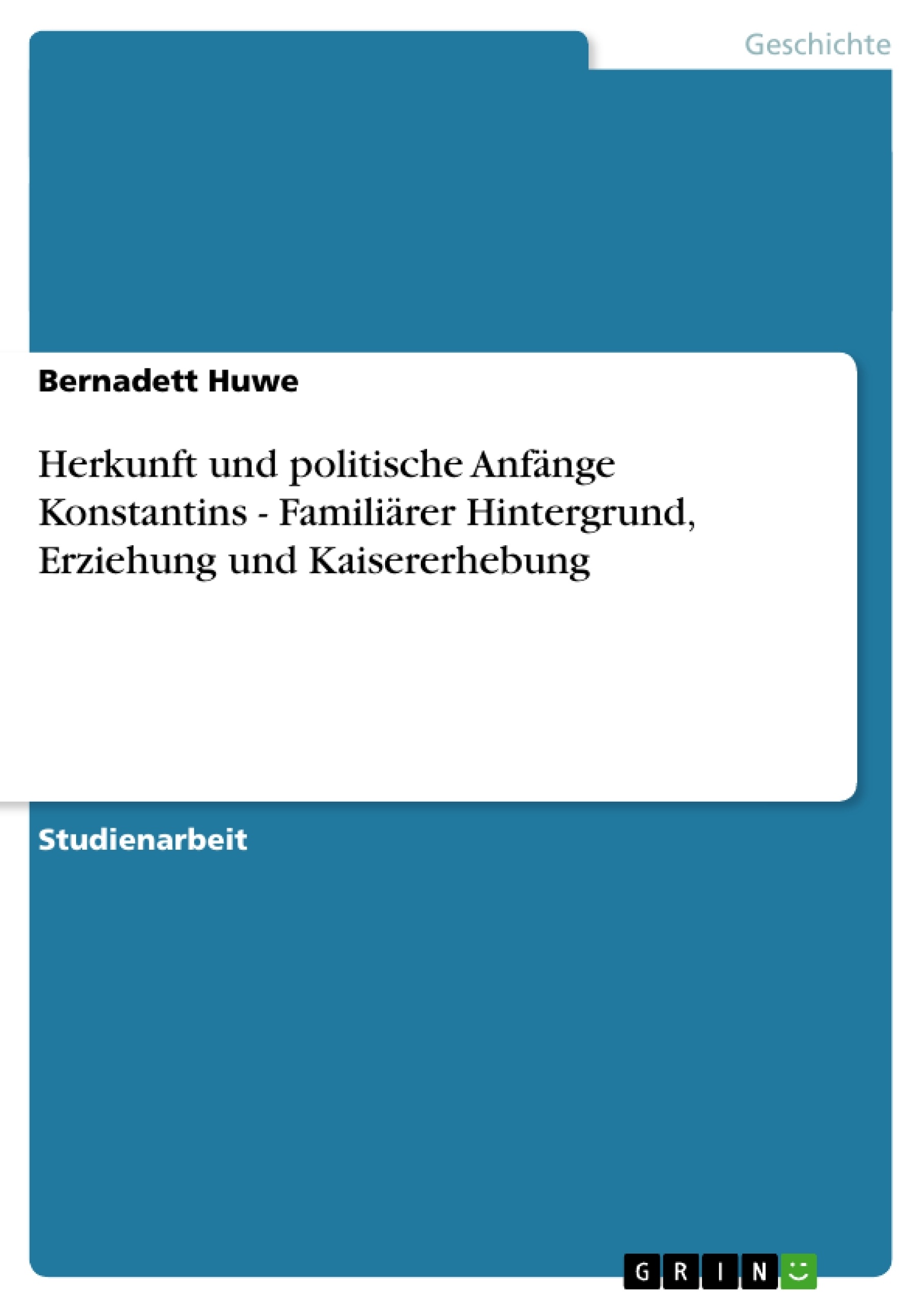Konstantin der Große ist einer der berühmtesten, aber auch einer der umstrittensten
römischen Kaiser. Die Diskussionen reichen vom religiös indifferenten “egoistischen
Machtmenschen“ bis hin zum Herrscher, dem eine besondere Offenbahrung, eine
himmlische Erleuchtung den Weg gewiesen hat.
Die einzige unumstößliche Tatsache ist die, dass er der erste christliche Kaiser war.
Die Religiosität Konstantins steht von jeher im Mittelpunkt jeder literarischen
Auseinandersetzung, soll aber nicht Mittelpunkt dieser Arbeit sein. Ich möchte mich
nach der Herkunft Konstantins mit der Frage auseinandersetzen, inwiefern seine
Kaisererhebung im Jahr 306 eine ältere Traditionslinie fortsetzt. Dabei werde ich
folgendermaßen vorgehen: Beginnend mit dem politischen Werdegang seines Vaters
Constantius Chlorus und seiner Mutter Helena werde ich Konstantins Kindheit und
Jugendzeit nachzeichnen. Mit dem Kapitel der Tradition der Kaisererhebung
während der Soldatenkaiserzeit werde ich die verschiedenen Möglichkeiten des
Herrscherwechsels darstellen, erläutere anschließend den Übergang vom
Doppelkaisertum zur Tetrarchie, um abschließend auf die Kaisererhebung
Konstantins einzugehen.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Hauptteil
- 1. Die Kindheit Konstantins
- 2. Vater und Mutter Konstantins
- 3. Tradition der Kaisererhebung in der Soldatenkaiserzeit
- 4. Vom Doppelkaisertum zur Tetrarchie
- 6. Die Kaisererhebung Konstantins
- III. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Kaisererhebung Konstantins des Großen im Jahr 306 und setzt diese in den Kontext der Traditionen des Herrscherwechsels in der römischen Soldatenkaiserzeit. Im Fokus steht die Frage, inwieweit Konstantins Aufstieg eine Fortsetzung älterer Traditionslinien darstellt.
- Konstantins Kindheit und Jugend
- Der familiäre Hintergrund Konstantins (Vater Constantius Chlorus und Mutter Helena)
- Traditionen der Kaisererhebung in der Soldatenkaiserzeit
- Der Übergang vom Doppelkaisertum zur Tetrarchie
- Die Umstände und Folgen von Konstantins Kaisererhebung
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung stellt Konstantin den Großen als eine umstrittene historische Figur vor, dessen christliche Religiosität zwar zentral ist, aber nicht den Fokus dieser Arbeit darstellt. Stattdessen konzentriert sich die Arbeit auf die Frage, wie Konstantins Kaisererhebung im Jahr 306 die bestehenden Traditionen des Herrscherwechsels fortsetzt. Die Methodik wird skizziert: Beginnend mit dem Werdegang seiner Eltern, wird Konstantins Kindheit und Jugend nachgezeichnet, verschiedene Möglichkeiten des Herrscherwechsels in der Soldatenkaiserzeit beleuchtet und schließlich der Übergang zum Doppelkaisertum und zur Tetrarchie erläutert, um die Kaisererhebung Konstantins zu analysieren.
II. Hauptteil, Kapitel 1. Die Kindheit Konstantins: Dieses Kapitel behandelt die spärlichen und oft widersprüchlichen Quellen über Konstantins frühe Jahre. Der Mangel an zuverlässigen Informationen über seine Kindheit wird betont. Es werden verschiedene Angaben zu seinem vollständigen Namen und seinem Geburtsjahr diskutiert, wobei die Unsicherheiten hervorgehoben werden. Sein Geburtsort Naissus wird hingegen als gesichert dargestellt. Die Ausführungen zu Konstantins Erziehung beleuchten den Widerspruch zwischen einer angeblich höheren Bildung und der Nutzung von Dolmetschern im späteren Leben, was auf begrenzte Griechischkenntnisse hindeutet. Der geringe Kontakt zu seiner Mutter Helena wird im Zusammenhang mit seiner Sprachkompetenz thematisiert. Schließlich wird Konstantins militärische Ausbildung unter Diokletian und Galerius beschrieben, welche ihn an den Hof brachte und an das spätere Kaisertum heranführte.
II. Hauptteil, Kapitel 2. Vater und Mutter Konstantins: Dieses Kapitel porträtiert Konstantins Eltern. Constantius Chlorus, sein Vater, wird als fähiger Offizier und Statthalter beschrieben, der aus bescheidener Herkunft kam. Seine Karriere und Eigenschaften werden detailliert dargestellt. Die Mutter Helena wird als attraktive und kluge Frau geschildert, deren Herkunft jedoch umstritten ist. Die unterschiedlichen Sichtweisen auf ihren sozialen Status werden präsentiert und die außereheliche Beziehung der Eltern wird thematisiert.
Schlüsselwörter
Konstantin der Große, Kaisererhebung, Soldatenkaiserzeit, Doppelkaisertum, Tetrarchie, Constantius Chlorus, Helena, römische Geschichte, Herrscherwechsel, politische Traditionen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Kaisererhebung Konstantins des Großen
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese akademische Arbeit untersucht die Kaisererhebung Konstantins des Großen im Jahr 306 und setzt diese in den Kontext der Traditionen des Herrscherwechsels in der römischen Soldatenkaiserzeit. Der Fokus liegt darauf, inwieweit Konstantins Aufstieg eine Fortsetzung älterer Traditionslinien darstellt. Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, einen Hauptteil mit Kapiteln über Konstantins Kindheit, seine Eltern, die Traditionen der Kaisererhebung in der Soldatenkaiserzeit, den Übergang vom Doppelkaisertum zur Tetrarchie und schließlich Konstantins Kaisererhebung selbst, sowie einen Schluss. Die Arbeit analysiert die verfügbaren Quellen, weist auf deren Lücken und Widersprüche hin und zeichnet ein Bild von Konstantins Weg zum Kaisertum.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit deckt folgende Themen ab: Konstantins Kindheit und Jugend, den familiären Hintergrund (Vater Constantius Chlorus und Mutter Helena), Traditionen der Kaisererhebung in der Soldatenkaiserzeit, den Übergang vom Doppelkaisertum zur Tetrarchie und die Umstände und Folgen von Konstantins Kaisererhebung. Es werden sowohl biographische Aspekte als auch die politischen und historischen Hintergründe beleuchtet.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf die verfügbaren Quellen über Konstantin den Großen, wobei der Mangel an zuverlässigen Informationen über seine Kindheit und Jugend hervorgehoben wird. Die Arbeit diskutiert die vorhandenen, oft widersprüchlichen Angaben zu seinem Namen, Geburtsjahr und seiner Erziehung. Die unterschiedlichen Sichtweisen auf den sozialen Status von Konstantins Mutter Helena werden ebenfalls berücksichtigt.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, einen Hauptteil und einen Schluss. Der Hauptteil ist in mehrere Kapitel unterteilt, die sich jeweils mit einem Aspekt von Konstantins Leben und der Kaisererhebung befassen. Die Einleitung stellt die Forschungsfrage und die Methodik vor. Der Schluss fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche Kapitel gibt es und worum geht es darin?
Kapitel I. Einleitung: Einführung in die Thematik und die Forschungsfrage. Kapitel II. Hauptteil, Kapitel 1. Die Kindheit Konstantins: Analyse der spärlichen Quellen zu Konstantins frühen Jahren, Diskussion seines Namens, Geburtsjahres, Erziehung und militärischer Ausbildung. Kapitel II. Hauptteil, Kapitel 2. Vater und Mutter Konstantins: Porträts von Constantius Chlorus und Helena, Analyse ihrer Herkunft und Beziehung. Weitere Kapitel im Hauptteil befassen sich mit den Traditionen der Kaisererhebung in der Soldatenkaiserzeit, dem Übergang vom Doppelkaisertum zur Tetrarchie und schließlich Konstantins Kaisererhebung selbst. Kapitel III. Schluss: Zusammenfassung der Ergebnisse.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Konstantin der Große, Kaisererhebung, Soldatenkaiserzeit, Doppelkaisertum, Tetrarchie, Constantius Chlorus, Helena, römische Geschichte, Herrscherwechsel, politische Traditionen.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit ist für ein akademisches Publikum gedacht, das sich für die römische Geschichte, insbesondere für die Zeit der Soldatenkaiser und die Regierungsübernahme Konstantins des Großen interessiert. Die Arbeit eignet sich für Studierende der Geschichte und verwandter Disziplinen.
- Arbeit zitieren
- Bernadett Huwe (Autor:in), 2003, Herkunft und politische Anfänge Konstantins - Familiärer Hintergrund, Erziehung und Kaisererhebung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/92260