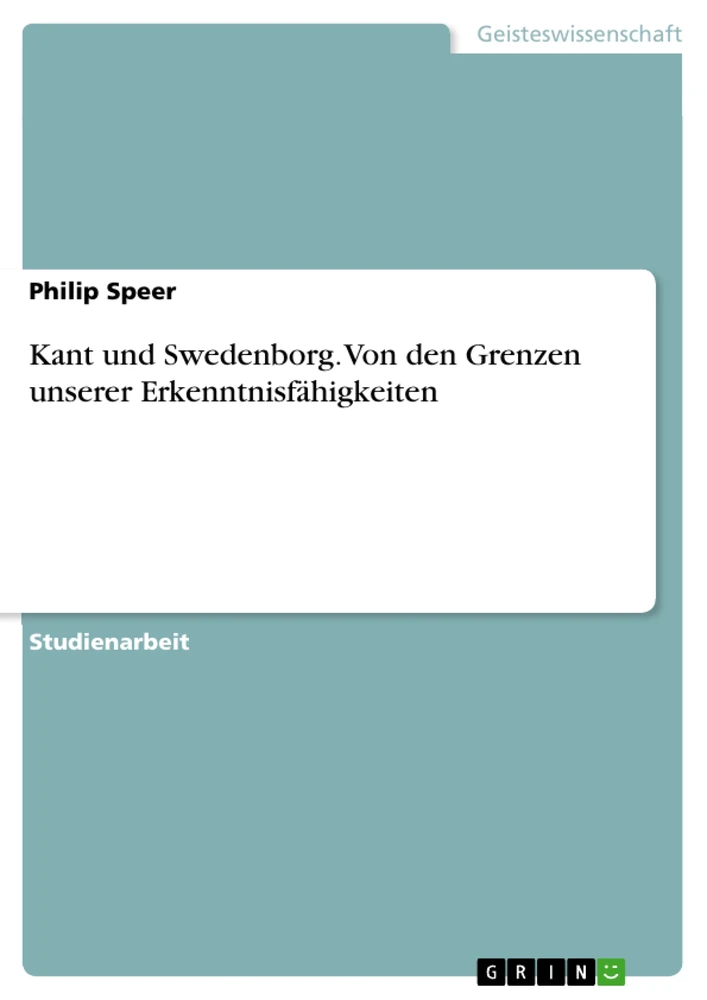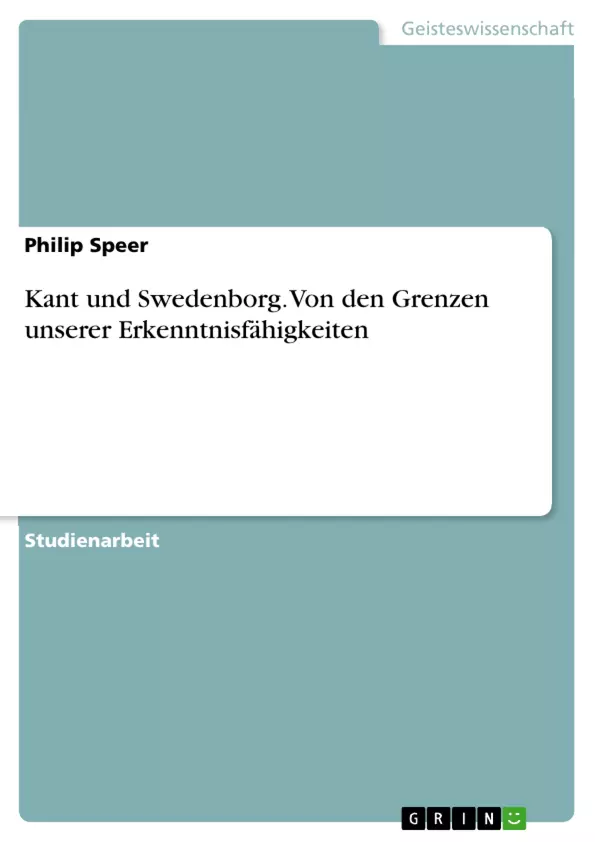In dieser Arbeit wird Kants "Träume eines Geistersehers, erläutert durch Träume der Metaphysik" behandelt.
Es geht darum, wie zum einen die Faszination deutlich wird, die Kant für die von Swedenborg vermittelten Inhalte verspürt, aber auch, wie zum anderen Kant sich über die Lehre Swedenborgs lustig macht, der nach eigener Aussage in direktem Kontakt zu Gott stand und direktes Wissen durch Engel und andere Geistwesen empfangen habe. Swedenborg dient Kant als Beispiel dafür, welche Gefahren für den eigenen Verstand bestehen, sobald man sich auf das „Luftschiff der Metaphysik“ wagt.
Auch wenn es umstritten ist, inwiefern die "Träume eines Geistersehers" das Ende einer empiristischen Phase bei Kant darstellen, scheint es unwiderlegbar, dass hier bereits viele kritische Gedanken zu finden sind, die 15 Jahre später in der „Kritik der Vernunft“ ihren Höhepunkt finden.
1766 erschien Kants Schrift „Träume eines Geistersehers, erläutert durch Träume der Metaphysik“. In dieser ursprünglich anonym veröffentlichten Schrift setzt sich Kant in einem oft ungewohnt sarkastischen Ton mit Fragen der Metaphysik auseinander: Ist es möglich, dass geistige Wesen existieren? Können wir Erkenntnis von Gegenständen erlangen, die wir nicht direkt beobachten können? Und was sollte die eigentliche Aufgabe der Metaphysik sein?
Die Träume sind neben einem kurzen Vorbericht in 2 Hauptteile gegliedert: dem ersten Teil, „welcher dogmatisch ist“ und dem zweiten Teil, „welcher historisch ist“. Diese Arbeit soll sich vornehmend auf das Verhältnis zwischen Kant und „berühmtesten Geisterseher(s) seiner Zeit“, Emanuel Swedenborg fokussieren. Kant behandelt Swedenborg hauptsächlich im zweiten Teil der Träume. Auch wenn Kant die von Swedenborg vermittelten Inhalte ablehnt und diese durchgehend als „Unsinn“ oder „Hirngespinste“ bezeichnet, kann dies doch nicht darüber hinwegtäuschen, dass für Kant auch eine gewisse Faszination von Swedenborg ausgeht, denn letzten Endes würde Kant auch gerne an diese von Swedenborg beschriebene immaterielle Welt und damit ein Leben nach dem Tod glauben. Swedenborg dient Kant als ein Beispiel um die Metaphysik seiner Zeit zu kritisieren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Swedenborg
- Die Träume
- Swedenborg in den Träumen eines Geistersehers
- Die philosophischen Positionen Kants und Swedenborgs
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert Kants Schrift "Träume eines Geistersehers" im Hinblick auf dessen Auseinandersetzung mit den Ideen des schwedischen Mystikers Emanuel Swedenborg. Der Fokus liegt dabei auf der Kritik, die Kant an Swedenborgs "Geistersehen" übt, und der Frage, welche Bedeutung diese Kritik für die Entwicklung von Kants eigener philosophischer Position hat.
- Kants Kritik an Swedenborgs "Geistersehen" als Beispiel für die Gefahren der Metaphysik
- Die Verbindung zwischen Geist und Materie als zentrales Thema in Kants "Träumen"
- Die Rolle der Träume und der Imagination in der Erkenntnis
- Die Grenzen der menschlichen Erkenntnisfähigkeit
- Die Bedeutung der Kritik der Vernunft für die philosophische Analyse
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Arbeit bietet eine Einleitung in die Thematik und stellt Kants Schrift "Träume eines Geistersehers" vor. Das zweite Kapitel beleuchtet die Person und die Ideen des schwedischen Mystikers Emanuel Swedenborg. In Kapitel 3 werden Kants "Träume eines Geistersehers" genauer betrachtet, wobei der Fokus auf dem Verhältnis zwischen Geist und Materie liegt. In Kapitel 4 werden die philosophischen Positionen Kants und Swedenborgs verglichen.
Schlüsselwörter
Kant, Swedenborg, Träume, Geistersehen, Metaphysik, Kritik der Vernunft, Erkenntnisfähigkeit, Geist und Materie, Imagination, Leib-Seele-Problem, Naturwissenschaften, Religion, Philosophie des Films
- Quote paper
- Philip Speer (Author), 2020, Kant und Swedenborg. Von den Grenzen unserer Erkenntnisfähigkeiten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/922817