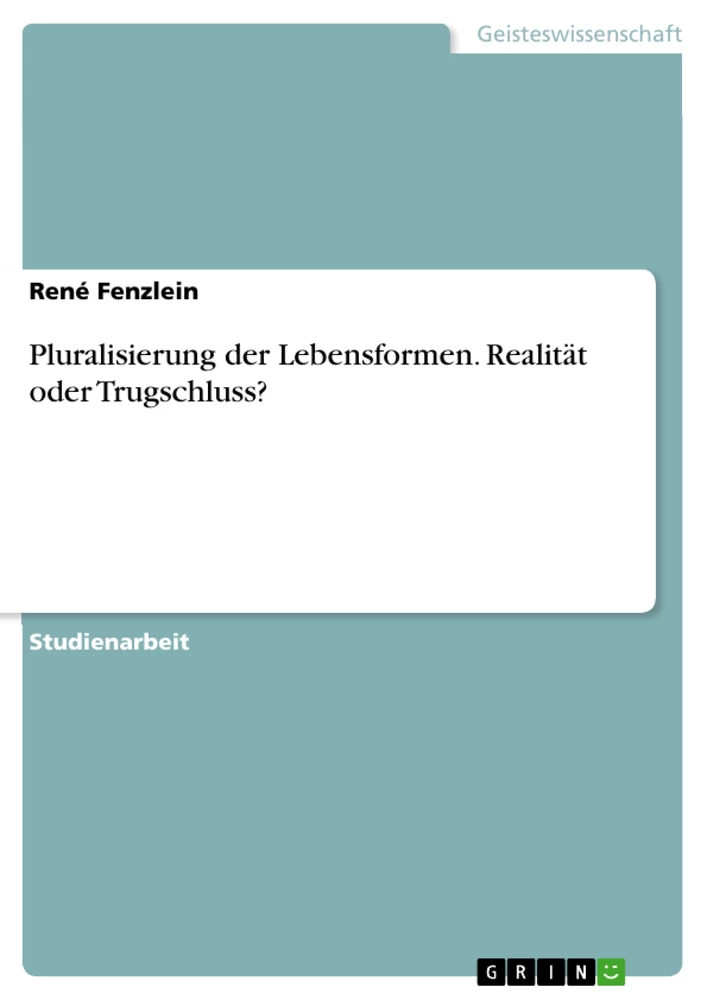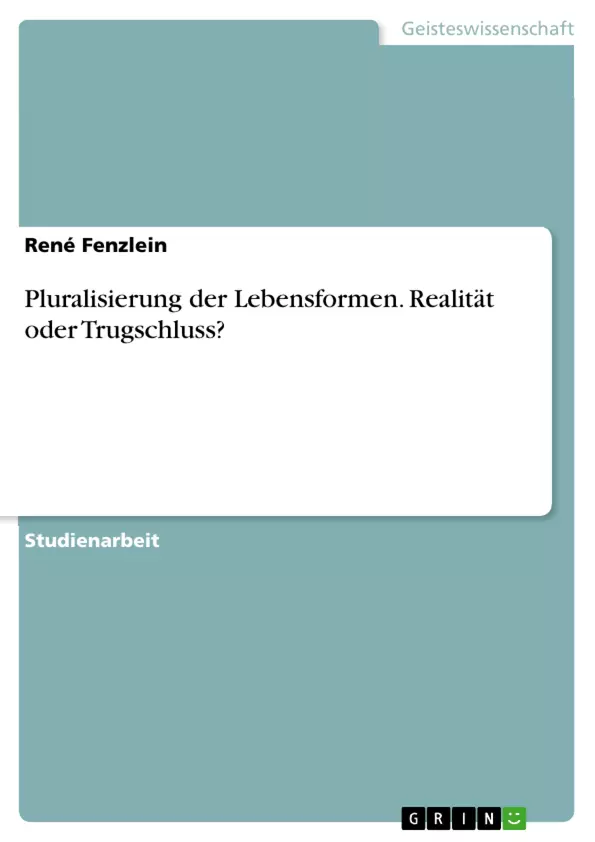In dieser Hausarbeit wird aufgezeigt, wie eine Pluralisierung der Lebensformen zu definieren ist und wie sich die Lebensformen in Deutschland seit den 1960er Jahren entwickelt haben.
Daraufhin soll mithilfe von unterschiedlichen theoretischen und empirischen Positionen diskutiert werden, ob die Veränderung der Lebensweisen in den letzten Jahrzehnten wirklich als Pluralisierung verstanden werden kann oder ob diese Sichtweise letztendlich nur eine falsche Deutung ist. Abschließend werden die dazugewonnenen Erkenntnisse noch einmal in einem Fazit zusammengefasst.
Seit längerer Zeit wird sowohl innerhalb der Sozialwissenschaften als auch in der breiten Öffentlichkeit und Politik ausgiebig über den Wandel familialer und partnerschaftlicher Lebensformen diskutiert. Trotz zahlreicher Studien ist man sich bis heute nicht einig, in welchem Ausmaß ein Vorgang der Pluralisierung wirklich stattgefunden hat.
Ausgangspunkt sind die seit den 1960er Jahren zu beobachteten Veränderungen von stetig zunehmenden abweichenden Lebensweisen abseits der kernfamilialen Lebensform des häuslichen Zusammenlebens von verheirateten Eltern mit minderjährigen Kindern. Während das Modell der Kernfamilie heutzutage von der Bevölkerung immer weniger als Lebensform präferiert wird, haben Lebensweisen wie z.B. nichteheliche Lebensgemeinschaften oder Einpersonenhaushalte deutlich zugenommen.
Von einigen Experten wird der langfristige Wandel der Lebensformen eher skeptisch gesehen, von anderen wiederum als positiv beurteilt. Die einen verweisen auf ein Dahinschwinden traditioneller Lebensformen wie die Ehe, wohingegen andere durch die Etablierung neuer Lebensformen einen Zuwachs an Wahlmöglichkeiten betonen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Was unter einer „Pluralisierung der Lebensformen“ zu verstehen ist
- Historie und Entwicklung der Lebensformen
- Pluralisierung der Lebensformen - Realität oder Trugschluss?
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Diskussion um den Wandel familialer und partnerschaftlicher Lebensformen, die sowohl in den Sozialwissenschaften als auch in der Öffentlichkeit und Politik stattfindet. Ziel ist es, die Frage zu klären, ob der beobachtete Wandel der Lebensformen tatsächlich als Pluralisierung verstanden werden kann oder ob es sich um eine trügerische Wahrnehmung handelt.
- Definition von „Pluralisierung der Lebensformen“
- Historische Entwicklung der Lebensformen in Deutschland seit den 1960er Jahren
- Diskussion unterschiedlicher theoretischer und empirischer Positionen zur Pluralisierung der Lebensformen
- Bewertung des Wandels der Lebensformen im Hinblick auf Pluralisierung
- Zusammenfassende Analyse der Erkenntnisse
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung führt in die Thematik des Wandels familialer und partnerschaftlicher Lebensformen ein und stellt die Relevanz der Diskussion sowie die Forschungsfrage dar. Sie beschreibt den Wandel weg von der Kernfamilie hin zu neuen Lebensformen wie nichtehelichen Lebensgemeinschaften und Einpersonenhaushalten.
Was unter einer „Pluralisierung der Lebensformen“ zu verstehen ist
Dieses Kapitel definiert den Begriff „Pluralisierung der Lebensformen“ und erläutert, wie sich die Vielfalt der Lebensformen auf verschiedene Daseinsformen wie nichteheliche Gemeinschaften, Scheidungen, Verwitwungen und Kinderlosigkeit bezieht. Der Begriff wird in Verbindung mit der Zunahme von Vielfalt, Heterogenität und qualitativer Varianz erklärt.
Historie und Entwicklung der Lebensformen
Dieses Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung der Lebensformen seit den 1960er Jahren. Es werden verschiedene alternative Lebensformen vorgestellt, die sich neben der „Normalfamilie“ etabliert haben, wie z.B. Einpersonenhaushalte, nichteheliche Lebensgemeinschaften, kinderlose Ehen und Wohngemeinschaften.
Schlüsselwörter
Die zentralen Begriffe der Arbeit sind Pluralisierung der Lebensformen, Lebensformen, Wandel, Kernfamilie, alternative Lebensformen, gesellschaftliche Akzeptanz, Heterogenität, Vielfalt, Familienstrukturen, Demografischer Wandel, Wertewandel, Einpersonenhaushalte, nichteheliche Lebensgemeinschaften, Scheidung, Verwitwung, Kinderlosigkeit.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet "Pluralisierung der Lebensformen"?
Es beschreibt die Zunahme vielfältiger Lebensstile abseits der traditionellen Kernfamilie, wie Einpersonenhaushalte, nichteheliche Lebensgemeinschaften oder kinderlose Ehen.
Seit wann wandeln sich die Familienstrukturen in Deutschland?
Ein deutlicher Wandel ist seit den 1960er Jahren zu beobachten, getrieben durch Wertewandel, demografische Veränderungen und die Emanzipation.
Ist die Kernfamilie ein Auslaufmodell?
Obwohl sie seltener präferiert wird, bleibt sie eine wichtige Referenzform. Die Pluralisierung bedeutet eher eine Ergänzung durch alternative Lebensweisen als ein völliges Verschwinden.
Welche Rolle spielt der demografische Wandel dabei?
Sinkende Geburtenraten und eine alternde Gesellschaft führen zu mehr Einpersonenhaushalten und veränderten familialen Unterstützungsnetzwerken.
Wird die Pluralisierung von Experten positiv oder negativ gesehen?
Die Meinungen sind geteilt: Einige sehen einen Zuwachs an individuellen Wahlmöglichkeiten, andere warnen vor dem Schwinden traditioneller Stabilität.
- Arbeit zitieren
- René Fenzlein (Autor:in), 2017, Pluralisierung der Lebensformen. Realität oder Trugschluss?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/922908