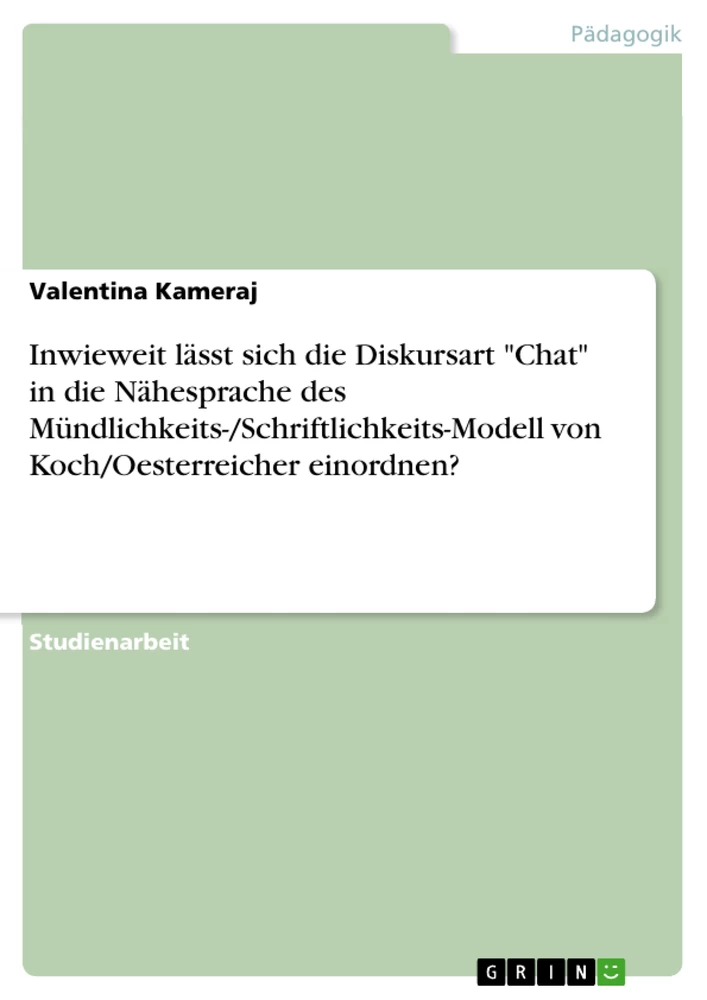Das Mündlichkeits- und Schriftlichkeits-Modell von Wulf Oesterreicher und Peter Koch, welches dazu dient Äußerungsformen zu klassifizieren, wird die Grundlage für diese Arbeit bieten. Der Schwerpunkt liegt auf der schriftlichen online-Kommunikation, wie es in chatrooms üblich ist und dessen Einordnung in das Konzept zu Mündlichkeit und Schriftlichkeit bzw. Nähe und Distanz.
Zunächst wird das Protokoll einer halbstündigen Chatsitzung, der Seite www.portalchat.es im Raum #amistad, einer sprachlichen Analyse unterzogen. Im anschließenden Abschnitt gehe ich genauer auf die theoretischen Grundlagen des Modells von Koch/Oesterreicher ein, um zu sehen, inwieweit der Chat Phänomene der kommunikativen Nähe, wie Koch/Oesterreicher behaupten, aufweist.
Inhaltsverzeichnis
- HISTORISCHE UND TECHNISCHE GRUNDLAGEN INTERNETBASIERTE KOMMUNIKATIONSFORMEN...
- THEORETISCHE GRUNDLAGEN: DAS MÜNDLICHKEITS-/SCHRIFTLICHKEITS-MODELL VON PETER KOCH UND WULF OESTERREICHER..
- VERORTUNG DER DISKURSART IM NÄHE/DISTANZ-KONTINUUM VON PETER KOCH UND WULF OESTERREICHER.....
- SPRACHLICHE ANALYSE IM SYNTAKTISCHEN BEREICH..
- Kongruenz-Schwächen und constructio ad sensum .........
- Anakoluthe, Kontaminationen, Nachträge, Engführungen.
- Die Ellipse...
- Syntaktische Komplexität.
- SPRACHLICHE ANALYSE IM SEMANTISCHEN BEREICH..
- Geringe syntagmatische Lexemvariation: Wort-Iteration.
- Geringe paradigmatische Differenzierung und Unschärfen in der Referentialisierung: passe-partout-Wörter
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Frage, inwieweit sich die Diskursart „Chat“ in das Nähe-Sprache-Modell von Koch/Oesterreicher einordnen lässt. Sie untersucht die sprachlichen Besonderheiten des Chats und analysiert, ob diese Phänomene der kommunikativen Nähe aufweisen, wie es Koch/Oesterreicher behaupten.
- Historische und technische Entwicklung des Chats
- Das Mündlichkeits-/Schriftlichkeits-Modell von Koch/Oesterreicher
- Verortung des Chats im Nähe/Distanz-Kontinuum
- Sprachliche Analyse des Chats im syntaktischen und semantischen Bereich
- Schlussfolgerungen und Ausblick
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel gibt einen Überblick über die historischen und technischen Grundlagen internetbasierter Kommunikationsformen, insbesondere die Entstehung des Chats. Es wird die Entwicklung vom Internet Relay Chat (IRC) über Web-Chats bis hin zu Instant-Messaging-Systemen wie WhatsApp und Facebook-Messenger beleuchtet. Die Auswirkungen dieser Kommunikationsformen auf das kommunikative Verhalten und das Schreibverhalten der Menschen werden ebenfalls diskutiert.
Kapitel 2 widmet sich den theoretischen Grundlagen des Mündlichkeits-/Schriftlichkeits-Modells von Peter Koch und Wulf Oesterreicher. Es werden die Begriffe „gesprochen/mündlich“ und „geschrieben/schriftlich“ sowie die Unterscheidung zwischen Medium und Konzeption erläutert. Das „Vierfelderschema“ von Koch/Oesterreicher wird vorgestellt und die Bedeutung von Kommunikationsbedingungen und Versprachlichungsstrategien in gesprochener und geschriebener Sprache wird hervorgehoben.
Kapitel 3 betrachtet die Verortung der Diskursart „Chat“ im Nähe/Distanz-Kontinuum von Koch/Oesterreicher. Es wird analysiert, ob und inwieweit der Chat Phänomene der kommunikativen Nähe aufweist, wie es Koch/Oesterreicher behaupten.
Kapitel 4 und 5 befassen sich mit der sprachlichen Analyse des Chats, sowohl im syntaktischen als auch im semantischen Bereich. Es werden die charakteristischen Merkmale des Chats, wie z.B. Kongruenz-Schwächen, Anaplothen, Ellipsen, Wort-Iteration und Unschärfen in der Referentialisierung untersucht.
Schlüsselwörter
Chat, Mündlichkeit, Schriftlichkeit, Koch/Oesterreicher, Nähe-Sprache, Distanz-Sprache, Sprachliche Analyse, Syntax, Semantik, Internet, Kommunikation, Instant Messaging, Online-Kommunikation
- Arbeit zitieren
- Valentina Kameraj (Autor:in), 2017, Inwieweit lässt sich die Diskursart "Chat" in die Nähesprache des Mündlichkeits-/Schriftlichkeits-Modell von Koch/Oesterreicher einordnen?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/922916