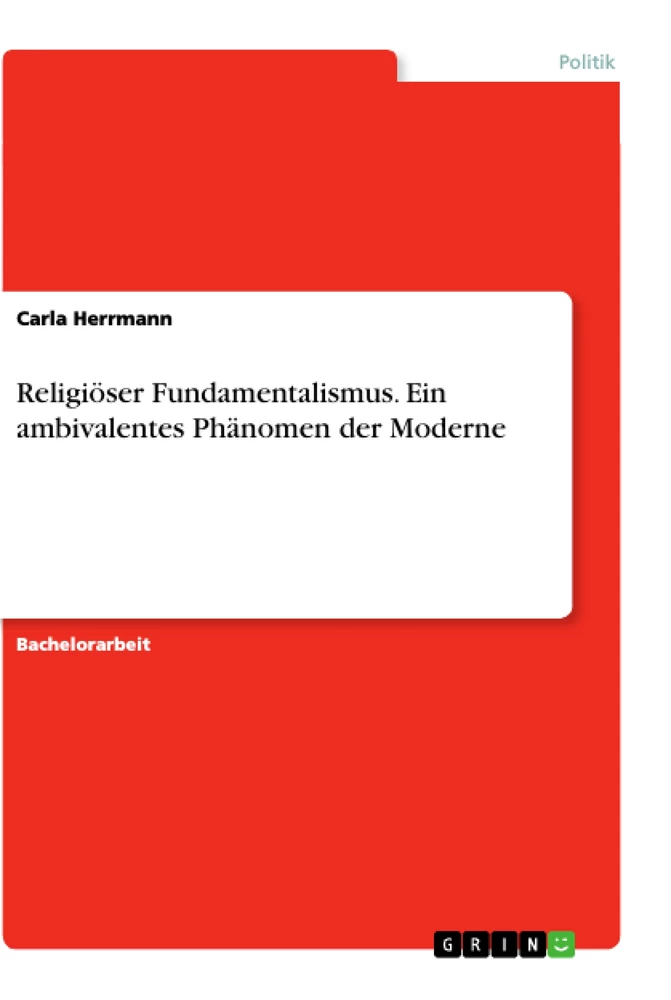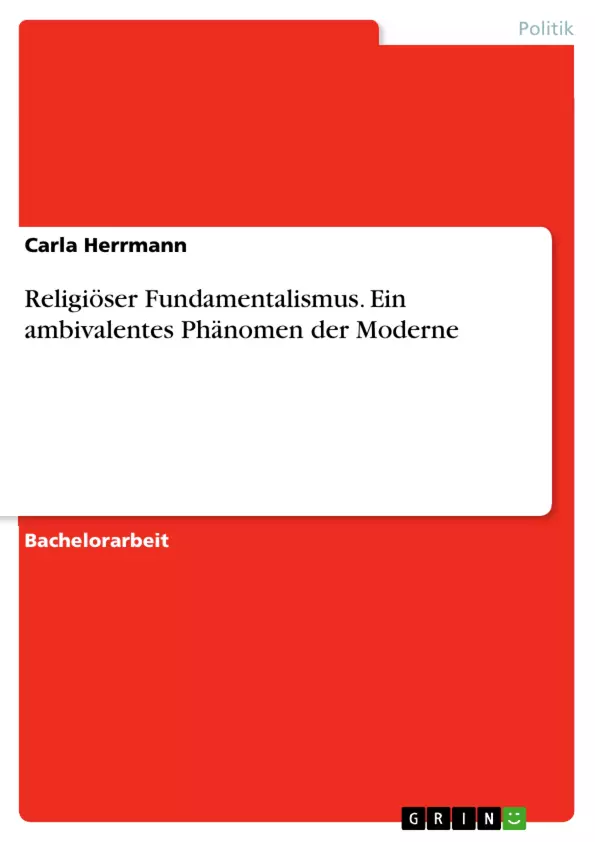Weshalb tritt das komplexe Phänomen des religiösen Fundamentalismus, das auf den ersten Blick geradezu als Gegensatz der Moderne erscheint, in eben solchen als modern geltenden Gesellschaften auf?
Angenähert werden soll sich dieser Fragestellung, indem zunächst die wechselvolle Begriffsgeschichte des religiösen Fundamentalismus, die eng mit der Genese religiöser Fundamentalismen zusammenhängt, skizziert und unterschiedliche Definitionsversuche vorgestellt werden.
Nachfolgend werden diverse Merkmale des religiösen Fundamentalismus diskutiert, zum einen solche, die dem Charakter des Phänomens als Traditionalismus oder Antimodernismus entsprechen würde, zum anderen anschließend Eigenschaften, die durch ihre spezifisch moderne Prägung diesem Bild deutlich widersprechen.
Im Anschluss werden die theoretischen Konstrukte der Sozialwissenschaftler Georg Simmel, Zygmunt Bauman und Ulrich Beck, die sich allesamt mit den Themen Moderne, Ambivalenz – einem bezüglich der Leitfrage zentralen Erklärungsmuster – sowie Religion auseinandersetzen. Sicherlich sind diese drei nicht die einzigen Theoretiker, die zur vorliegenden Thematik herangezogen werden können, jedoch musste aufgrund der Begrenztheit dieser Arbeit eine repräsentative Auswahl getroffen werden. Die Wahl fiel dabei neben Georg Simmel, der als ‚Klassiker‘ und Mitbegründer des Wissenschaftszweiges der Soziologie gelten kann, auf Zygmunt Bauman und Ulrich Beck, die bereits durch ihre Lebensdaten näher an der Gegenwart sind.
Außerdem verfolgen beide Konzepte, die die Moderne bereits in mehrere ‚Unter-Epochen‘ aufteilen, namentlich in Moderne und Postmoderne (Bauman) bzw. in Erste Moderne und Zweite, reflexive Moderne (Beck). Obwohl diese Unterscheidungen keinesfalls verwischt werden sollten – sie werden v. a. in den Vorstellungen der Theorien unter 2.2 noch klar herausgearbeitet – sind sie letztlich Ansätze, die aufzeigen sollen, dass der Begriff der Moderne eine hohe Komplexität aufweist und kritisch aufzufassen ist. Dieser Ansicht folgt diese Arbeit, jedoch wird in der Diktion zu späterer Stelle nicht mehr ausführlich zwischen den Einzelbezeichnungen unterschieden; stattdessen wird hauptsächlich die Begrifflichkeit ‚Moderne‘ vor dem zuvor geschilderten theoretischen Hintergrund verwendet werden. [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Religiöser Fundamentalismus – das Gespenst der Moderne?
- 2. Religiöser Fundamentalismus als ambivalentes Phänomen in der Moderne
- 2.1 Religiöser Fundamentalismus – Begriffsgeschichte und Definitionsversuche
- 2.1.1 Religiöser Fundamentalismus ein traditioneller Gegensatz zur Moderne?
- 2.1.2 Religiöser Fundamentalismus - ein modernes Phänomen?
- 2.2 Theorien der Ambivalenz der Moderne
- 2.2.1 Georg Simmel
- 2.2.1.1 Die Moderne, das Dritte und der Fremde
- 2.2.1.2 Religion und Religiosität
- 2.2.2 Zygmunt Bauman
- 2.2.2.1 (Post-)Moderne, Ambivalenz und der Fremde
- 2.2.2.2 Der Tod und die Religion
- 2.2.3 Ulrich Beck
- 2.2.3.1 Zweite Moderne, Ambivalenz und der Fremde
- 2.2.3.2 Die Individualisierung der Religion
- 2.3 Fundamentalismus als Hybrid - ein ambivalentes Phänomen der Moderne
- 2.3.1 Exkurs I: Religiöser Fundamentalismus nach Zygmunt Bauman
- 2.3.2 Exkurs II: Religiöser Fundamentalismus nach Ulrich Beck
- 2.3.3 Religiöser Fundamentalismus – ein ambivalentes, fremdes Phänomen
- 3. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht das Phänomen des religiösen Fundamentalismus im Kontext der Moderne. Die zentrale Forschungsfrage lautet: Weshalb tritt das komplexe Phänomen des religiösen Fundamentalismus, das auf den ersten Blick als Gegensatz zur Moderne erscheint, in eben solchen als modern geltenden Gesellschaften auf? Die Arbeit beleuchtet die Begriffsgeschichte des religiösen Fundamentalismus, analysiert dessen ambivalente Natur und untersucht verschiedene theoretische Perspektiven zur Erklärung seiner Existenz in modernen Gesellschaften.
- Begriffsgeschichte und Definitionen von religiösem Fundamentalismus
- Ambivalenz des religiösen Fundamentalismus als modernes Phänomen
- Theoretische Ansätze zur Erklärung des religiösen Fundamentalismus (Simmel, Bauman, Beck)
- Der scheinbare Widerspruch zwischen religiösem Fundamentalismus und Modernisierung
- Religiöser Fundamentalismus als hybrides Phänomen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Religiöser Fundamentalismus – das Gespenst der Moderne?: Dieses einführende Kapitel etabliert die Relevanz des Themas durch die Darstellung des religiösen Fundamentalismus als scheinbar paradoxem Phänomen der Moderne. Es verortet den Beginn verstärkt medialer Aufmerksamkeit auf den religiösen Fundamentalismus in den späten 1970er Jahren und weist auf die analytischen Unschärfen und die Ambivalenz des Begriffs hin. Das Kapitel führt die zentrale Forschungsfrage ein und skizziert den methodischen Ansatz der Arbeit, der die scheinbar widersprüchliche Koexistenz von religiösem Fundamentalismus und Modernisierung untersucht.
2. Religiöser Fundamentalismus als ambivalentes Phänomen in der Moderne: Dieses Kapitel bildet den Kern der Arbeit. Es beginnt mit einer detaillierten Auseinandersetzung mit der Begriffsgeschichte und unterschiedlichen Definitionsversuchen von religiösem Fundamentalismus, wobei sowohl traditionelle als auch moderne Aspekte beleuchtet werden. Im Anschluss werden die theoretischen Perspektiven von Georg Simmel, Zygmunt Bauman und Ulrich Beck analysiert, um das Konzept der Ambivalenz in der Moderne und deren Beziehung zum religiösen Fundamentalismus zu ergründen. Die Kapitel unterstreichen die Vielschichtigkeit des Phänomens und zeigen, wie die Theorien die komplexe Interaktion zwischen Tradition und Moderne im Kontext des religiösen Fundamentalismus erklären.
Schlüsselwörter
Religiöser Fundamentalismus, Moderne, Ambivalenz, Säkularisierung, Modernisierungstheorie, Georg Simmel, Zygmunt Bauman, Ulrich Beck, Tradition, Hybridität, (Post-)Moderne, Reflexive Moderne, Identität, Religion.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Bachelorarbeit: Religiöser Fundamentalismus – ein ambivalentes Phänomen der Moderne?
Was ist der zentrale Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Arbeit untersucht das Phänomen des religiösen Fundamentalismus im Kontext der Moderne. Die zentrale Forschungsfrage lautet: Weshalb tritt der religiöse Fundamentalismus, scheinbar im Gegensatz zur Moderne stehend, in modernen Gesellschaften auf?
Welche Aspekte werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit beleuchtet die Begriffsgeschichte des religiösen Fundamentalismus, analysiert dessen ambivalente Natur und untersucht verschiedene theoretische Perspektiven zur Erklärung seiner Existenz in modernen Gesellschaften. Dies umfasst die Definition des Begriffs, die Ambivalenz als modernes Phänomen, theoretische Ansätze (Simmel, Bauman, Beck), den scheinbaren Widerspruch zwischen religiösem Fundamentalismus und Modernisierung sowie den religiösen Fundamentalismus als hybrides Phänomen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in ihnen?
Kapitel 1: Etabliert die Relevanz des Themas und führt die Forschungsfrage ein. Es verortet den Beginn verstärkter medialer Aufmerksamkeit und weist auf die analytischen Unschärfen und die Ambivalenz des Begriffs hin.
Kapitel 2: Bildet den Kern der Arbeit. Es behandelt die Begriffsgeschichte und Definitionsversuche von religiösem Fundamentalismus und analysiert die theoretischen Perspektiven von Simmel, Bauman und Beck, um die Ambivalenz in der Moderne und deren Beziehung zum religiösen Fundamentalismus zu ergründen.
Kapitel 3: Fazit der Arbeit.
Welche theoretischen Ansätze werden verwendet?
Die Arbeit analysiert die theoretischen Perspektiven von Georg Simmel, Zygmunt Bauman und Ulrich Beck, um das Konzept der Ambivalenz in der Moderne und deren Beziehung zum religiösen Fundamentalismus zu erklären. Die Kapitel 2.2.1, 2.2.2 und 2.2.3 befassen sich jeweils mit den Theorien dieser drei Soziologen.
Wie wird der scheinbare Widerspruch zwischen religiösem Fundamentalismus und Modernisierung erklärt?
Die Arbeit untersucht diesen Widerspruch, indem sie den religiösen Fundamentalismus als ein ambivalentes, hybrides Phänomen der Moderne begreift. Die Theorien von Simmel, Bauman und Beck liefern verschiedene Perspektiven auf diese komplexe Interaktion zwischen Tradition und Moderne.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Religiöser Fundamentalismus, Moderne, Ambivalenz, Säkularisierung, Modernisierungstheorie, Georg Simmel, Zygmunt Bauman, Ulrich Beck, Tradition, Hybridität, (Post-)Moderne, Reflexive Moderne, Identität, Religion.
Wann wird der religiöse Fundamentalismus als verstärkt mediales Thema wahrgenommen?
Die Arbeit verortet den Beginn verstärkt medialer Aufmerksamkeit auf den religiösen Fundamentalismus in den späten 1970er Jahren.
Welche methodischen Ansätze werden in der Arbeit angewendet?
Die Arbeit untersucht die scheinbar widersprüchliche Koexistenz von religiösem Fundamentalismus und Modernisierung durch die Analyse der Begriffsgeschichte, unterschiedlicher Definitionsversuche und die Anwendung theoretischer Perspektiven von Simmel, Bauman und Beck.
- Citar trabajo
- B.A. Carla Herrmann (Autor), 2019, Religiöser Fundamentalismus. Ein ambivalentes Phänomen der Moderne, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/922949