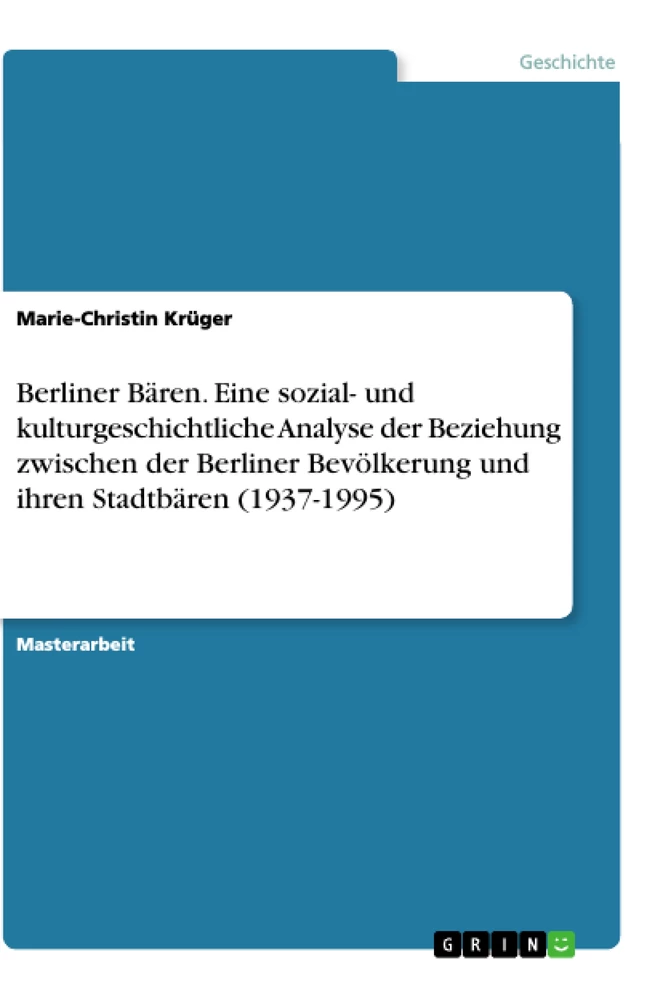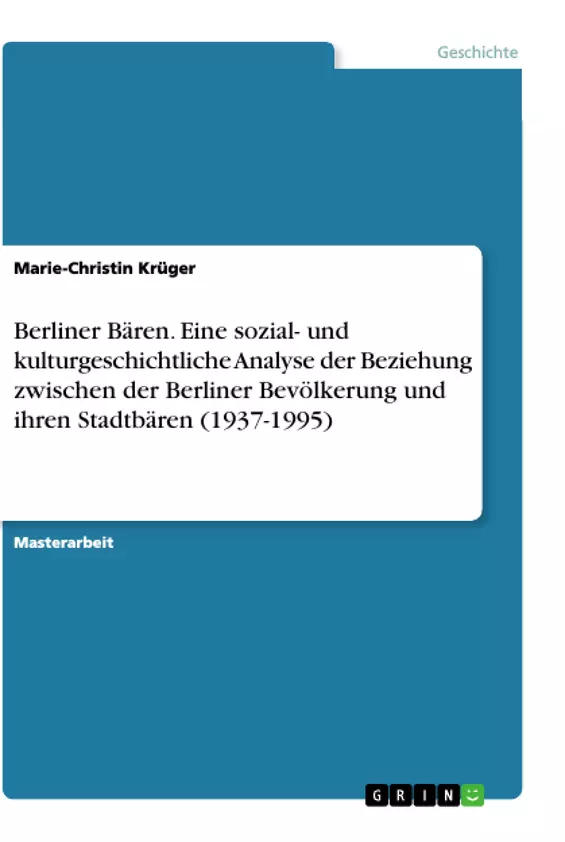Die Mastarbeit von Marie-Christin Krüger aus dem Jahr 2019 ist die historische Aufarbeitung des Berliner Bärenzwingers zwischen 1937 und 1995 dar und ist somit die erste wissenschaftliche Arbeit zu der Anlage im Herzen Berlins. „Wir brauchen etwas lebendiges, so lebendig wie unsere Stadt!“, regt der Mitarbeiter des Reichspropagandaministerium Wilhelm Bade 1937 an. Bereits zwei Jahre wurde kurz vor Beginn des zweiten Weltkrieges ein Bärenzwinger mit Braunbären im Kölnischen Park errichtet. Dieses Projekt endete nicht 1945, sondern überdauerte in Ostberlin die Teilung Deutschlands und wurde schließlich bis 2015 bewirtschaftet. Die Berliner Bären wurden zu den medialen Stars dreier Staatssysteme inszeniert, die sie in ganz anderen Kontexten darstellte. In Krisen wie im Wohlstand entwickelte die Berliner Bevölkerung zu ‚ihren‘ Bären eine enge emotionale Bindung, die sich durch Projektionen aber auch Interaktionen mit den Tieren festigten. Gleichzeitig unterlagen die Tieren zwischen 1939 und 2015 verschiedenen Tierschutzgesetzen – ein Umstand, der nach der deutschen Wiedervereinigung zu einer emotionalen Diskussion führte.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1. Untersuchungsgegenstand
- 1.2. Quellenkorpus
- 1.3. Forschungsstand und methodisches Vorgehen
- 1.4. Sprachliche Definitionen
- 2. Rahmenkonzepte der Bär*innenhaltung
- 2.1. Die Entwicklung der Zootierhaltung
- 2.2. Eine Historisierung von Braunbär*innen
- 2.3. Entstehung und Wandel des Berliner Bären in Siegel und Wappen
- 3. Der Bärenzwinger im nationalsozialistischen Berlin, 1939-1945
- 3.1. Die Entstehung des Bärenzwingers im Köllnischen Park
- 3.1.1. Von der Ideengebung zur Eröffnung: Die Debatte um die Entstehung, 1937-1939
- 3.1.2. Urbane Bär*innenhaltung im nationalsozialistischen Berlin, 1940-1945
- 3.2. Braunbär*innen mit Migrationshintergrund
- 3.3. Ausprägungen und Besonderheiten der Bär*innenhaltung im NS
- 3.3.1. Tierschutz und praktische Haltungsbedingungen im NS
- 3.3.2. Projektionen und öffentliche Zuschreibungen im NS
- 3.3.3. Interaktionen zwischen Berliner Bevölkerung und Stadtbär*innen im NS
- 4. Der Bärenzwinger in Ostberlin, 1949-1989
- 4.1. Die Wiedereröffnung des Bärenzwingers in Ostberlin, 1949
- 4.2. Alltag am Bärenzwinger im sozialistischen Berlin
- 4.2.1. Nante und Jette, 1949-1984
- 4.2.2. Der ,,Bärenvater“ August Porath
- 4.2.3. Eine unbemerkte Nachfolge: Schnute und Tabs, 1981- 1990
- 4.2.4. Die Zuständigkeit des Berliner Tierparks
- 4.3. Ausprägungen und Besonderheiten der Bär*innenhaltung im Sozialismus
- 4.3.1. Tierschutz und praktische Haltungsbedingungen in der DDR
- 4.3.2. Projektionen und öffentliche Zuschreibungen in der DDR
- 4.3.3. Interaktionen zwischen Berliner Bevölkerung und Bär*innen in der DDR
- 5. Der Bärenzwinger nach der Wiedervereinigung, 1990-1995
- 5.1. Diskussion um den Fortbestand des Bärenzwingers, 1990-1992
- 5.2. Die Vermittlung von fünf Jungbär*innen, 1993-1994
- 5.2.1. Vermittlungsversuche
- 5.2.2. Die Gründung der Berliner Bärenfreunde
- 5.3. Ausprägungen und Besonderheiten der Bär*innenhaltung, 1990-1995
- 5.3.1. Tierschutz und praktische Haltungsbedingungen in der BRD
- 5.3.2. Projektionen und öffentliche Zuschreibungen in der BRD
- 5.3.3. Interaktionen zwischen Berliner Bevölkerung und Bär*innen in der BRD
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Masterarbeit „Berliner Bären" widmet sich einer sozial- und kulturgeschichtlichen Analyse der Beziehung zwischen der Berliner Bevölkerung und ihren Stadtbären. Dabei wird die Zeitspanne von 1937 bis 1995 untersucht, also die Jahre der NS-Zeit, der DDR und der Nachwendezeit. Die Arbeit verfolgt das Ziel, die Entwicklung und Wandlung dieser Beziehung im Kontext des politischen und gesellschaftlichen Wandels zu beleuchten.
- Entwicklung und Wandel der städtischen Bär*innenhaltung im 20. Jahrhundert
- Einfluss von Ideologien und politischen Systemen auf die Haltung und Wahrnehmung von Bär*innen
- Interaktionen zwischen der Berliner Bevölkerung und den Stadtbär*innen
- Die Rolle von Medien und Öffentlichkeitsarbeit in der Inszenierung der Berliner Bären
- Die Bedeutung der Berliner Bären als kulturelles Symbol und Identifikationsfigur
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung
- Darlegung des Untersuchungsgegenstands und der Forschungsfrage
- Vorstellung des Quellenkorpus und der methodischen Vorgehensweise
- Abgrenzung des Forschungsbereichs und Definition relevanter Begriffe
- Kapitel 2: Rahmenkonzepte der Bär*innenhaltung
- Die Entwicklung der Zootierhaltung und ihre historischen Bedingungen
- Die kulturelle und historische Bedeutung von Braunbär*innen in Europa
- Die Entwicklung des Berliner Bären in Siegel und Wappen
- Kapitel 3: Der Bärenzwinger im nationalsozialistischen Berlin, 1939-1945
- Die Entstehung des Bärenzwingers im Köllnischen Park und die Debatte um seine Notwendigkeit
- Die Haltungsbedingungen und das Leben der Bären im Bärenzwinger während der NS-Zeit
- Die Bedeutung von Bär*innen als Projektionsfläche für NS-Ideologie und Propaganda
- Interaktionen zwischen Berliner Bevölkerung und Stadtbär*innen im NS-Berlin
- Kapitel 4: Der Bärenzwinger in Ostberlin, 1949-1989
- Die Wiedereröffnung des Bärenzwingers in Ostberlin und die Entwicklung der Bär*innenhaltung in der DDR
- Alltag im Bärenzwinger und die Lebensgeschichte der Bär*innen Nante und Jette
- Die Rolle des „Bärenvaters“ August Porath und die Bedeutung von Mensch-Tier-Beziehungen
- Die Bedeutung der Bären für die politische und kulturelle Identität Ostberlins
- Die Interaktionen zwischen Berliner Bevölkerung und Stadtbär*innen in der DDR
- Kapitel 5: Der Bärenzwinger nach der Wiedervereinigung, 1990-1995
- Diskussionen um den Fortbestand des Bärenzwingers und die Vermittlung von Jungbär*innen
- Die Gründung der „Berliner Bärenfreunde“ und deren Engagement für die Bär*innen
- Die Entwicklung der Bär*innenhaltung nach der Wiedervereinigung und die Einordnung in neue tierschutzrechtliche Richtlinien
- Die Bedeutung der Bären für die neue Berliner Identität und ihre Rolle in der Öffentlichkeit
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Themen Bär*innenhaltung, Berliner Stadtgeschichte, Zoogeschichte, Mensch-Tier-Beziehungen, kulturelle Identitätsbildung, Politik und Gesellschaft, NS-Zeit, DDR und Nachwendezeit. Im Zentrum stehen die Analyse der öffentlichen Inszenierung der Berliner Stadtbär*innen, die Herausarbeitung der unterschiedlichen Perspektiven auf die Beziehung zwischen Mensch und Tier sowie die Bedeutung der Bären als kulturelles Symbol und Identifikationsfigur.
Häufig gestellte Fragen
Welchen Zeitraum umfasst die historische Analyse der Berliner Stadtbären?
Die Arbeit untersucht die Beziehung zwischen der Berliner Bevölkerung und den Stadtbären im Zeitraum von 1937 bis 1995.
Wer gab den Anstoß für die Errichtung des Bärenzwingers?
Wilhelm Bade, ein Mitarbeiter des Reichspropagandaministeriums, regte 1937 an, etwas „Lebendiges“ für die Stadt zu schaffen, woraufhin der Zwinger im Köllnischen Park entstand.
Wie wurden die Bären politisch instrumentalisiert?
Die Bären wurden als mediale Stars in drei verschiedenen Staatssystemen (NS-Staat, DDR, BRD) inszeniert und dienten als Projektionsflächen für die jeweilige Ideologie und Propaganda.
Welche Rolle spielten die Bären für die Ostberliner Bevölkerung?
In der DDR entwickelten die Bürger eine enge emotionale Bindung zu Bären wie Nante und Jette. Der „Bärenvater“ August Porath war dabei eine zentrale Identifikationsfigur.
Was änderte sich für die Bären nach der deutschen Wiedervereinigung?
Nach 1990 führten neue Tierschutzgesetze und veränderte gesellschaftliche Ansichten zu emotionalen Diskussionen über den Fortbestand des Zwingers und die Haltungsbedingungen.
Welche Bedeutung hat der Bär als Symbol für Berlin?
Die Arbeit analysiert die Entwicklung des Bären vom Wappentier hin zum lebendigen kulturellen Symbol und zur Identifikationsfigur für die Stadtbewohner.
- Quote paper
- Marie-Christin Krüger (Author), 2019, Berliner Bären. Eine sozial- und kulturgeschichtliche Analyse der Beziehung zwischen der Berliner Bevölkerung und ihren Stadtbären (1937-1995), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/922973