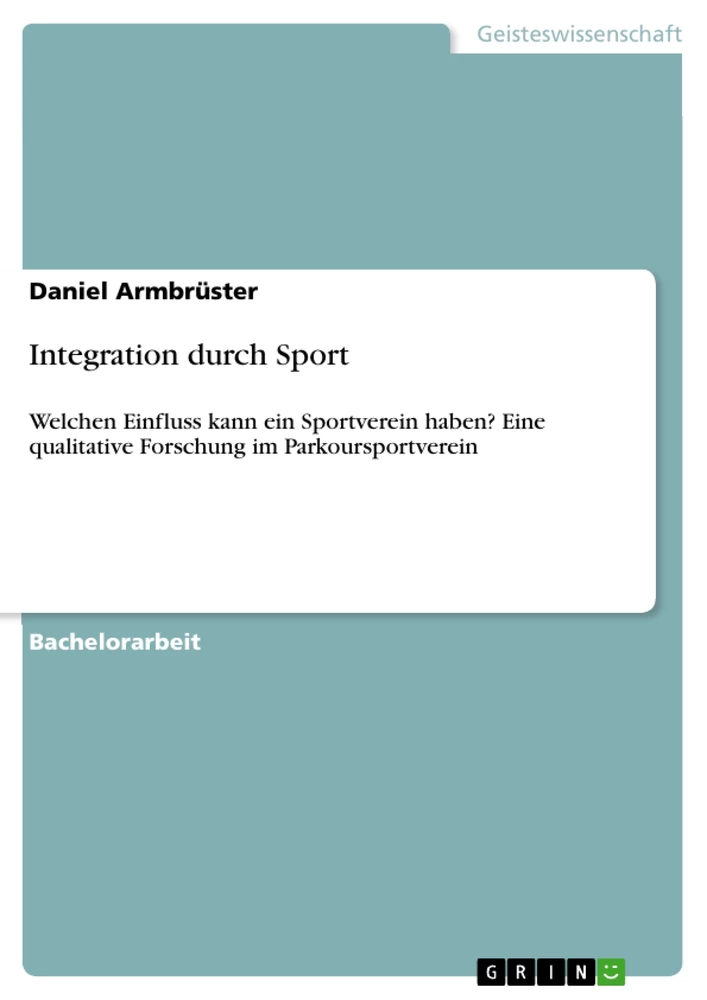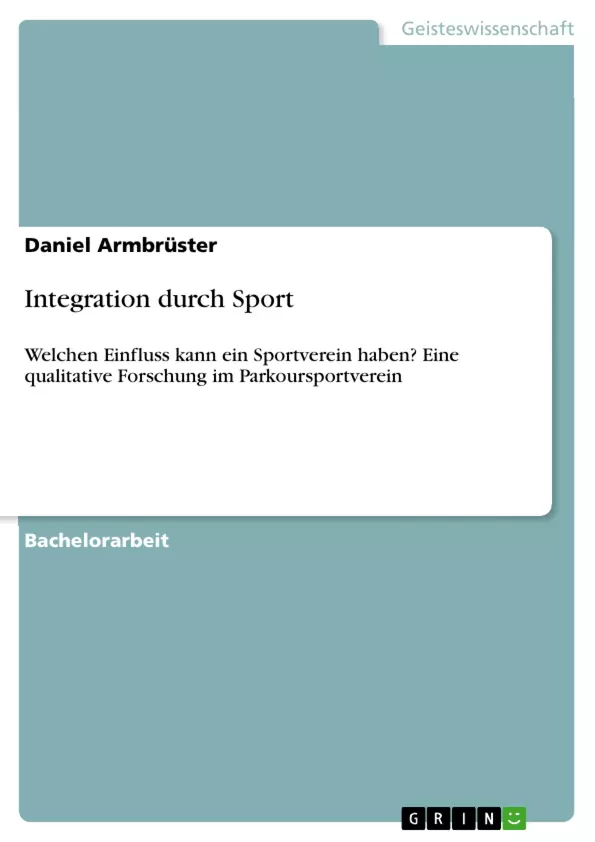Wie fördert Sport den Integrationsprozess? Was für einen Einfluss hat dabei die aktive Mitgliedschaft in einem Sportverein?
Aus eigener Erfahrung als Sportler seit nunmehr 22 Jahren, Ein- und Austreten aus mehreren Vereinen und Austausch mit vielen anderen Sportlern, möchte ich eine zugegeben hoch gegriffene Thesis für diese Bachelor-Arbeit aufstellen:
„Sportvereine können Leben verändern.“
In der folgenden kulturanthropologischen Studie soll anhand von drei ausgewählten narrativen Interviews mit vier Vereinsmitgliedern und einer qualitativen Inhaltsanalyse ein tiefer Einblick in eindrückliche Veränderungen von Kindern und Jugendlichen durch die aktive Mitgliedschaft in einem Parkoursportverein aufgezeigt werden. Gerade in der frühen Sozialisationsphase der Enkulturation und den Anfängen der Akkulturation haben wir noch einen stark prägenden Einfluss auf Kinder und Jugendliche.
Es sollte die Pflicht eines jeden Bürgers sein, dem die Zukunft der Gesellschaft und Gemeinschaft am Herzen liegt, sich für die positive Unterstützung von Kindern und Jugendlichen einzusetzen. In ihnen liegt unsere Zukunft, die Zukunft der Gesell-schaft.
Inhaltsverzeichnis
- 1.0 Einleitung
- 1.1 Erkenntnisinteresse
- 1.2 Lösungsansätze für Integration durch Sport
- 2.0 Vorüberlegungen
- 2.1 Milieu: Parkour
- 2.2 Integration im Sport, Verein
- 3.0 Forschungsdesign
- 3.1 Gütekriterien qualitativer Forschung
- 3.2 Datenerhebung: Narrative Interviews
- 3.3 Auswertung: Qualitative Inhaltsanalyse
- 3.4 Der Forscher als Teil des Feldes
- 4.0 Auswertung und Analyse
- 4.1 Interviewpartner
- 4.2 Kategorien und Analyse
- 4.2a Sportliche Fähigkeiten erlernen / verbessern
- 4.2b Sozialer Einfluss
- 4.2c Soziale Fähigkeiten erlernen / verbessern
- 4.2d Persönliche Fähigkeiten erlernen / verbessern
- 4.2e Bestärkung des Selbstwertes
- 4.2f Analoge Anwendung erlernter Fähigkeiten
- 4.2g Milieu oder Sportart Parkour, Vergleich mit anderen Sportarten
- 4.2h Sportverein & Integration?
- 4.2i Seiteneffekte
- 4.2j Subjektiver Einfluss vom Parkoursportverein auf dein Leben
- 5.0 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht den Einfluss des Parkoursportes auf die soziale Integration von Kindern und Jugendlichen. Sie analysiert, wie die aktive Mitgliedschaft in einem Parkoursportverein den Integrationsprozess von Migranten und Außenseitern fördert und inwiefern diese Erfahrungen auf andere Lebensbereiche übertragen werden können. Im Vordergrund steht die These, dass Sportvereine ein starkes Potenzial für die positive Veränderung von Leben haben.
- Die Rolle des Parkoursportes bei der Integration von Kindern und Jugendlichen
- Der Einfluss des Sportvereins auf die Entwicklung sozialer und persönlicher Fähigkeiten
- Die Auswirkungen des Parkoursportes auf die Selbstwahrnehmung und das Selbstwertgefühl
- Die Übertragbarkeit von im Sport erlernten Kompetenzen auf andere Lebensbereiche
- Die Bedeutung des Sportvereins als Plattform für Integration und soziale Inklusion
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik „Integration durch Sport“ ein und beleuchtet den aktuellen Forschungsstand sowie die Relevanz des Themas. Sie stellt die zentrale Fragestellung der Arbeit dar: Wie fördert Sport den Integrationsprozess und welchen Einfluss hat die aktive Mitgliedschaft in einem Sportverein?
Im zweiten Kapitel werden die grundlegenden Begriffe „Milieu: Parkour“ und „Integration im Sport, Verein“ definiert und näher erläutert. Es wird die Bedeutung des Parkoursportes als spezifische Sportart und die Rolle des Sportvereins im Integrationsprozess beleuchtet. Der Fokus liegt dabei auf der Einordnung des Parkoursportes in das kulturelle Umfeld und den Einfluss der Gruppenzugehörigkeit.
Kapitel drei beschäftigt sich mit dem Forschungsdesign. Es werden die Gütekriterien der qualitativen Forschung vorgestellt und die Methoden der Datenerhebung (narrative Interviews) und der Auswertung (qualitative Inhaltsanalyse) erläutert. Die Besonderheit der Studie liegt in der Einbeziehung des Forschers als Teil des Feldes.
Kapitel vier stellt die Ergebnisse der Auswertung und Analyse dar. Es werden die Interviewpartner vorgestellt und die relevanten Kategorien der Inhaltsanalyse beleuchtet. Dabei werden verschiedene Aspekte des Parkoursportes beleuchtet, wie beispielsweise die Entwicklung sportlicher Fähigkeiten, der soziale Einfluss des Vereins, das Erlernen sozialer Kompetenzen, die Förderung des Selbstwertes und die Übertragbarkeit erlernter Fähigkeiten auf andere Lebensbereiche.
Schlüsselwörter
Parkour, Integration durch Sport, Sportverein, soziale Inklusion, narrative Interviews, qualitative Inhaltsanalyse, Jugendkultur, Selbstwertgefühl, Sozialisation, Akkulturation, Migranten, Außenseiter, gesellschaftliche Teilhabe.
- Quote paper
- Daniel Armbrüster (Author), 2018, Integration durch Sport, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/923002