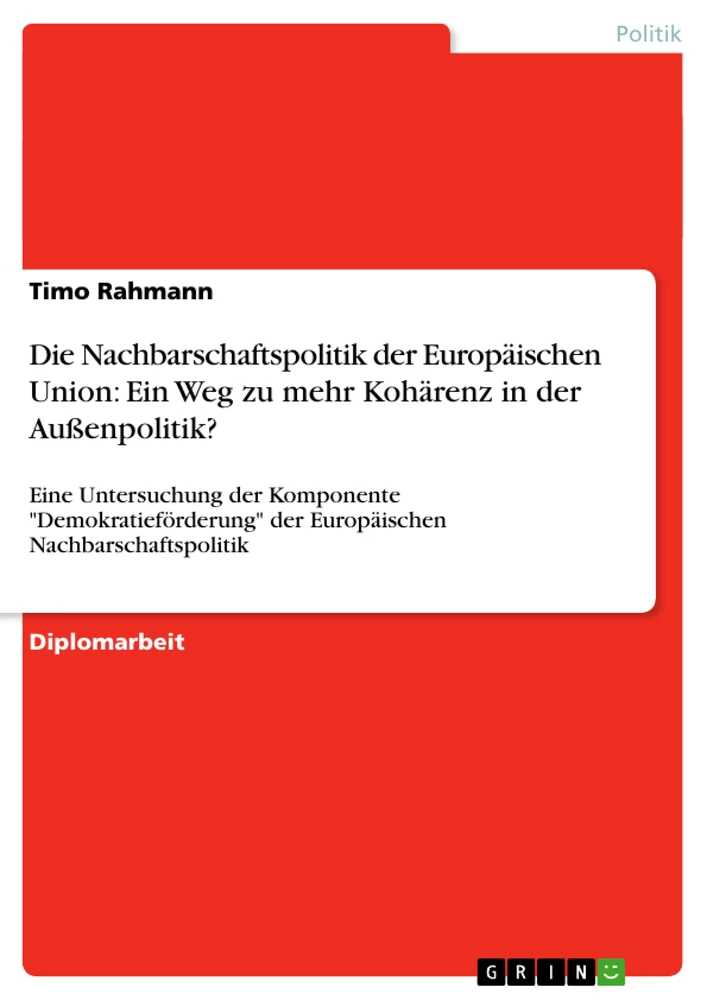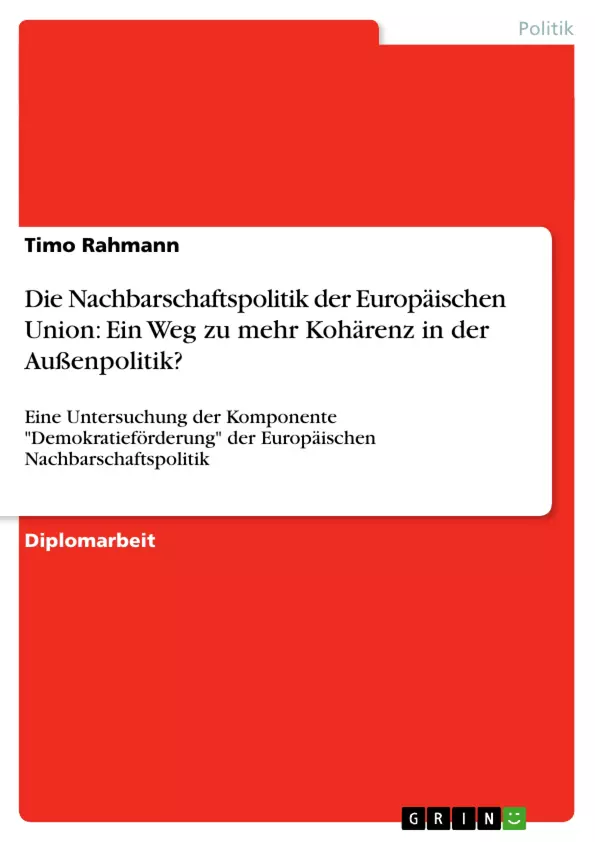Der Untersuchungsgegenstand der vorliegenden Arbeit ist die Komponente Demokratieförderung innerhalb der Europäischen Nachbarschaftspolitik. Hierbei steht die Frage im Vordergrund, ob die ENP als neuer Politikrahmen für die Beziehungen zwischen der EU und ihren Nachbarstaaten zu einem größeren Maß an Kohärenz hinsichtlich der demokratiefördernden Politik beitragen kann. Mit der ENP besteht ein einheitlicher konzeptioneller Rahmen für die Beziehungen der EU zu einem in sich heterogenen Raum von Staaten. Es ließe sich hieraus die Vermutung ableiten, dass die durchgeführte Politik an Einheitlichkeit und Stringenz gewinnt. Der Blick auf frühere bzw. derzeit bestehende Konzepte der EU-Außenpolitik (beispielsweise Gemeinsame Strategien gegenüber Russland, der Ukraine oder dem Mittelmeerraum) zeigt jedoch, dass trotz des vorhandenen Referenzpunktes weiterhin Probleme in Form von sich widersprechenden Politiken auftraten. Einige Beobachter führen dies vornehmlich auf unterschiedliche Interessen der Mitgliedsstaaten zurück, andere auf die Schwäche der supranationalen Institutionen. Eberhard Rhein sieht in der Frage der Kohärenz gewissermaßen ei-nen Lackmus-Test der ENP: „The ENP will only become truly effective if the EU and Member States act in unison.“5 Die Leitfrage dieser Arbeit lautet demnach: Besitzt die ENP das Potential, hier eine Veränderung in Richtung eines Gewinnes an Kohärenz zu bewirken?
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einführung
- 1.1 Fragestellung
- 1.2 Forschungsstand und Literaturlage
- 1.3 Aufbau der Arbeit
- 2 Die EU als außenpolitischer Akteur
- 2.1 Politik oder Nicht-Politik – Paradoxons der EU-Außenpolitik
- 2.2 Kohärenz als Konzept
- 3 Demokratieförderung und EU-Außenpolitik
- 3.1 Begriffsbestimmungen
- 3.1.1 Demokratie
- 3.1.2 Demokratisierung
- 3.1.3 Demokratieförderung
- 3.2 Demokratieförderung auf der außenpolitischen Agenda der EU
- 3.3 Instrumente der EU-Demokratieförderung
- 3.4 Die Demokratisierungspolitik der EU in der Kritik
- 4 Die Europäische Nachbarschaftspolitik - Eine neue Strategie?
- 4.1 Europa und seine Nachbarn – Unterschiedliche Ansätze
- 4.2 Die Agenda und ihr Dilemma
- 4.3 Genese und Konzept der ENP
- 4.4 Normativ-politische Elemente der ENP
- 4.5 Kohärenz und Differenzierung – Simultane Kennzeichen der ENP?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Komponente "Demokratieförderung" der Europäischen Nachbarschaftspolitik (ENP) und analysiert, inwieweit diese zur Kohärenz in der EU-Außenpolitik beiträgt. Die Arbeit befasst sich mit der Entwicklung und den Zielen der ENP, den Instrumenten der Demokratieförderung und den Herausforderungen, die sich aus der Implementierung dieser Politik ergeben.
- Die Entwicklung und die Ziele der Europäischen Nachbarschaftspolitik
- Die Rolle der Demokratieförderung in der EU-Außenpolitik
- Die Instrumente der Demokratieförderung im Rahmen der ENP
- Die Herausforderungen für die Kohärenz der EU-Außenpolitik
- Die Kritik an der Demokratisierungspolitik der EU
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 führt in die Thematik ein und stellt die Fragestellung der Arbeit dar. Kapitel 2 beleuchtet die EU als außenpolitischen Akteur und diskutiert das Konzept der Kohärenz in der EU-Außenpolitik. Kapitel 3 befasst sich mit dem Begriff der Demokratieförderung und analysiert die Instrumente und die Kritik an der Demokratisierungspolitik der EU.
Schlüsselwörter
Europäische Nachbarschaftspolitik, EU-Außenpolitik, Demokratieförderung, Kohärenz, Demokratisierung, Instrumente der Demokratieförderung, Kritik an der EU-Demokratiepolitik.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptziel der Europäischen Nachbarschaftspolitik (ENP)?
Die ENP dient als konzeptioneller Rahmen für die Beziehungen der EU zu ihren Nachbarstaaten, um Stabilität zu fördern und einen gemeinsamen Raum für Sicherheit und Wohlstand zu schaffen.
Welche Rolle spielt die Demokratieförderung in der ENP?
Demokratieförderung ist eine zentrale Komponente der ENP, mit der die EU versucht, demokratische Strukturen und Werte in den Nachbarländern durch verschiedene Instrumente zu stärken.
Was bedeutet Kohärenz in der EU-Außenpolitik?
Kohärenz bezeichnet die Einheitlichkeit und Stringenz der politischen Maßnahmen. Die ENP soll sicherstellen, dass die EU und ihre Mitgliedsstaaten in ihrer Außenpolitik gegenüber Nachbarn an einem Strang ziehen.
Warum wird die Demokratisierungspolitik der EU oft kritisiert?
Kritiker bemängeln oft widersprüchliche Interessen der Mitgliedsstaaten, die Schwäche supranationaler Institutionen oder die mangelnde Effektivität der eingesetzten Instrumente in heterogenen Staatenräumen.
Welche Instrumente nutzt die EU zur Demokratieförderung?
Die EU nutzt im Rahmen der ENP verschiedene diplomatische, finanzielle und technische Instrumente, um Reformprozesse in den Partnerländern zu unterstützen.
- Quote paper
- Timo Rahmann (Author), 2005, Die Nachbarschaftspolitik der Europäischen Union: Ein Weg zu mehr Kohärenz in der Außenpolitik?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/92326