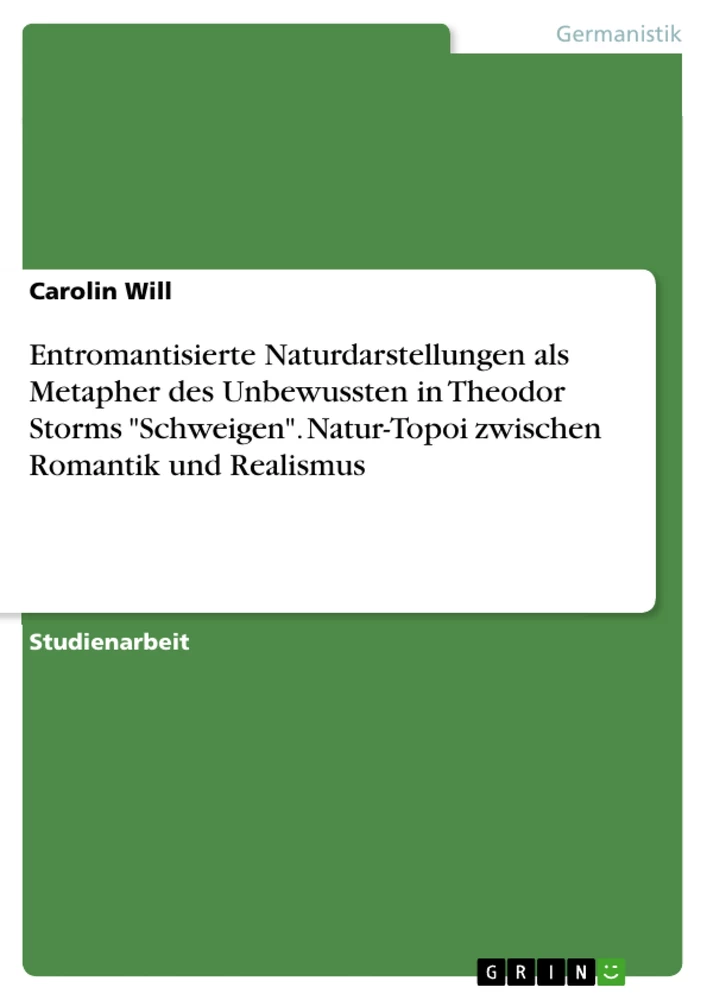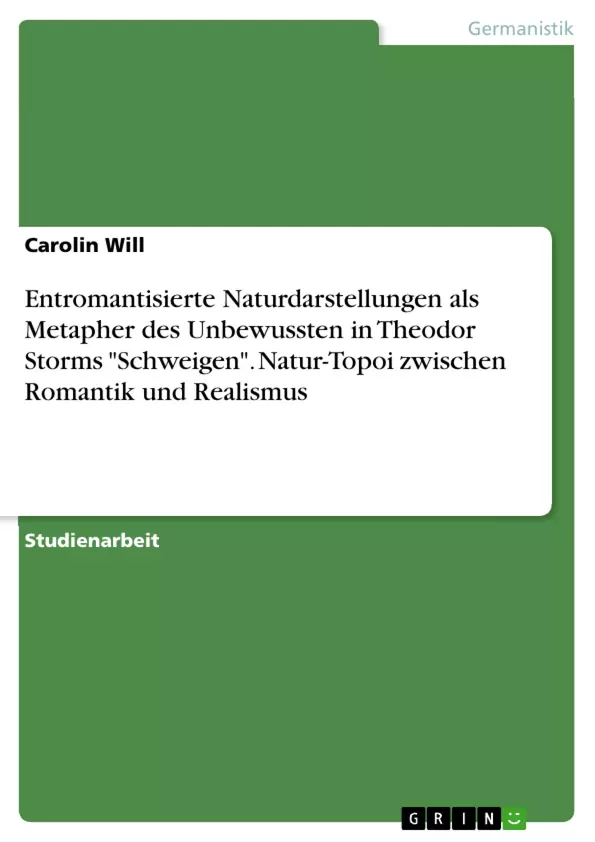Diese Arbeit untersucht die Naturdarstellung in der Übergangsphase von Romantik und Realismus. Dafür wird beispielhaft die Novelle „Schweigen“ von Theodor Storm untersucht. Hier zeigt sich, dass sich Storm romantischer Topoi bedient, deren märchenhaften Szenen sich jedoch stets wieder ins Wahrscheinliche umwendet. Schon der Titel „Schweigen“ fordert zu Interpretation und Beobachtung auf. Diese Arbeit versucht, die stummen Zeichen der Naturdarstellung zu deuten.
Hierfür werden zunächst grundsätzliche Aussagen über das Unbewusste und die Naturvorstellung der Romantik und des Realismus getroffen. Auf ihnen baut die spätere Textbeobachtung auf. Aich stützt sich die nachfolgende Argumentation zumeist auf Sonja Klimeks Thesen aus dem Aufsatz „Waldeinsamkeit – Literarische Landschaft als transitorischer Ort bei Tieck, Stifter, Storm und Raabe.“ Die Aussagen über den entromantisierten Wald lassen sich ohne weiteres auf Storms Werk übertragen. Ein weiterer Fokus sind die Entromantisierungsprozesse der Naturdarstellung. Im Abschluss widmet sich die Arbeit der Frage, inwieweit Strom Naturräume nutzt, um das Unbewusste seiner Figur Rudolf von Schlitz darzustellen.
In der Literatur dient die Beschreibung von Natur oft als Projektionsmittel des nur schwer Greifbaren. Besonders Wald, Gebirge und Topografie sind gern genutzte Metaphern, unterschiedlich je nach literarischer Epoche. In der Romantik ist der Wald ein gleichzeitig verlockender und unheimlicher Ort voller Naturelemente, die verdrängte erotische Wünsche verschlüsseln. Im literarischen Realismus verliert die Natur ihre Fähigkeit, zu sprechen, und ihre magischen Werte.
Inhaltsverzeichnis
- Naturbedeutung in der Übergangszeit von Romantik zu Realismus
- Romantische Natur-Topoi als Metapher des Unbewussten
- Das romantische Unbewusste
- Die romantische Naturdarstellung
- Realistische Natur-Topoi als Metapher des Unbewussten
- Das realistische Unbewusste
- Die realistische Naturdarstellung
- Entromantisierte Naturdarstellung als Metapher des Unbewussten in „Schweigen“
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Bedeutung der Natur in der Übergangszeit von Romantik zu Realismus und analysiert, wie Theodor Storms Novelle „Schweigen“ die Natur als Metapher für das Unbewusste nutzt. Der Fokus liegt auf der Entromantisierung der Naturdarstellung und der Frage, wie das Unbewusste in dieser neuen Perspektive zum Ausdruck kommt.
- Die Veränderung der Naturbedeutung von der Romantik zum Realismus
- Der Einfluss romantischer Natur-Topoi als Metapher für das Unbewusste
- Die Entwicklung der realistischen Naturdarstellung als Metapher für das Unbewusste
- Die Entromantisierung der Naturdarstellung in Storms „Schweigen“
- Die Darstellung des Unbewussten der Figur Rudolf von Schlitz durch Naturräume
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die Bedeutung der Natur als Projektionsmittel für das Unbewusste in der Übergangszeit von Romantik zu Realismus. Es analysiert die Veränderung der Konnotationen von Naturmotiven wie Wald, Gebirge und Topografie in dieser Epoche und stellt den Bezug zur Naturdarstellung in Storms „Schweigen“ her.
Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit den romantischen Natur-Topoi als Metapher für das Unbewusste. Es untersucht die Vorstellung des kollektiven, archaischen Unbewussten in der Romantik, das mit dem Äußeren korrespondiert. Es wird analysiert, wie das Unbewusste in der romantischen Literatur durch Sprache und Musik vermittelt wird und wie die Natur dabei als Ort des Übergangs zum Inneren fungiert.
Das dritte Kapitel widmet sich der realistischen Natur-Topoi als Metapher für das Unbewusste. Es betrachtet die Veränderung der Vorstellung vom Unbewussten im Realismus und analysiert, wie die Natur in dieser Epoche als Ausdruck des Unbewussten genutzt wird.
Das vierte Kapitel untersucht die entromantisierte Naturdarstellung in Storms „Schweigen“ und analysiert, inwieweit die Natur als Metapher für das Unbewusste der Figur Rudolf von Schlitz eingesetzt wird.
Schlüsselwörter
Romantik, Realismus, Unbewusstes, Natur, Naturdarstellung, Metapher, Theodor Storm, Schweigen, Entromantisierung, Rudolf von Schlitz, Wald, Landschaft, Übergangszeit, Topos.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Theodor Storms Novelle „Schweigen“?
Die Novelle dient als Beispiel für die Naturdarstellung in der Übergangsphase von der Romantik zum Realismus und nutzt Naturräume zur Darstellung des Unbewussten.
Was bedeutet „Entromantisierung“ der Natur?
Damit ist der Prozess gemeint, bei dem die Natur ihre magischen und sprechenden Qualitäten der Romantik verliert und im Realismus eher als Projektionsfläche für das Wahrscheinliche dient.
Wie wird das Unbewusste in der Romantik dargestellt?
In der Romantik korrespondiert das Unbewusste mit dem Äußeren; Orte wie Wälder oder Gebirge fungieren als Metaphern für verdrängte Wünsche oder erotische Sehnsüchte.
Wer ist die zentrale Figur in Storms „Schweigen“?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Figur Rudolf von Schlitz und wie seine inneren Zustände durch entromantisierte Naturräume ausgedrückt werden.
Welchen Einfluss hat Sonja Klimek auf diese Arbeit?
Die Argumentation stützt sich maßgeblich auf Klimeks Thesen zur literarischen Landschaft als transitorischem Ort bei Autoren wie Tieck, Stifter und Storm.
Warum ist der Wald ein wichtiger Topos?
Der Wald ist eine klassische Metapher für das Unbewusste, die sich von einem verlockenden, unheimlichen Ort (Romantik) zu einem entmystifizierten Raum (Realismus) wandelt.
- Quote paper
- Carolin Will (Author), 2017, Entromantisierte Naturdarstellungen als Metapher des Unbewussten in Theodor Storms "Schweigen". Natur-Topoi zwischen Romantik und Realismus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/923362