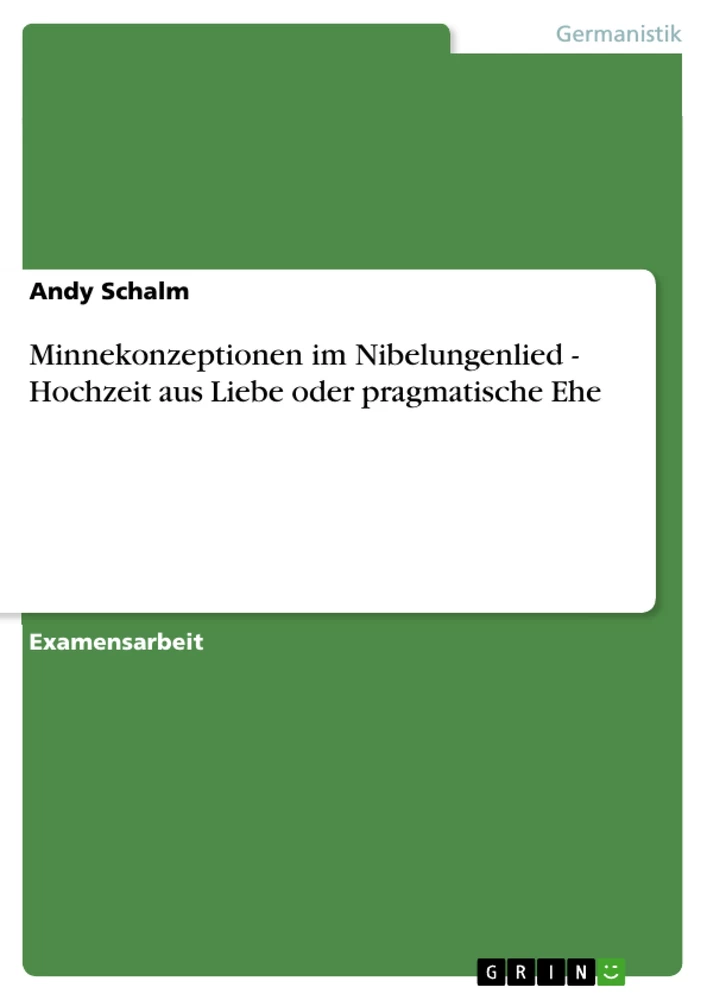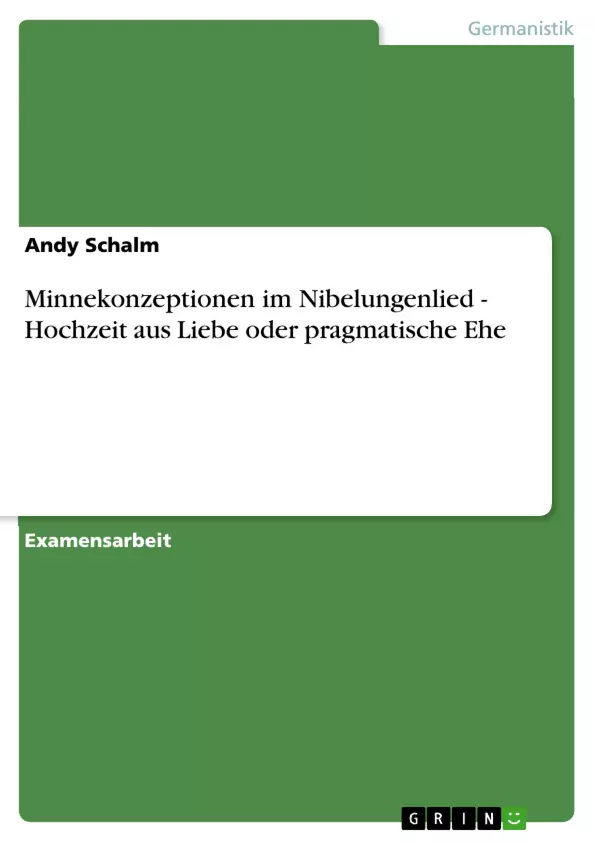Die mittelalterliche Literatur ist bekannt für die Verwendung immer wiederkehrender Erzählelemente, welche in den verschiedenen Dichtungen auftauchen und von den unterschiedlichsten Autoren benutzt wurden. Brach der Autor diese Schemata durch absichtliches Abweichen von der gewohnten inhaltlichen Grundstruktur, durch neue, ungewöhnliche Handlungsweisen der Personen, so vermittelt er thematische Relevanz. Durch den Bruch wird signalisiert, welche Normen und Werte zur Diskussion stehen. Es ließ sich so gezielt auf spezielle Probleme hinweisen, ohne diese explizit auszuformulieren. Daher ist das Auffinden von Schemabrüchen bei der Interpretation mittelalterlicher Texte von besonderer Bedeutung.
Diese Arbeit ist der Versuch, die Funktion und die Bedeutung eines besonders komplexen und vielseitigen Schematismus, den der Minnekonzeptionen, im Nibelungenlied zu erfassen.
Die vorliegende Arbeit will die Motive der Minnenden erforschen, welche zu den Eheschließungen führten, der Frage auf den Grund gehen, warum diese Verbindungen geschlossen werden, wie sich diese Entscheidungen für die handelnden Personen und ihr Umfeld auswirken – auf persönlicher und politischer Ebene. Welche Schemata nutzt der Autor und durchbricht er sie an bestimmten Stellen? Ebenfalls soll die Frage nach Erotik und Politik in der Minne beantwortet werden. Ein Ansatz, der wiederum die Motivation des Minne-Affektes hinterfragt. Treffen die Minnenden eine subjektive Entscheidung für den Partner oder wird im Kollektiv des Hofes aus politischen und ständisch-sozialen Gründen eine Entscheidung getroffen? Und vor allen Dingen: Unterscheiden sich die Minne-Beziehungen des Nibelungenliedes grundlegend und wie äußert sich dies?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Minnekonzeptionen der mittelalterlichen Literatur
- 1.1. Feudale Ehepraxis
- 1.2. Höfische Liebe und Ehe in der Epik
- 1.3. Brautwerbungsschemata der mittelalterlichen Epik
- 1.4. Phänomen der Fernliebe
- 1.5. Nonverbale Zeichen
- 2. Ehe-Minne bei Siegfried und Kriemhild
- 2.1. Siegfrieds Minneaffekt
- 2.1.1. Notwendigkeit des Beweises der Minnetauglichkeit für Siegfried
- 2.1.2. Entstehung der Minne bei Siegfried
- 2.1.3. Werbung um Kriemhild – Planung, Ausführung und Wirkung
- 2.1.4. Erste Begegnung mit Kriemhilde und die Zeit am burgundischen Hofe
- 2.2. Kriemhilds Minneaffekt
- 2.2.1. Tauglichkeit – Schönheit und militärisches Potential
- 2.2.2. Entstehung der Minne bei Kriemhild
- 2.2.3. Entscheidung für Siegfried – subjektiv und frei?
- 2.2.4. Kriemhild als Witwe - der herzen jâmer
- 2.3. Besonderheiten des Minnekonzeptes
- 3. Ehe-Minne bei Gunther und Brünhild
- 3.1. Entstehung der Minne bei Gunther
- 3.2. Ein verschobenes Verhältnis von Schönheit und Macht bei Brünhilde?
- 3.3. Werbung um Brünhild – Planung, Ausführung und Wirkung
- 3.4. Nachweis der Herrschertauglichkeit Gunthers
- 3.4.1. Ankunft und Darstellung von Reichtum und Macht auf Isenstein
- 3.4.2. Demonstration der physischen Stärke
- 3.5. Siegfrieds Dienstmannlüge als Grundlage von Brünhilds Eheversprechen
- 3.6. Gunthers Nachweis der Herrschertauglichkeit in Worms
- 3.7. Entstehung der Minne bei Brünhild
- 3.8. Politischer Zusammenschluss zweier Reiche durch die Ehe-Minne
- 3.9. Besonderheiten des Minnekonzeptes
- 4. Ehe-Minne bei Etzel und Kriemhild
- 4.1. Werbung um Kriemhild – Planung, Ausführung und Wirkung
- 4.1.1. Entstehung der Minne bei Etzel
- 4.1.2. Politische Dimension des Witwerdaseins Etzels - Das Fehlen der Herrinnen-tugent am Hunnenhof
- 4.2. Problem der Religion
- 4.3. Kriemhilds Einwilligung in die Heirat ohne herzeliebe
- 4.3.1. Linderung des Leids durch die machtvolle Position an Etzels Seite?
- 4.3.2. Kriemhilds Zustimmung durch die Aussicht auf dienstbares militärisches Potential
- 4.4. Besonderheiten des Minnekonzeptes
- 5. Zusammenfassung - Ehe-Minnen im Vergleich
- 5.1. Werbungsfahrten im Vergleich
- 5.2. Minne Entstehung und Exklusivität
- 5.2.1. Bei den Werbern
- 5.2.2. Bei den Umworbenen
- 5.3. Arten der Minne
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Funktion und Bedeutung von Minnekonzeptionen im Nibelungenlied. Sie analysiert die drei großen Minnebeziehungen im Epos: Siegfried und Kriemhild, Gunther und Brünhild sowie Etzel und Kriemhild. Die Arbeit verfolgt das Ziel, die Motive der Minnenden zu erforschen, die Hintergründe der Eheschließungen zu beleuchten und die Auswirkungen dieser Verbindungen auf die handelnden Personen und ihr Umfeld zu untersuchen.
- Die Rolle von Minnekonzeptionen als bestimmendes Element der Handlungsschemata in der mittelalterlichen Literatur
- Die verschiedenen Arten der Minne im Nibelungenlied und ihre Auswirkungen auf die Beziehungen zwischen den Figuren
- Das Verhältnis von Minne, Politik und gesellschaftlichen Normen im Epos
- Die Frage nach der subjektiven und kollektiven Entscheidung in der Minne
- Die Analyse der Minnekonzepte in den verschiedenen Eheschließungen und ihre Bedeutung für den Verlauf der Handlung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und erklärt die Bedeutung von Minnekonzeptionen als wiederkehrende Muster in der mittelalterlichen Literatur. Sie beleuchtet den Kontext der Kollektivrezeption und die schemagebundene Erzählweise dieser Zeit. Das Nibelungenlied wird als Beispiel einer Geschichte mit drei großen Minnebeziehungen vorgestellt, die im Zentrum der Arbeit stehen.
Kapitel 1 befasst sich mit Minnekonzeptionen der mittelalterlichen Literatur im Allgemeinen. Es werden die feudale Ehepraxis, die höfische Liebe und Ehe in der Epik, sowie Brautwerbungsschemata der mittelalterlichen Epik und das Phänomen der Fernliebe erörtert.
Kapitel 2 analysiert die Ehe-Minne zwischen Siegfried und Kriemhild. Es werden die Minneaffekte beider Figuren, die Werbung um Kriemhild, sowie die Auswirkungen der Beziehung auf das persönliche und politische Umfeld beleuchtet. Der Fokus liegt auf der Entstehung der Minne bei Siegfried und Kriemhild sowie auf der Frage nach der subjektiven und kollektiven Entscheidung für den Partner.
Kapitel 3 befasst sich mit der Ehe-Minne zwischen Gunther und Brünhild. Die Entstehung der Minne bei Gunther und Brünhild, die Werbung um Brünhild und die Auswirkungen der Beziehung werden untersucht. Das Kapitel analysiert den politischen Zusammenschluss der Reiche durch die Ehe sowie die Rolle der Minne im Kontext von Macht und Herrschaft.
Kapitel 4 behandelt die Ehe-Minne zwischen Etzel und Kriemhild. Die Werbung um Kriemhild, die politische Dimension des Witwerdaseins Etzels und die Rolle der Religion in der Beziehung werden beleuchtet. Der Fokus liegt auf der Frage nach der Einwilligung Kriemhilds in die Heirat ohne herzeliebe und der Suche nach einer Linderung ihres Leids.
Kapitel 5 fasst die Erkenntnisse der vorherigen Kapitel zusammen und vergleicht die verschiedenen Ehe-Minnen im Nibelungenlied. Es werden die Werbungsfahrten, die Entstehung der Minne und die Arten der Minne in den einzelnen Beziehungen analysiert.
Schlüsselwörter
Minnekonzeptionen, Nibelungenlied, Ehe-Minne, Siegfried, Kriemhild, Gunther, Brünhild, Etzel, Brautwerbung, Schematismus, höfische Liebe, feudale Ehepraxis, Politik, Gesellschaftliche Normen, Entscheidungsprozesse, Erotik, Motivforschung, Handlungsanalyse, mittelalterliche Literatur, Rezeption, Schemagebundenheit
Häufig gestellte Fragen
Welche Minne-Beziehungen werden im Nibelungenlied untersucht?
Die Arbeit analysiert die Beziehungen zwischen Siegfried und Kriemhild, Gunther und Brünhild sowie Etzel und Kriemhild.
Was ist der Unterschied zwischen Liebe und pragmatischer Ehe im Mittelalter?
Die Arbeit untersucht, ob Ehen aus subjektiver Zuneigung („herzeliebe“) oder aus politischen und ständisch-sozialen Gründen geschlossen wurden.
Wie entsteht der Minneaffekt bei Siegfried?
Siegfried muss seine Minnetauglichkeit durch Heldentaten beweisen; die Minne zu Kriemhild entwickelt sich als Fernliebe vor ihrer ersten Begegnung.
Welche Rolle spielt die „Dienstmannlüge“ bei Gunther und Brünhild?
Siegfried gibt sich als Gunthers Vasall aus, um Brünhild über Gunthers wahre Stärke zu täuschen, was die Grundlage für ihr Eheversprechen bildet.
Warum heiratet Kriemhild den Hunnenkönig Etzel?
Ihre Entscheidung erfolgt nicht aus Liebe, sondern aus dem Kalkül, durch Etzels militärische Macht Rache für Siegfrieds Tod nehmen zu können.
Was sind „Schemabrüche“ in der mittelalterlichen Literatur?
Wenn Autoren von gewohnten Erzählmustern abweichen, signalisieren sie damit die Diskussion über aktuelle Normen und Werte ihrer Zeit.
- Quote paper
- Andy Schalm (Author), 2006, Minnekonzeptionen im Nibelungenlied - Hochzeit aus Liebe oder pragmatische Ehe, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/92368