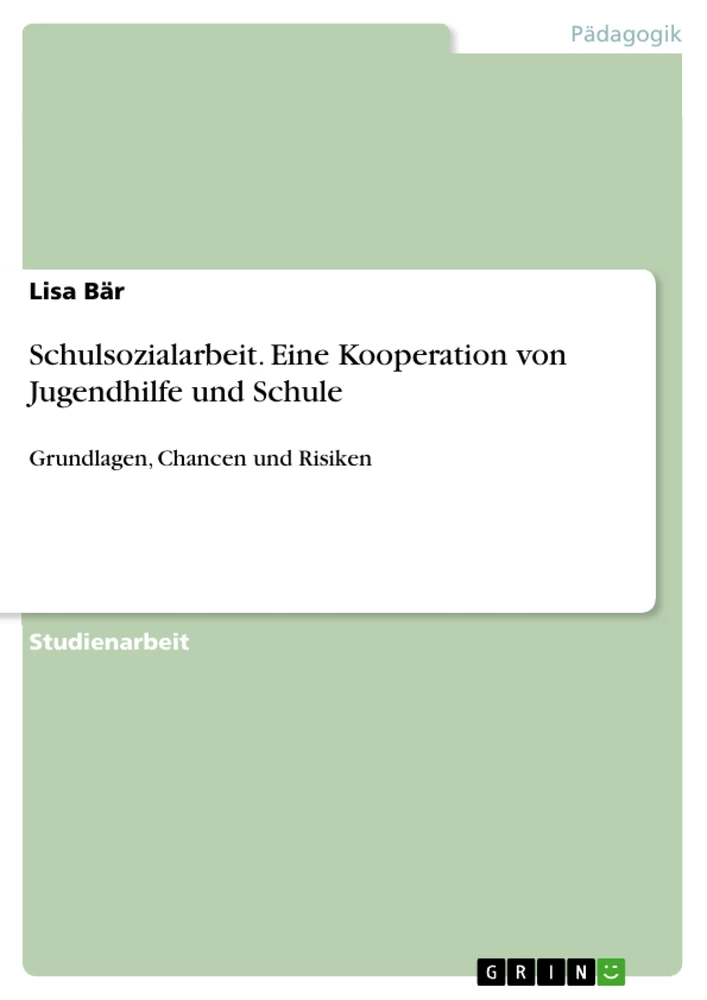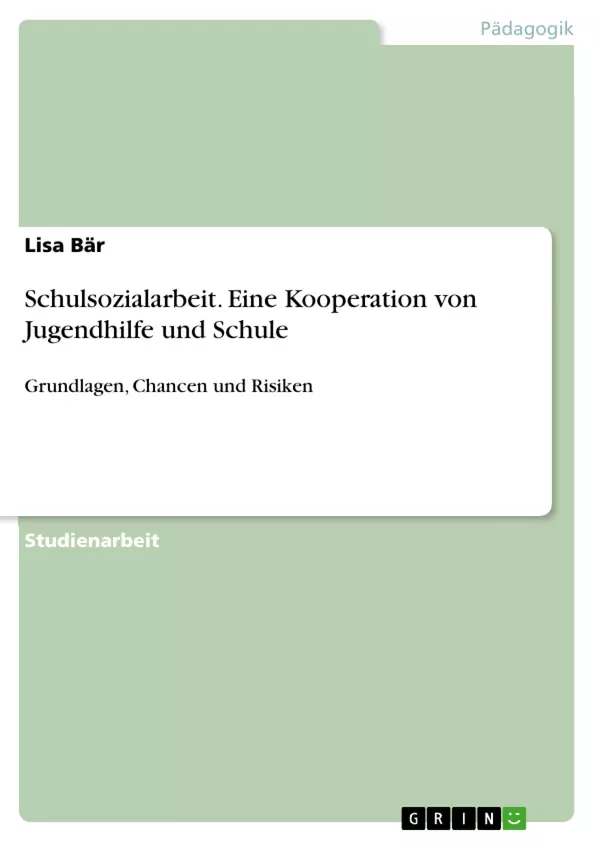Eine Form der Kooperation zwischen Schule und der Jugendhilfe stellt die Schulsozialarbeit dar, welche in dieser Hausarbeit vertiefend vorgestellt werden soll.
Zunächst werden die Funktionen von Schule und Jugendhilfe generell dargelegt. Darauf aufbauend wird sich der Notwendigkeit dieser Kooperationsform zugewandt und diese begründet. Im weiteren Verlauf soll diskutiert werden, auf welches Leitbild sich die Schulsozialarbeit begründet und welche Zielgruppen demnach angesprochen werden, um daran anknüpfend ein Bild von den Leistungsangeboten und Aufgabenbereichen zu vermitteln.
Weiterhin wird die Kooperation von Schule und Jugendhilfe beleuchtet und die damit verbundenen Chancen und Risiken nähergebracht. Bezugnehmend auf Letzteres ist es mir ein Anliegen auch Lösungsvorschläge für die Kooperationsprobleme vorzustellen. In einem abschließenden Fazit werden die Punkte der Ausarbeitung noch einmal zusammenfassend betrachtet.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Schule und Jugendhilfe
- 2.1 Funktion von Schule
- 2.2 Funktion von Jugendhilfe
- 2.3 Begründung für die Kooperation
- 3. Beispiel der Kooperation: Schulsozialarbeit
- 3.1 Begriffserklärung
- 3.2 Leitbild
- 3.3 Ziele und Zielgruppe
- 3.4 Arbeitsbereiche und Leistungsangebot
- 4. Bilanz der Kooperation
- 4.1 Chancen
- 4.2 Risiken
- 4.3 Lösungsvorschläge für Kooperationsprobleme
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Kooperation von Jugendhilfe und Schule am Beispiel der Schulsozialarbeit. Sie untersucht die Funktionen von Schule und Jugendhilfe, beleuchtet die Notwendigkeit und die Begründungen für eine Kooperation zwischen beiden Institutionen und analysiert die Rolle der Schulsozialarbeit als Form dieser Kooperation. Darüber hinaus werden die Chancen und Risiken der Kooperation beleuchtet und Lösungsvorschläge für Kooperationsprobleme erarbeitet.
- Die Funktionen von Schule und Jugendhilfe im Kontext gesellschaftlicher Veränderungen.
- Die Bedeutung und Notwendigkeit der Kooperation von Schule und Jugendhilfe.
- Die Rolle der Schulsozialarbeit als ein Beispiel für die Zusammenarbeit von Schule und Jugendhilfe.
- Die Chancen und Risiken der Kooperation von Schule und Jugendhilfe.
- Lösungsvorschläge für Kooperationsprobleme zwischen Schule und Jugendhilfe.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Kooperation von Schule und Jugendhilfe ein und erläutert die Problematik der zunehmenden Herausforderungen für die Schule im Kontext gesellschaftlicher Veränderungen. Das zweite Kapitel beleuchtet die Funktionen von Schule und Jugendhilfe, wobei die ambivalente Rolle der Schule als Bildungs- und Sozialisationsinstanz und die vielseitigen Aufgaben der Jugendhilfe als unterstützende Institution hervorgehoben werden.
Im dritten Kapitel wird die Schulsozialarbeit als eine Form der Kooperation von Schule und Jugendhilfe vorgestellt. Es werden die Begriffserklärung, das Leitbild, die Ziele und Zielgruppen sowie die Arbeitsbereiche und Leistungsangebote der Schulsozialarbeit detailliert beschrieben.
Das vierte Kapitel befasst sich mit der Bilanz der Kooperation von Schule und Jugendhilfe. Die Chancen der Zusammenarbeit, wie z.B. die verbesserte Förderung von Schülerinnen und Schülern, die Stärkung der Schule als Lebensraum und die Unterstützung von Familien, werden ebenso beleuchtet wie die Risiken, die mit der Kooperation verbunden sind.
Das fünfte Kapitel fasst die Ergebnisse der Hausarbeit zusammen und stellt die wichtigsten Erkenntnisse aus der Untersuchung der Kooperation von Schule und Jugendhilfe dar.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Hausarbeit sind Kooperation, Jugendhilfe, Schule, Schulsozialarbeit, Bildungs- und Sozialisationsinstanz, Funktionen, Chancen, Risiken, Lösungsvorschläge, Integration, Exklusion, Lebenswelt, individuelle und soziale Entwicklung, Benachteiligung, Förderung, Schutz, gesellschaftliche Entwicklung, Veränderungen, Anforderungen, Leistungsangebote, Arbeitsbereiche.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Schulsozialarbeit?
Schulsozialarbeit ist ein Angebot der Jugendhilfe direkt am Standort Schule. Sie unterstützt Schüler, Eltern und Lehrer bei sozialen Problemen und fördert die individuelle Entwicklung der Kinder.
Warum kooperieren Schule und Jugendhilfe?
Aufgrund gesellschaftlicher Veränderungen (z.B. Ganztagsschule, soziale Benachteiligung) kann die Schule ihren Bildungsauftrag oft nur erfüllen, wenn sie durch die sozialpädagogische Expertise der Jugendhilfe unterstützt wird.
Welche Aufgaben hat ein Schulsozialarbeiter?
Zu den Aufgaben gehören Einzelfallhilfe, Beratung bei Konflikten, Krisenintervention, die Durchführung von Gruppenangeboten (z.B. Sozialtraining) und die Vernetzung mit anderen sozialen Diensten.
Wer ist die Zielgruppe der Schulsozialarbeit?
Primäre Zielgruppe sind Schülerinnen und Schüler, aber auch Eltern (Erziehungsberatung) und Lehrkräfte (Unterstützung bei schwierigen Klassensituationen) werden einbezogen.
Welche Risiken gibt es bei dieser Kooperation?
Risiken sind unklare Zuständigkeiten, unterschiedliche Arbeitslogiken (Pädagogik vs. Disziplin) und mögliche Konflikte über die Finanzierung oder die hierarchische Einordnung des Sozialarbeiters im Schulsystem.
- Quote paper
- Lisa Bär (Author), 2017, Schulsozialarbeit. Eine Kooperation von Jugendhilfe und Schule, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/923746