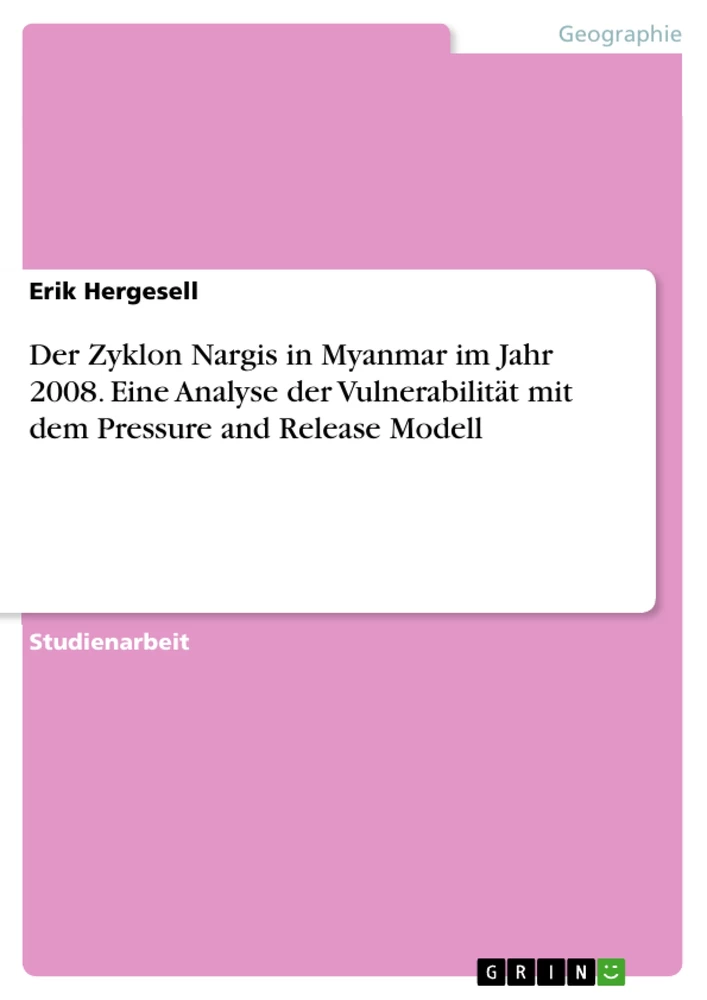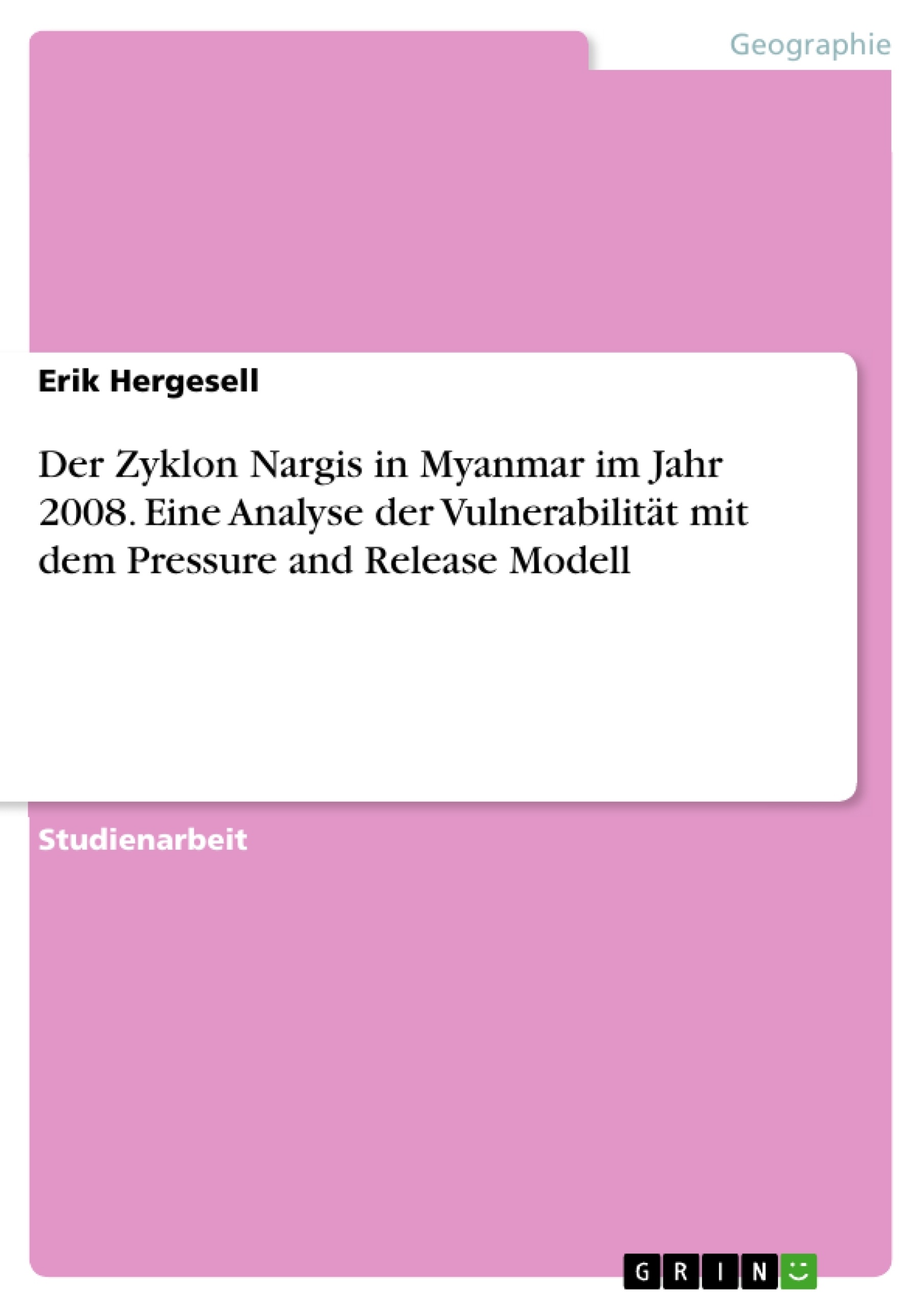In dieser Arbeit werden die Grundursachen, Druckfaktoren und unsicheren Lebenssicherungssysteme gemäß der Hazardforschung am Beispiel des Zyklon Nargis in 2008 diskutiert. Die Ursachen und Faktoren der Vulnerabilität werden allgemein beschrieben. Dabei wird das Pressure and Release Modell zur Klassifikation dieser Faktoren auf die Gesellschaft Myanmars, bevor der Zyklon Nargis auf die Küste Myanmars traf, angewandt.
Das Pressure and Release Modell wird in Kapitel drei erklärt. Die Begriffe Vulnerabilität, Naturgefahr und Hazardforschung wurde bereits verwenden, obgleich die genaue Bedeutung noch nicht geklärt worden ist. Aus diesem Grund ist es wichtig, diese zuerst zu definieren.
Naturgefahren haben trotz gleicher Stärke unterschiedliche Auswirkungen auf die Bevölkerung eines Landes. Die Stärke eines Sturmes wird meist von Opferzahlen, Anzahl der Vermissten und Verletzten oder der finanzielle Summe der Zerstörung verwunden und an deren Größe die mediale Präsenz bestimmt, so auch beim tropischen Zyklon Nargis 2008 in Myanmar.
Die Beleuchtung des komplexen Ursachensystems, welches medial meist vernachlässigt wird, soll aus diesem Grund Gegenstand dieser Arbeit sein. Dabei soll die Frage: Welche sozialen, ökonomischen und politischen Ursachen gibt es für die hohe Zahl von Toten und Schäden in Folge des Zyklons Nargis von 2008 im Irrawaddy Delta in Myanmar? beantwortet werden.
Es ist wichtig die Faktoren zu verstehen, welche diese Heterogenität bewirkt, um mit der Erkenntnis Vulnerabilität vorzubeugen. Nicht nur für Myanmar, sondern auch im Hinblick auf den anthropogenen Klimawandel ist es deshalb wichtig, die Ursachen von Naturkatastrophen zu analysieren, wodurch sich eine fachliche Relevanz ergibt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definition Naturgefahr, Hazardforschung und Vulnerabilität
- Erklärung des Pressure and Release Modell
- Anwendung des Modelles auf den Zyklon Nargis 2008
- Naturgefahr Nargis
- Grundursachen
- Lebenssicherungssysteme und Vorgehen der Regierung als Druckfaktoren
- Unsichere Lebensbedingungen in Myanmar
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die hohen Opferzahlen und Schäden des Zyklons Nargis 2008 im Irrawaddy-Delta in Myanmar. Sie analysiert die komplexen sozialen, ökonomischen und politischen Ursachen, die zur Vulnerabilität der Bevölkerung beigetragen haben. Das Pressure and Release Modell dient als analytisches Framework.
- Analyse der Vulnerabilität der Bevölkerung im Irrawaddy-Delta
- Anwendung des Pressure and Release Modells auf den Fall Nargis
- Die Rolle der politischen und wirtschaftlichen Systeme Myanmars
- Auswirkungen von Mängeln in den Lebenssicherungssystemen
- Bedeutung der unsicheren Lebensbedingungen für die Katastrophenanfälligkeit
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Diese Einleitung führt in das Thema ein und stellt die Forschungsfrage nach den sozialen, ökonomischen und politischen Ursachen der hohen Opferzahlen des Zyklons Nargis. Sie hebt die Bedeutung des Verständnisses von Vulnerabilität hervor und kündigt die Anwendung des Pressure and Release Modells an.
Definition Naturgefahr, Hazardforschung und Vulnerabilität: Dieses Kapitel definiert die zentralen Begriffe Naturgefahr, Hazardforschung und Vulnerabilität. Es erklärt den geographischen und sozialwissenschaftlichen Ansatz der Hazardforschung und beschreibt Vulnerabilität als die sozialökonomische Verwundbarkeit gegenüber Naturgefahren. Die Definition von Vulnerabilität als Eigenschaft von Personen und Gruppen, ihre Fähigkeiten, Naturgefahren vorherzusehen, zu bewältigen und sich von deren Auswirkungen zu erholen, wird erläutert.
Erklärung des Pressure and Release Modell: Dieses Kapitel erklärt das Pressure and Release Modell als Framework zur Analyse der Zusammenhänge zwischen Naturkatastrophen, Naturgefahren und Vulnerabilität. Es beschreibt die drei Ebenen des Modells: Grundursachen (wirtschaftliche und politische Prozesse), Druckfaktoren (Makrokräfte und Mängel in den Lebenssicherungssystemen) und unsichere Verhältnisse (physische Umwelt, lokale Wirtschaft, soziale Beziehungen, staatliche Maßnahmen). Das Modell verdeutlicht, wie diese Ebenen miteinander interagieren und die Vulnerabilität verstärken.
Anwendung des Modelles auf den Zyklon Nargis 2008: Dieses Kapitel wendet das Pressure and Release Modell auf den Zyklon Nargis an. Es beschreibt die Naturgefahr des Zyklons selbst, analysiert die historischen und politischen Grundursachen der Vulnerabilität Myanmars (Machtverhältnisse, Ressourcenverteilung, ethnische Konflikte), die Druckfaktoren (Mängel im Gesundheits- und Bildungswesen, Repressionspolitik der Regierung, mangelnde Infrastruktur), und die unsicheren Lebensbedingungen (traditionelle, wenig wetterfeste Häuser, mangelnde Infrastruktur, fehlende Warnungen). Es verknüpft diese Faktoren miteinander, um die Katastrophe zu erklären.
Schlüsselwörter
Zyklon Nargis, Vulnerabilität, Pressure and Release Modell, Myanmar, Hazardforschung, Naturkatastrophe, politische Systeme, wirtschaftliche Systeme, Lebenssicherungssysteme, Armut, Machtverhältnisse, Repression, Infrastruktur, Katastrophenvorsorge.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Dokument: Analyse des Zyklons Nargis 2008
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die hohen Opferzahlen und Schäden des Zyklons Nargis 2008 im Irrawaddy-Delta in Myanmar. Sie untersucht die komplexen sozialen, ökonomischen und politischen Ursachen, die zur Vulnerabilität der Bevölkerung beigetragen haben, unter Verwendung des Pressure and Release Modells als analytisches Framework.
Welche Themen werden im Dokument behandelt?
Das Dokument behandelt die Definition von Naturgefahren, Hazardforschung und Vulnerabilität. Es erklärt das Pressure and Release Modell und wendet es auf den Zyklon Nargis an. Die Analyse umfasst die Naturgefahr selbst, die Grundursachen (historische und politische Faktoren), Druckfaktoren (Mängel in Lebenssicherungssystemen und staatliche Maßnahmen) und unsichere Lebensbedingungen der Bevölkerung im Irrawaddy-Delta.
Was ist das Pressure and Release Modell und wie wird es angewendet?
Das Pressure and Release Modell ist ein analytisches Framework zur Erklärung von Vulnerabilität gegenüber Naturkatastrophen. Es betrachtet drei Ebenen: Grundursachen (wirtschaftliche und politische Prozesse), Druckfaktoren (Makrokräfte und Mängel in Lebenssicherungssystemen) und unsichere Verhältnisse (physische Umwelt, lokale Wirtschaft, soziale Beziehungen, staatliche Maßnahmen). In der Arbeit wird dieses Modell auf den Zyklon Nargis angewendet, um die Interaktion dieser Ebenen und ihre Verstärkung der Vulnerabilität zu analysieren.
Welche Faktoren haben zur Vulnerabilität der Bevölkerung in Myanmar beigetragen?
Die Vulnerabilität der Bevölkerung wird auf verschiedene Faktoren zurückgeführt: historische und politische Grundursachen (Machtverhältnisse, Ressourcenverteilung, ethnische Konflikte), Druckfaktoren (Mängel im Gesundheits- und Bildungswesen, Repressionspolitik der Regierung, mangelnde Infrastruktur) und unsichere Lebensbedingungen (traditionelle, wenig wetterfeste Häuser, mangelnde Infrastruktur, fehlende Warnungen).
Welche Rolle spielen politische und wirtschaftliche Systeme in der Analyse?
Politische und wirtschaftliche Systeme spielen eine zentrale Rolle. Die Arbeit analysiert, wie Machtverhältnisse, Ressourcenverteilung, Repressionspolitik und Mängel in der Infrastruktur die Vulnerabilität der Bevölkerung verstärkt haben und zu den hohen Opferzahlen beigetragen haben.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt des Dokuments?
Schlüsselwörter sind: Zyklon Nargis, Vulnerabilität, Pressure and Release Modell, Myanmar, Hazardforschung, Naturkatastrophe, politische Systeme, wirtschaftliche Systeme, Lebenssicherungssysteme, Armut, Machtverhältnisse, Repression, Infrastruktur, Katastrophenvorsorge.
Welche Kapitel umfasst das Dokument?
Das Dokument enthält eine Einleitung, Kapitel zur Definition von zentralen Begriffen (Naturgefahr, Hazardforschung, Vulnerabilität), eine Erklärung des Pressure and Release Modells, die Anwendung des Modells auf den Zyklon Nargis und ein Fazit/Ausblick.
- Citar trabajo
- Erik Hergesell (Autor), 2020, Der Zyklon Nargis in Myanmar im Jahr 2008. Eine Analyse der Vulnerabilität mit dem Pressure and Release Modell, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/923902