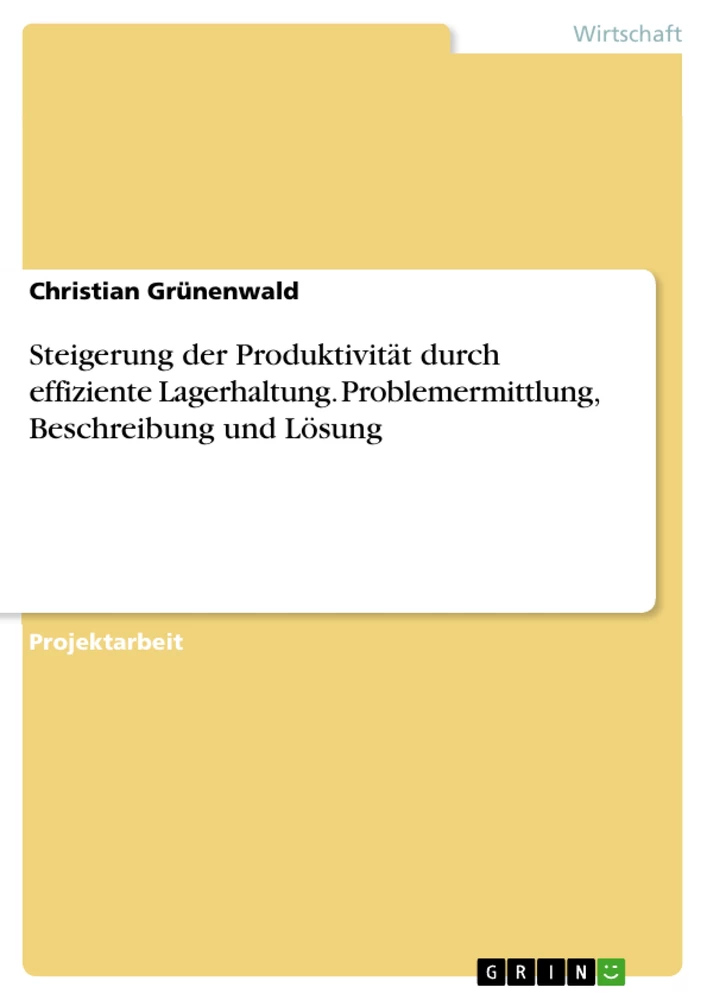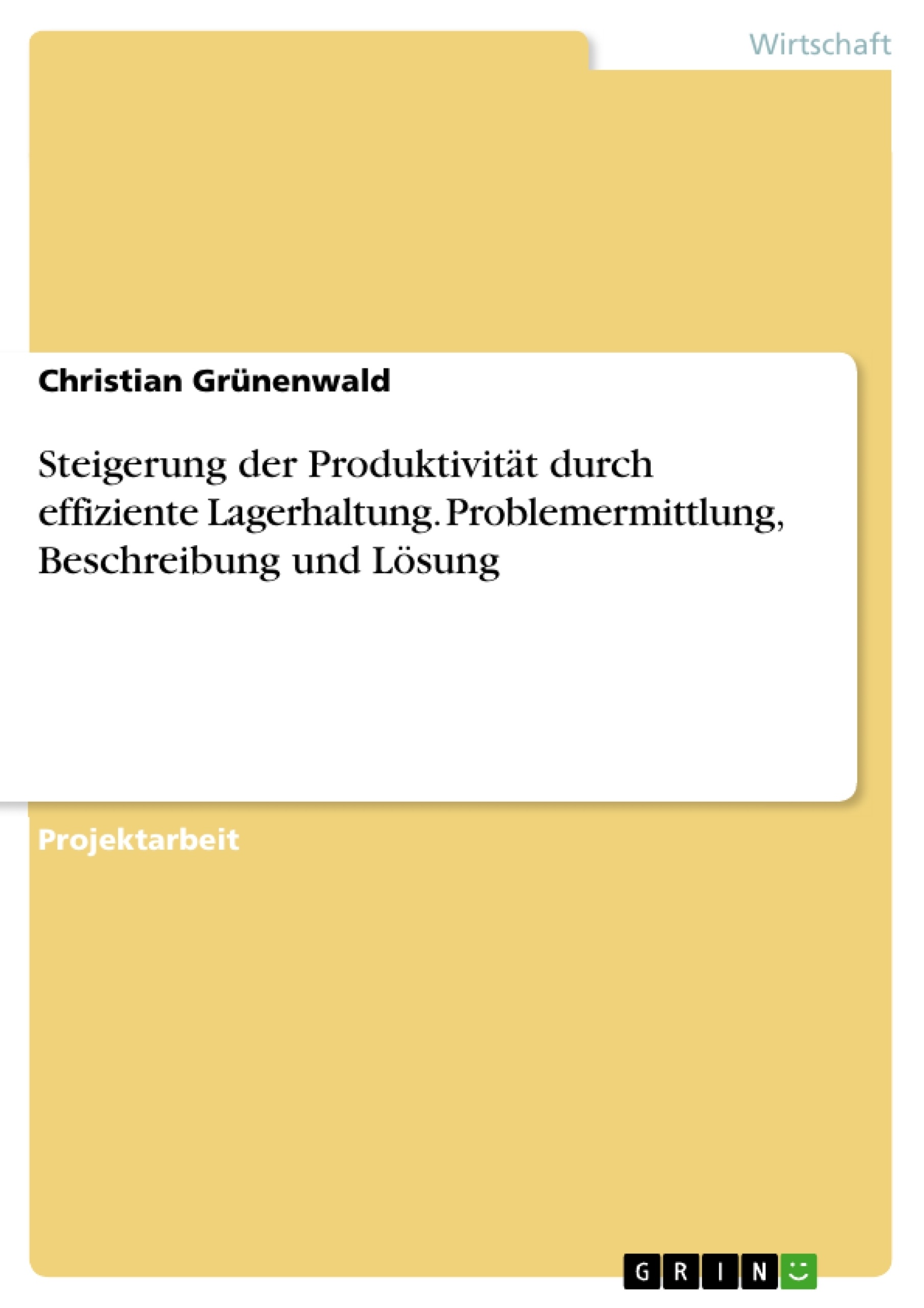Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Problemermittlung, -beschreibung und -lösung zur Produktivitätssteigerung durch effiziente Lagerhaltung. Ziel der Arbeit ist die Steigerung der personellen Produktivität im Zulagerungsbereich um 20% und im Auslagerungsbereich auf 58 Positionen pro Stunde, sowie die Senkung der Nachschubquote um 40% durch effektive Lagerhaltung.
Die Logistik gewinnt durch stetig wachsende Märkte, Warensortimente und Wettbewerbsdruck immer mehr an Bedeutung. Die Großhandelsunternehmen sind aus Kosten- und Platzgründen die Lagerhaltung und deren beinhalteten logistischen Prozesse innerhalb des Lagers effektiver zu gestalten. Diese Vorgänge werden in der Warenwirtschaft subsumiert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsdefinition
- Logistik und Materialwirtschaft
- Wareneingang
- Lagerhaltung
- Lagersysteme
- Kommissionierung
- Kommissionierwegeoptimierung
- Logistik - Controlling
- Unternehmensportrait
- Lagerproblematik XXX
- Lagersystem der XXX
- Lagerstrategien der Firma XXX
- Kommissionierung bei XXX
- Logistischer Soll-Ist-Vergleich der Firma XXX
- Lagerproblematik XXX
- Fazit/ Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Projektarbeit untersucht die Möglichkeiten zur Steigerung der Produktivität durch effiziente Lagerhaltung bei der Firma XXX. Ziel ist es, die personelle Produktivität im Zulagerungsbereich um 20% und im Auslagerungsbereich auf 58 Positionen pro Stunde zu erhöhen. Gleichzeitig soll die Nachschubquote durch effektive Lagerhaltung um 40% gesenkt werden.
- Optimierung der Lagerplatz-, Flächen- und Laufweggestaltung
- Einführung neuer Lagertechnologien und Kommissioniersysteme
- Analyse und Verbesserung der logistischen Prozesse im Unternehmen
- Steigerung der Effizienz der Warenwirtschaft und Lagerhaltung
- Reduzierung der Lagerkosten und Verbesserung der Flächenproduktivität
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung führt in die Problematik der Produktivitätssteigerung durch effiziente Lagerhaltung ein und beleuchtet die aktuelle Situation bei der Firma XXX.
- Begriffsdefinition: Dieses Kapitel definiert wichtige Begriffe aus dem Bereich der Logistik und Materialwirtschaft, wie z.B. Wareneingang, Lagerhaltung, Kommissionierung, und Logistik-Controlling.
- Logistik und Materialwirtschaft: Dieses Kapitel befasst sich mit den zentralen Aspekten der Logistik und Materialwirtschaft, darunter Wareneingang, Lagerhaltung und Kommissionierung. Es beleuchtet verschiedene Lagersysteme und deren Anwendung in der Praxis.
- Unternehmensportrait: Hier wird die Firma XXX genauer vorgestellt, inklusive der bestehenden Lagerproblematik. Das Kapitel analysiert das Lagersystem, die Lagerstrategien und die Kommissionierungsprozesse im Unternehmen.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Projektarbeit sind: Produktivitätssteigerung, effiziente Lagerhaltung, Logistik, Materialwirtschaft, Lagersystem, Kommissionierung, Lagerplatzoptimierung, Flächenproduktivität, Personalkosten, Wareneingang, Warenausgang, Nachschubquote, XXX.
Häufig gestellte Fragen
Wie kann die Produktivität im Lager gesteigert werden?
Durch effiziente Lagerhaltung, Optimierung der Laufwege, Einführung neuer Kommissioniersysteme und eine verbesserte Flächennutzung.
Was ist das Ziel der Projektarbeit zur Lagerhaltung?
Die Steigerung der personellen Produktivität im Zulagerungsbereich um 20 % und die Senkung der Nachschubquote um 40 %.
Was versteht man unter Kommissionierwegeoptimierung?
Die Planung kürzester Wege für Lagermitarbeiter, um Waren für den Versand zusammenzustellen, was Zeit und Personalkosten spart.
Warum ist Logistik-Controlling wichtig?
Es ermöglicht einen Soll-Ist-Vergleich der logistischen Prozesse und hilft bei der Identifizierung von Schwachstellen im Lager.
Welche Rolle spielt die Warenwirtschaft?
Sie subsumiert alle Vorgänge von Wareneingang bis Warenausgang und bildet die Basis für eine effektive Materialwirtschaft.
- Quote paper
- Christian Grünenwald (Author), 2013, Steigerung der Produktivität durch effiziente Lagerhaltung. Problemermittlung, Beschreibung und Lösung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/924084