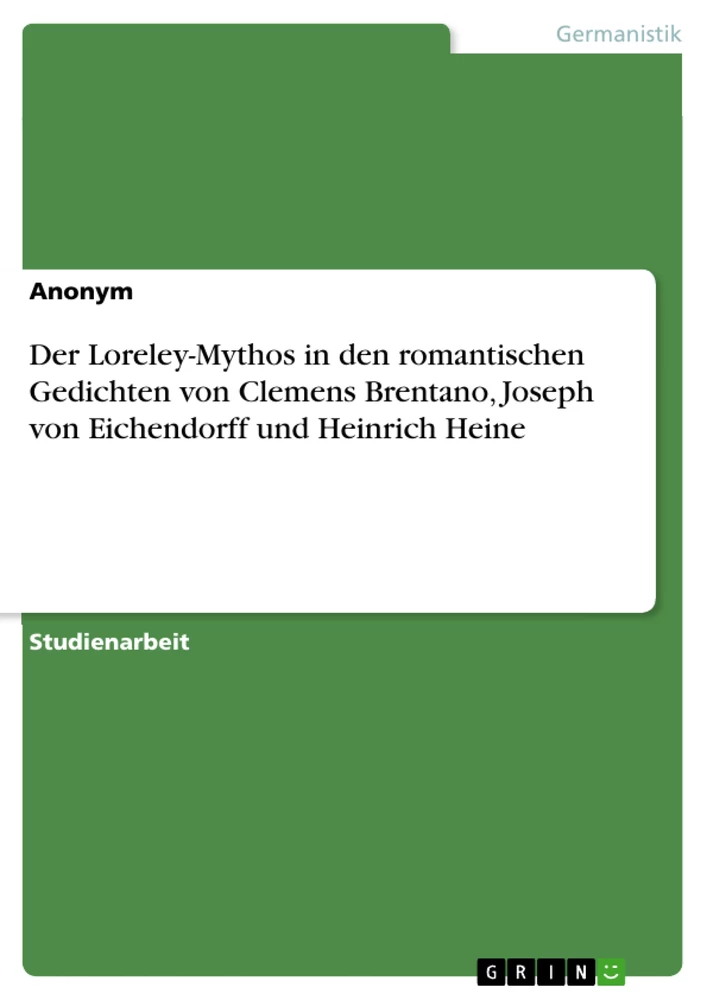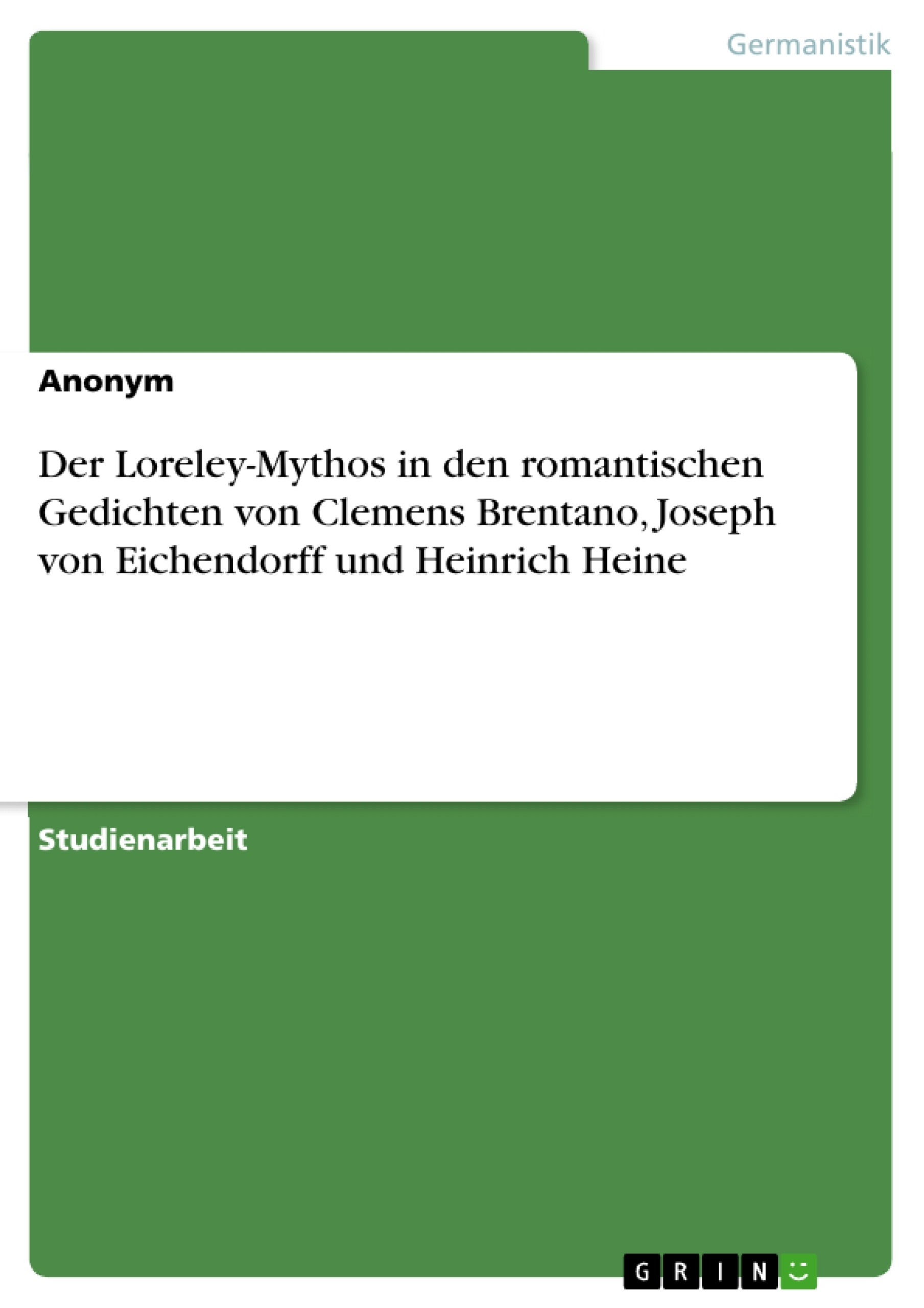In der Arbeit wird sich mit der Entwicklung der Loreley-Gestalt in den Gedichten von den Anfängen Brentanos, über Eichendorff bis Heine beschäftigt. Dazu werden die einzelnen Gedichte der historischen Reihenfolge nach interpretiert und analysiert sowie anschließend mit den jeweils vorher behandelten Gedichten verglichen. Zuerst wird Clemens Brentanos Ballade, dann Joseph von Eichendorffs Gedicht und anschließend Heinrich Heines Werk betrachtet. So erhält man einen guten Überblick über die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Loreley-Figuren der drei Dichter und über die Entwicklung zu dem heute so berühmten sirenenähnlichen Wesen von Heine.
Wer hat den Loreley-Mythos ins Leben gerufen? Bei Heine ist die Rede von einem „Märchen aus alten Zeiten“: Entspringt diese Frauenfigur also aus einer alten deutschen Sage aus dem Mittelalter? So alt wie Heine es in seinem Werk glauben macht, ist der Mythos aber gar nicht. Denn was viele nicht wissen, ist, dass der Romantiker Clemens Brentano Anfang des 19. Jahrhunderts der Erfinder der verführerischen Jungfrau war. Doch Brentanos Loreley war noch keine sirenenartige Frau, die auf dem Felsen am Rhein sitzt uns singt. In den Anfängen des Mythos war sie ein normales, bürgerliches Mädchen, wobei wesentliche Grundzüge der bekannten Loreley Heines schon vorhanden waren. Jedoch kann man auch einige Unterschiede feststellen, die deshalb auch Heines Loreley und nicht Brentanos so berühmt machten. Heines Variante wird als eine Art Volkssage angesehen, die das Bild der Loreley nachhaltig geprägt hat und auf diese sich weitere Dichter nach Heine bis heute noch beziehen.
Wie aber wurde aus Brentanos Figur die heute so bekannte Heines? Die schöne Jungfrau wurde von vielen Dichtern in ihren Werken aufgegriffen und weiterentwickelt. Mystische Wesen wie Sirenen, Hexen, Nymphen und Nixen beeinflussten den Charakter maßgeblich. Unter anderem veröffentlichte zwischen Brentano und Heine auch Joseph von Eichendorff, ebenso ein Dichter der Romantik, eine ganz eigene Version der Loreley, auf die in dieser Arbeit ebenso eingegangen wird. Sein Gedicht spielt nicht unmittelbar an dem Felsen am Rhein, sondern in einem Wald. Zudem stellt Eichendorffs Loreley eine Waldhexe dar.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Clemens Brentano: „Zu Bacharach am Rheine“
- Joseph von Eichendorff: „Waldgespräch“
- Heinrich Heine: „Ich weiß nicht, was soll es bedeuten...“
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung des Loreley-Mythos in der Romantik anhand der Gedichte von Clemens Brentano, Joseph von Eichendorff und Heinrich Heine. Ziel ist es, die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der jeweiligen Loreley-Darstellungen aufzuzeigen und die Transformation der Figur von einem bürgerlichen Mädchen zu der bekannten sirenenhaften Gestalt Heines nachzuvollziehen.
- Entwicklung des Loreley-Mythos in der Romantik
- Vergleichende Analyse der Gedichte von Brentano, Eichendorff und Heine
- Transformation der Loreley-Figur
- Einfluss mythischer Wesen auf die Loreley-Darstellung
- Unterschiede und Gemeinsamkeiten in der Darstellung der Loreley bei den drei Dichtern
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt den bekannten Vers aus Heines Gedicht „Ich weiß nicht, was soll es bedeuten...“ vor. Sie erläutert die Bedeutung des Loreley-Felsens und den Mythos der Loreley, der Schiffer durch ihren Gesang in den Tod lockt. Die Einleitung hebt hervor, dass Clemens Brentano als Erfinder der Loreley-Figur gilt, deren Darstellung sich im Laufe der Zeit bis hin zu Heines berühmter Version weiterentwickelt hat. Die Arbeit kündigt an, die Gedichte von Brentano, Eichendorff und Heine in chronologischer Reihenfolge zu analysieren und zu vergleichen, um die Entwicklung der Loreley-Gestalt nachzuzeichnen.
2. Clemens Brentano: „Zu Bacharach am Rheine“: Dieses Kapitel befasst sich mit Brentanos Ballade „Zu Bacharach am Rheine“, die als Ursprungsversion des Loreley-Mythos gilt. Es wird die Entstehungszeit der Ballade diskutiert und die Unterschiede zwischen der ursprünglichen Fassung in „Godwi“ und der späteren Version in den „Rheinmärchen“ hervorgehoben. Die Analyse konzentriert sich auf die sprachlichen Mittel und den mittelalterlichen Stil der Ballade, der ihr einen märchenhaften Charakter verleiht. Die Figur der Lore Lay wird als bürgerliches Mädchen präsentiert, das im Vergleich zu späteren Interpretationen andere Eigenschaften aufweist. Die Verwendung des Präteritums und stilistische Merkmale wie Apokopen und Inversionen werden im Kontext ihrer Wirkung auf die Darstellung der Geschichte analysiert.
Schlüsselwörter
Loreley-Mythos, Romantik, Clemens Brentano, Joseph von Eichendorff, Heinrich Heine, Gedichtanalyse, literarische Entwicklung, Volkslied, Sirene, Märchen, Sage, Vergleichende Literaturwissenschaft.
Häufig gestellte Fragen (FAQ): Analyse des Loreley-Mythos in der Romantik
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Entwicklung des Loreley-Mythos in der Romantik anhand von Gedichten dreier bedeutender Romantiker: Clemens Brentano, Joseph von Eichendorff und Heinrich Heine. Der Fokus liegt auf dem Vergleich der jeweiligen Darstellungen der Loreley und der Nachverfolgung ihrer Transformation von einem bürgerlichen Mädchen zu der bekannten, sirenenhaften Figur in Heines Gedicht.
Welche Gedichte werden untersucht?
Die Arbeit untersucht Clemens Brentanos „Zu Bacharach am Rheine“, Joseph von Eichendorffs „Waldgespräch“ (obwohl nicht explizit im Inhaltsverzeichnis erwähnt, impliziert der Text seine Einbeziehung) und Heinrich Heines „Ich weiß nicht, was soll es bedeuten…“. Die Gedichte werden chronologisch analysiert, um die Entwicklung der Loreley-Figur nachzuvollziehen.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Unterschiede und Gemeinsamkeiten in der Darstellung der Loreley bei den drei Dichtern aufzuzeigen. Sie untersucht die Transformation der Figur im Laufe der Zeit und analysiert den Einfluss mythischer Wesen auf ihre Darstellung. Ein zentraler Punkt ist die Nachzeichnung der Entwicklung des Mythos von Brentanos ursprünglicher Version bis zu Heines bekannter Interpretation.
Wie wird die Analyse der Gedichte durchgeführt?
Die Analyse umfasst einen Vergleich der sprachlichen Mittel, des Stils und der Charakterisierung der Loreley in den jeweiligen Gedichten. Bei Brentano wird beispielsweise der mittelalterliche Stil und die Verwendung von Präteritum, Apokopen und Inversionen untersucht. Die Arbeit betrachtet auch die Unterschiede zwischen der ursprünglichen und späteren Version von Brentanos „Zu Bacharach am Rheine“.
Welche Rolle spielt Clemens Brentano in dieser Analyse?
Clemens Brentano wird als der „Erfinder“ der Loreley-Figur angesehen. Seine Ballade „Zu Bacharach am Rheine“ gilt als Ursprungsversion des Mythos. Die Arbeit analysiert Brentanos Darstellung der Loreley als bürgerliches Mädchen und vergleicht sie mit den späteren Interpretationen Eichendorffs und Heines.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Loreley-Mythos, Romantik, Clemens Brentano, Joseph von Eichendorff, Heinrich Heine, Gedichtanalyse, literarische Entwicklung, Volkslied, Sirene, Märchen, Sage, Vergleichende Literaturwissenschaft.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, Kapitel zu den einzelnen Gedichten von Brentano, Eichendorff und Heine und ein Fazit. Die Einleitung stellt den Loreley-Mythos vor und skizziert den Ansatz der Arbeit. Jedes Kapitel analysiert das jeweilige Gedicht im Detail. Das Fazit fasst die Ergebnisse zusammen.
Für wen ist diese Arbeit bestimmt?
Die Arbeit ist für Leser gedacht, die sich für die deutsche Romantik, Literaturwissenschaft und den Loreley-Mythos interessieren. Der akademische Charakter der Arbeit zeigt sich in der strukturierten Analyse und der Verwendung von Fachbegriffen.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2019, Der Loreley-Mythos in den romantischen Gedichten von Clemens Brentano, Joseph von Eichendorff und Heinrich Heine, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/924242