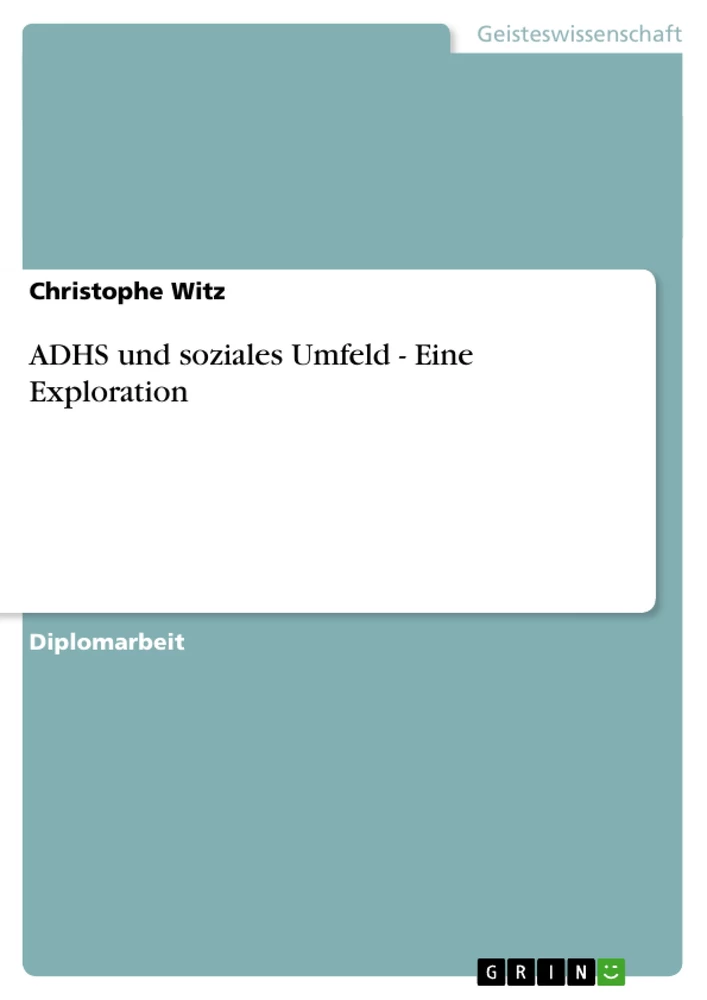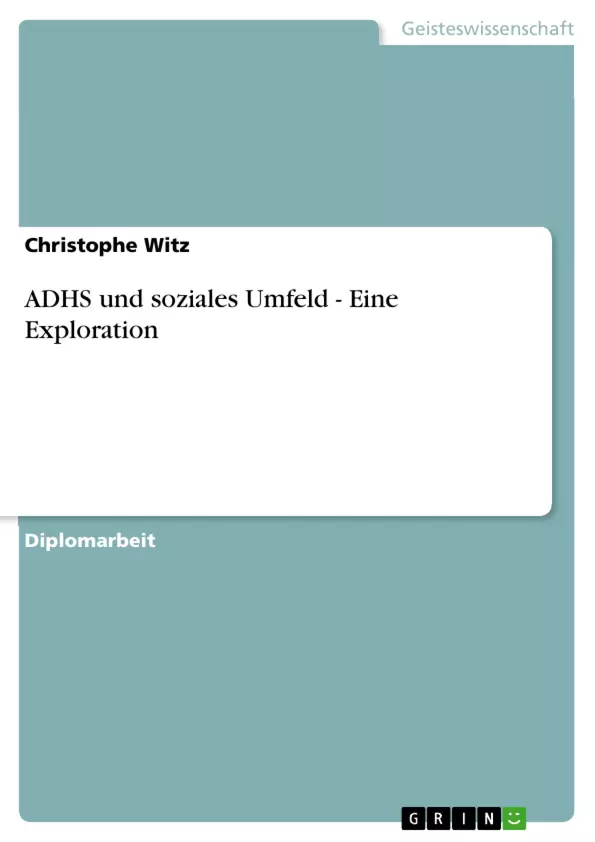Die Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) ist zusammen mit aggressiven Verhaltensstörungen die häufigste psychische Störung im Kindes- und Jugendalter. In den vergangenen Jahren und Jahrzehnten hat diese Störung viel öffentliches (und Forschungs-) Interesse erfahren. Im Zentrum dieses Interesses standen Fragen wie z.B. diejenige nach der Verursachung der Störung oder nach den Möglichkeiten der verschiedenen Therapieformen.
Der Theorieteil der vorliegenden Arbeit stellt die bisherigen Ergebnisse der Forschung zu diesem Thema vor. Das besondere Augenmerk liegt dabei auf Faktoren des sozialen Umfelds. Welche Rolle spielt dieses Umfeld bei der Verursachung und Aufrechterhaltung der hyperkinetischen Störung? Dieser Frage soll in der vorliegenden Arbeit nachgegangen werden.
Der empirische Teil der Studie untersucht ganz konkret den Zusammenhang zwischen elterlichem Erziehungsverhalten und Aufmerksamkeitsdefiziten bei Kindern. Die dabei verwendeten Begrifflichkeiten und Messinstrumente werden in den vorangehenden Kapiteln vorgestellt werden.
Um den Übergang vom theoretischen zum empirischen Teil zu erleichtern, ist ein Kapitel eingefügt, welches die bisherigen Erkenntnnisse zu ADHS und sozialem Umfeld nochmals zusammenfasst und ein Modell vorstellt, in dessen Rahmen die zu erwartenden empirischen Ergebnisse eingeordnet werden können. Da die zum gegenwärtigen Zeitpunkt vorliegenden Ergebnisse zu einer umfassenden Modellbildung nicht ausreichen, ist der vorgestellte Ansatz eher als Arbeitsmodell aufzufassen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)
- 2.1 Definition und Geschichte
- 2.2 Diagnostische Kriterien
- 2.2.1 Differentialdiagnose
- 2.2.2 Klassifikation nach ICD-10
- 2.2.3 Klassifikation nach DSM-IV
- 2.2.4 Diagnostische Leitlinien
- 2.2.5 Komorbidität
- 2.3 Beschreibung des Störungsbilds
- 2.3.1 Prävalenz
- 2.3.2 Verlauf
- 2.4 Ätiologie
- 2.4.1 Genetische Faktoren
- 2.4.2 Neurologische Faktoren
- 2.4.2.1 Kritik am genetisch-neurologischen Modell
- 2.4.3 Umweltfaktoren
- 2.4.3.1 Psychosoziale Faktoren
- 2.4.3.2 Kritik an den psychosozialen Modellen
- 2.4.4 Zusammenfassung
- 2.5 Interventionen
- 2.5.1 Kindzentrierte Verfahren
- 2.5.1.1 Pharmakotherapie
- 2.5.1.2 Verhaltenstherapie
- 2.5.1.3 Entspannungsverfahren
- 2.5.2 Familien- und Schulzentrierte Verfahren
- 2.5.3 Multimodale Therapie
- 2.5.4 Zusammenfassung
- 2.5.1 Kindzentrierte Verfahren
- 3. Aufmerksamkeit
- 3.1 Definition
- 3.2 Aufmerksamkeitstheorien
- 3.2.1 Filtermodelle
- 3.2.2 Computeranalogien
- 3.2.3 Kritik an der traditionellen Modellen
- 3.2.4 Neuropsychologische Modelle
- 3.3 Aufmerksamkeitstheorien bei Kindern
- 3.4 Aufmerksamkeitsdiagnostik
- 3.4.1 Klassische Tests
- 3.4.2 Der TEA-Ch
- 4. Erziehungsstile
- 4.1 Definition
- 4.2 Stand der Forschung
- 4.3 Methoden zur Erfassung von Erziehungsstilen
- 4.3.1 Das FDTS
- 5. ADHS und Erziehungsverhalten
- 5.1 Vorliegende Befunde
- 5.2 Ein Arbeitsmodell
- 6. Fragestellung und Operationalisierung
- 6.1 Operationalisierung
- 6.2 Verwendete Instrumente
- 7. Hypothesen
- 8. Untersuchungsablauf
- 9. Stichprobenbeschreibung
- 10. Ergebnisse der Studie
- 10.1 Deskriptive Auswertung
- 10.2 Auswertung der Hypothesen
- 11. Diskussion
- 11.1 Allgemeine Diskussion
- 11.2 Hypothesenbezogene Diskussion
- 11.3 Zusammenfassende Diskussion und Ausblick
- 12. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit exploriert den Zusammenhang zwischen ADHS bei Kindern und deren sozialem Umfeld, insbesondere dem Erziehungsverhalten der Eltern. Ziel ist es, vorhandene Forschungsergebnisse zusammenzufassen und in einer empirischen Studie den Einfluss elterlichen Erziehungsverhaltens auf Kinder mit ADHS zu untersuchen.
- Definition und Diagnostik von ADHS
- Ätiologie von ADHS, insbesondere genetische und umweltbedingte Faktoren
- Theorien der Aufmerksamkeit und deren Entwicklung bei Kindern
- Erziehungsstile und deren Messmethoden
- Zusammenhang zwischen ADHS und Erziehungsverhalten
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ADHS und dessen soziales Umfeld ein. Sie hebt die Bedeutung des sozialen Umfelds bei der Entstehung und Aufrechterhaltung der Störung hervor und beschreibt den Aufbau der Arbeit, der aus einem theoretischen und einem empirischen Teil besteht. Die Arbeit fokussiert auf den Zusammenhang zwischen elterlichem Erziehungsverhalten und ADHS bei Kindern.
2. Die Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS): Dieses Kapitel bietet eine umfassende Übersicht über ADHS. Es definiert die Störung, beschreibt ihre historische Entwicklung, diagnostische Kriterien (ICD-10, DSM-IV), Komorbiditäten, das Störungsbild inklusive Prävalenz und Verlauf, und beleuchtet verschiedene ätiologische Modelle, die genetische, neurologische und psychosoziale Faktoren einbeziehen. Die Kapitel unterstreichen die Komplexität des Störungsbilds und die vielschichtigen Einflüsse auf seine Entstehung. Zusätzlich werden verschiedene Interventionsmöglichkeiten wie pharmakotherapeutische, verhaltenstherapeutische und multimodale Ansätze vorgestellt und kritisch diskutiert. Der Fokus liegt auf der Darstellung des aktuellen Forschungsstandes und der unterschiedlichen Perspektiven auf die Ursachen und Behandlung von ADHS.
3. Aufmerksamkeit: Dieses Kapitel befasst sich eingehend mit dem Thema Aufmerksamkeit. Es liefert eine Definition von Aufmerksamkeit und beleuchtet verschiedene Aufmerksamkeitstheorien, darunter Filtermodelle, Computeranalogien und neuropsychologische Modelle. Kritisch werden die traditionellen Modelle betrachtet und der aktuelle Forschungsstand zu Aufmerksamkeitstheorien bei Kindern präsentiert. Besonders relevant ist die Darstellung verschiedener diagnostischer Verfahren zur Erfassung von Aufmerksamkeitsleistungen bei Kindern, insbesondere die Beschreibung des TEA-Ch Tests.
4. Erziehungsstile: Das Kapitel definiert den Begriff „Erziehungsstil“ und präsentiert den aktuellen Forschungsstand zu diesem Thema. Es werden verschiedene Methoden zur Erfassung von Erziehungsstilen vorgestellt, mit dem Fokus auf dem Family-Development-Tasks-System (FDTS). Das Kapitel bildet die Grundlage für das Verständnis des elterlichen Erziehungsverhaltens im Kontext von ADHS.
5. ADHS und Erziehungsverhalten: Dieses Kapitel fasst die bisherigen Forschungsergebnisse zum Zusammenhang zwischen ADHS und Erziehungsverhalten zusammen. Es präsentiert ein Arbeitsmodell, welches den Rahmen für die Interpretation der Ergebnisse der empirischen Studie bildet. Es unterstreicht die Komplexität der Interaktion zwischen den Faktoren und die Notwendigkeit weiterer Forschung.
Schlüsselwörter
ADHS, Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung, Erziehungsstil, Erziehungsverhalten, Aufmerksamkeit, Diagnostik, Ätiologie, Intervention, Komorbidität, psychosoziale Faktoren, empirische Studie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: ADHS und Erziehungsverhalten
Was ist der Hauptfokus dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen ADHS bei Kindern und dem Erziehungsverhalten der Eltern. Sie kombiniert einen Literaturüberblick mit einer empirischen Studie, um den Einfluss elterlichen Erziehungsverhaltens auf Kinder mit ADHS zu analysieren.
Welche Themen werden im theoretischen Teil behandelt?
Der theoretische Teil umfasst eine umfassende Darstellung der Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS), einschließlich Definition, Diagnostik (ICD-10, DSM-IV), Ätiologie (genetische, neurologische und psychosoziale Faktoren), und Interventionsmöglichkeiten. Zusätzlich werden verschiedene Aufmerksamkeitstheorien und Methoden zur Erfassung von Erziehungsstilen (z.B. FDTS) behandelt.
Wie wird ADHS in der Arbeit definiert und diagnostiziert?
Die Arbeit beschreibt ADHS detailliert, inklusive seiner historischen Entwicklung. Es werden die diagnostischen Kriterien nach ICD-10 und DSM-IV erläutert, sowie Komorbiditäten und der typische Verlauf der Störung. Die Differentialdiagnose wird ebenfalls angesprochen.
Welche Ätiologiemodelle von ADHS werden betrachtet?
Die Arbeit beleuchtet verschiedene ätiologische Modelle, die genetische, neurologische und psychosoziale Faktoren bei der Entstehung von ADHS berücksichtigen. Die jeweiligen Modelle werden kritisch diskutiert.
Welche Interventionsmöglichkeiten bei ADHS werden vorgestellt?
Es werden verschiedene Interventionsansätze vorgestellt, darunter kindzentrierte Verfahren (Pharmakotherapie, Verhaltenstherapie, Entspannungsverfahren), familien- und schulzentrierte Verfahren und multimodale Therapien. Die Vor- und Nachteile der verschiedenen Ansätze werden diskutiert.
Wie werden Aufmerksamkeit und Aufmerksamkeitstheorien behandelt?
Das Thema Aufmerksamkeit wird umfassend behandelt, inklusive Definition, verschiedener Aufmerksamkeitstheorien (Filtermodelle, Computeranalogien, neuropsychologische Modelle), und deren Entwicklung bei Kindern. Es wird auch auf die Aufmerksamkeitsdiagnostik eingegangen, insbesondere auf den TEA-Ch Test.
Welche Methoden zur Erfassung von Erziehungsstilen werden verwendet?
Die Arbeit beschreibt verschiedene Methoden zur Erfassung von Erziehungsstilen, mit einem Fokus auf das Family-Development-Tasks-System (FDTS).
Wie wird der Zusammenhang zwischen ADHS und Erziehungsverhalten untersucht?
Die Arbeit fasst den aktuellen Forschungsstand zum Zusammenhang zwischen ADHS und Erziehungsverhalten zusammen und präsentiert ein Arbeitsmodell, das die Grundlage für die Interpretation der Ergebnisse der empirischen Studie bildet.
Was beinhaltet der empirische Teil der Arbeit?
Der empirische Teil umfasst die Fragestellung, die Operationalisierung der Variablen, die verwendeten Instrumente, die Hypothesen, den Untersuchungsablauf, die Stichprobenbeschreibung, die Ergebnisse (deskriptive Auswertung und Hypothesentests) und die Diskussion der Ergebnisse.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter: ADHS, Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung, Erziehungsstil, Erziehungsverhalten, Aufmerksamkeit, Diagnostik, Ätiologie, Intervention, Komorbidität, psychosoziale Faktoren, empirische Studie.
- Arbeit zitieren
- Christophe Witz (Autor:in), 2007, ADHS und soziales Umfeld - Eine Exploration, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/92444