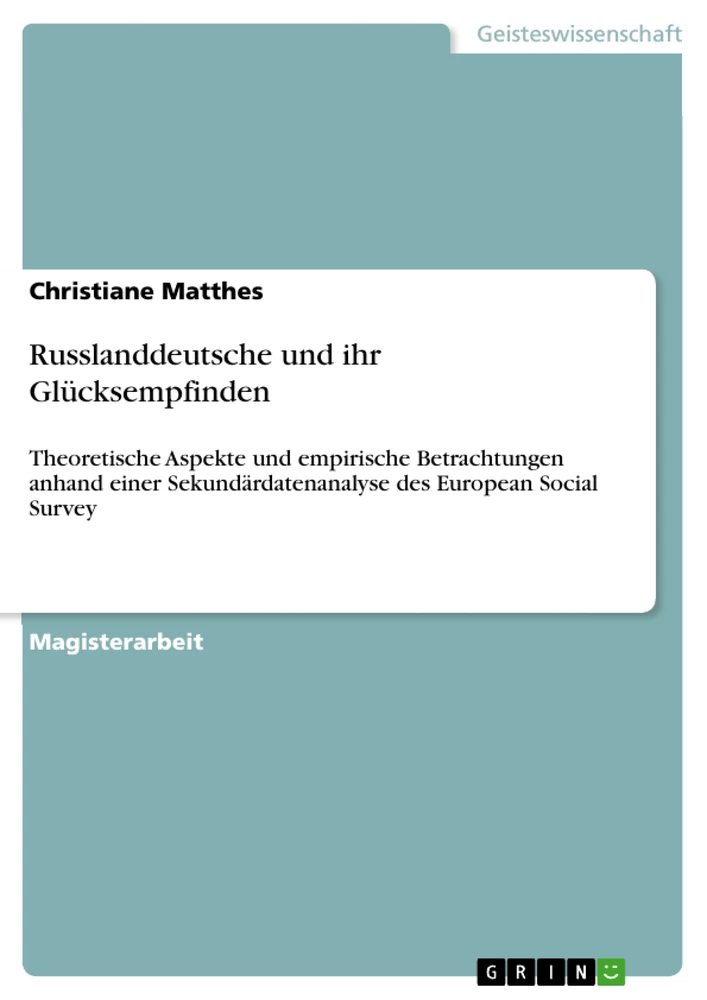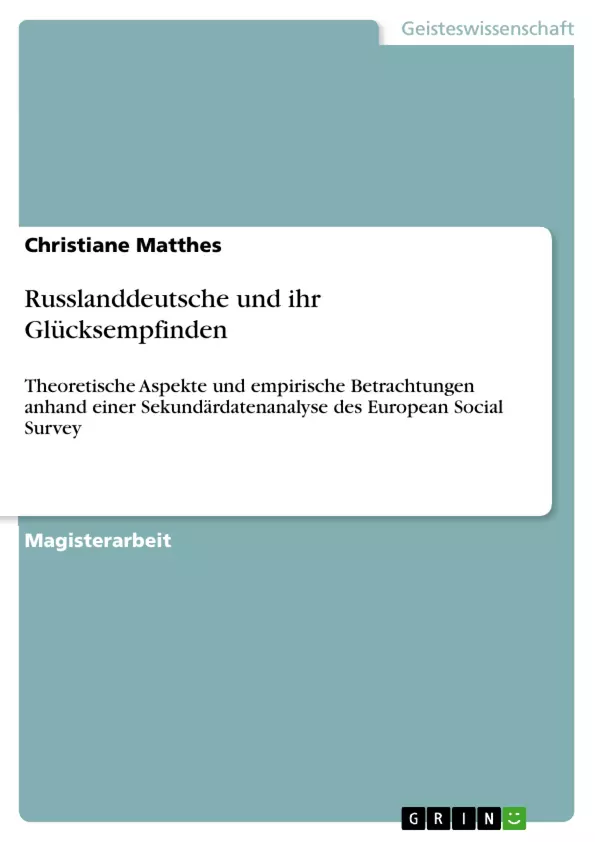Diese Arbeit befasst sich mit zwei Themenschwerpunkten, wobei das Hauptaugenmerk auf der Glücksforschung liegt, auf welche noch einzugehen sein wird. Sie soll durch die Migrationsforschung, konkreter durch die Aussiedlerforschung, spezifiziert werden. Das besondere Interesse gilt dabei Russlanddeutschen, die als Untersuchungseinheit dienen. Geschuldet ist dies zum einen persönlichem Interesse , andererseits aber auch der nach wie vor problematischen Situation der Aussiedler. Denn waren noch bis zu Beginn der 80er Jahre Aussiedler aus Polen die stärkste Einwandergruppe (Vgl. Koller 1997, S.768; Dietz & Roll 1998, S.18f.), so wurden sie Mitte der 80er Jahre durch russlanddeutsche Aussiedler abgelöst. Spätaussiedlern, die aus der ehemaligen SU stammen, unterstellt man oftmals Benachteiligungen und Folgen durch die deutsche Volkszugehörigkeit (Vgl. Sauer 2005, S.114; Dietz & Roll 1998, S.18). Gleichzeitig waren bereits Ende der 80er Jahre zunehmend mehr Deutsche nicht mehr bereit, Aussiedler als Deutsche anzunehmen (Vgl. Roll 2003, S.31).
So könnte die Diskussion um Aussiedler kontroverser kaum sein. Zum einen unterstellt man ihnen bessere Integrationschancen gegenüber anderen Migranten aufgrund ihres Aussiedlerstatus , andererseits sind aber besonders Aussiedler verstärkt von Arbeitslosigkeit betroffen. Aussiedler von heute haben ähnliche Probleme wie andere Einwanderer und doch wird gerade von ihnen eine verstärkte Integration gefordert (Vgl. Retterath 2006). Die Auflistung der Ursachen für die Abwehrhaltung seitens der deutschen Bevölkerung ist nicht Ziel der Arbeit – aber den Weg zu einer Integration erschwert sie allemal. „Aber sind diese ‚fremden Deutschen’ mittlerweile zu fremd, um in Deutschland erfolgreich oder ‚sozial unauffällig’ integriert zu werden?“ (Brommler 2006: 109).
Seit Beginn der 90er Jahre gibt es grundsätzliche Veränderungen: Angefangen über den stetigen Rückgang der Aussiedlerzahlen , wurde die Gruppe der polnischen Aussiedler durch russlanddeutsche Aussiedler zunehmend abgelöst (Vgl. Dietz 1996, S.12; Bade 1992, S.406). Von den 59.093 Aussiedler, die 2004 nach Deutschland einwanderten, stammten 99% aus den Teilrepubliken der ehemaligen SU (Vgl. InfoDienst Deutsche Aussiedler, Nr.118).
Inhaltsverzeichnis
- 0. Einleitung
- I. Einführung in die Glücksforschung
- 1. Emotionen in der Psychologie und Soziologie
- 1.1 Definition und Bestandteile von Emotionen
- 1.2 Aktualität von Glück - Antike bis heute
- 2. Glück in der Sozialindikatorenforschung – ein Überblick
- 2.1 Objektivisten versus Subjektivisten
- 2.2 Maslows Bedürfnishierarchie
- 3. Glück, (Lebens-) Zufriedenheit und subjektives Wohlbefinden
- 4. Übersicht über die theoretische Ansätze zur Analyse des subjektiven Wohlbefindens (SWB)
- 4.1 Ansätze zur Systematik der Begriffe (Mayring) und Theorien (Becker)
- 4.2 Bottom-up / Top-down (state / trait)
- 4.3 Culture Theory (Diener & Lucas)
- 4.4 Die Livability Theorie (Veenhoven)
- 4.5 Soziale Vergleichstheorie (Festinger)
- 5. Determinanten auf das Glück
- 5.1 Einkommen und Arbeitslosigkeit
- 5.2 Gesundheit
- 5.3 Soziale Beziehungen
- 5.4 Weitere Einflussfaktoren
- 6. Schlussfolgerungen
- II. Einführung in die Migrationsforschung
- 7. Untersuchungseinheit russlanddeutsche Aussiedler
- 7.1 Russlanddeutsche (Spät-) Aussiedler – Begriffe und gesetzliche Abgrenzung
- 7.2 Kurzer Exkurs: Geschichte der russlanddeutschen Aussiedler
- 8. Aussiedlerforschung
- 9. Glück und Migration
- 10. Schlussfolgerungen
- 11. Einstieg in Methoden: Sekundärdatenanalyse
- III. Datenanalyse und Auswertung anhand des European Social Survey (ESS)
- 12. European Social Survey (ESS)
- 13. Das Forschungsdesign
- 13.1 Operationalisierung der Begriffe
- 13.2 Messung der Variablen und Gütekriterien
- 14. Das Auswahlverfahren und Stichprobenziehung
- 15. Datenanalyse
- 15.1 Übersicht über die Stichprobe des ESS 2006/07
- 15.2 Überprüfung der Hypothesen
- 15.3 Vergleich der Stichprobe des ESS 2002/03
- 16. Auswertung und Diskussion
- IV. Schlussbetrachtungen und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Magisterarbeit untersucht das Glücksempfinden von Russlanddeutschen im Kontext der Migrationsforschung. Ziel ist es, die Einflussfaktoren auf das Glücksempfinden dieser Gruppe zu analysieren und die Rolle der Migration dabei zu beleuchten. Dabei wird die Glücksforschung als theoretischer Rahmen herangezogen und anhand einer Sekundärdatenanalyse des European Social Survey empirisch überprüft.
- Die Bedeutung des Glücksempfindens für die Integrationsforschung
- Die Besonderheiten der Russlanddeutschen als Migrationsgruppe
- Die Determinanten des Glücksempfindens von Russlanddeutschen
- Die Rolle von Migration und Integration im Zusammenhang mit dem Glücksempfinden
- Empirische Untersuchung des Glücksempfindens von Russlanddeutschen anhand des European Social Survey
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in die Glücksforschung, wobei die Definition und Bestandteile von Emotionen sowie die historische Entwicklung des Glücksempfindens betrachtet werden. Anschließend wird die Integration des Glückskonzepts in die Sozialindikatorenforschung beleuchtet, wobei die unterschiedlichen Ansätze der Objektivisten und Subjektivisten sowie Maslows Bedürfnishierarchie behandelt werden. Die Kapitel untersuchen anschließend die Konzepte von Glück, Zufriedenheit und subjektivem Wohlbefinden und präsentieren verschiedene theoretische Ansätze zur Analyse des subjektiven Wohlbefindens, wie die Systematik der Begriffe (Mayring), die Unterscheidung zwischen Bottom-up und Top-down-Ansätzen, die Culture Theory (Diener & Lucas) und die Livability Theory (Veenhoven). Schließlich wird der Einfluss verschiedener Determinanten auf das Glück diskutiert, darunter Einkommen und Arbeitslosigkeit, Gesundheit und soziale Beziehungen.
Der zweite Teil der Arbeit widmet sich der Migrationsforschung und stellt die russlanddeutschen Aussiedler als Untersuchungseinheit vor. Dabei werden die Begriffe und gesetzliche Abgrenzung von Russlanddeutschen sowie ihre Geschichte und aktuelle Situation beleuchtet. Darüber hinaus werden die Schwerpunkte der Aussiedlerforschung sowie die Verbindung zwischen Glück und Migration betrachtet.
Im dritten Teil wird die Methode der Sekundärdatenanalyse anhand des European Social Survey vorgestellt. Hier werden das Forschungsdesign, die Operationalisierung der Begriffe, die Messung der Variablen, das Auswahlverfahren und die Stichprobenziehung sowie die Datenanalyse und -auswertung detailliert dargestellt.
Schlüsselwörter
Glücksempfinden, Russlanddeutsche, Aussiedler, Migration, Integration, Sozialindikatorenforschung, European Social Survey, Sekundärdatenanalyse, subjektives Wohlbefinden, Determinanten des Glücks, Emotionen, Kultur, Livability Theorie, soziale Vergleichstheorie.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema dieser Magisterarbeit?
Die Arbeit untersucht das Glücksempfinden von Russlanddeutschen im Kontext der Migrations- und Integrationsforschung.
Welche Rolle spielt die Glücksforschung in dieser Studie?
Sie dient als theoretischer Rahmen, um zu analysieren, wie subjektives Wohlbefinden durch Faktoren wie Einkommen, Gesundheit und soziale Beziehungen beeinflusst wird.
Warum wurden speziell Russlanddeutsche als Untersuchungseinheit gewählt?
Russlanddeutsche stellen eine große Migrantengruppe dar, die oft vor besonderen Integrationsherausforderungen steht, obwohl ihnen gesetzlich ein besonderer Status als Aussiedler zukommt.
Welche Datenquelle wurde für die Analyse genutzt?
Es wurde eine Sekundärdatenanalyse auf Basis des European Social Survey (ESS) aus den Jahren 2002 bis 2007 durchgeführt.
Was sind die Determinanten für das Glücksempfinden von Migranten?
Wesentliche Faktoren sind unter anderem die wirtschaftliche Situation (Arbeitslosigkeit), der Gesundheitszustand sowie die Qualität der sozialen Integration in der Aufnahmegesellschaft.
- Arbeit zitieren
- Christiane Matthes (Autor:in), 2008, Russlanddeutsche und ihr Glücksempfinden , München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/92457