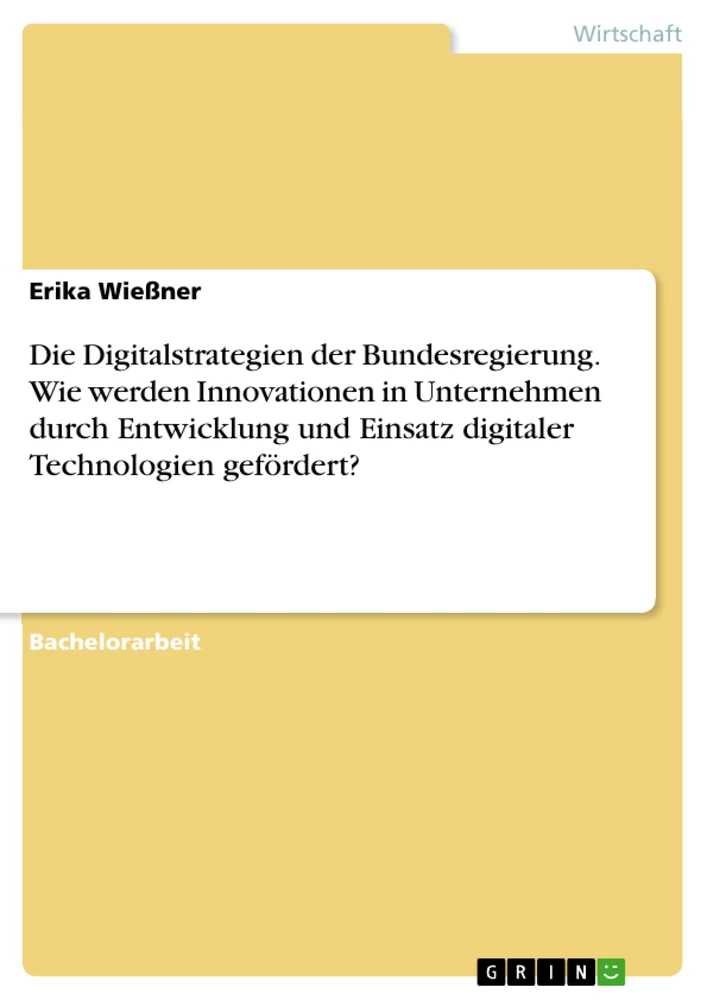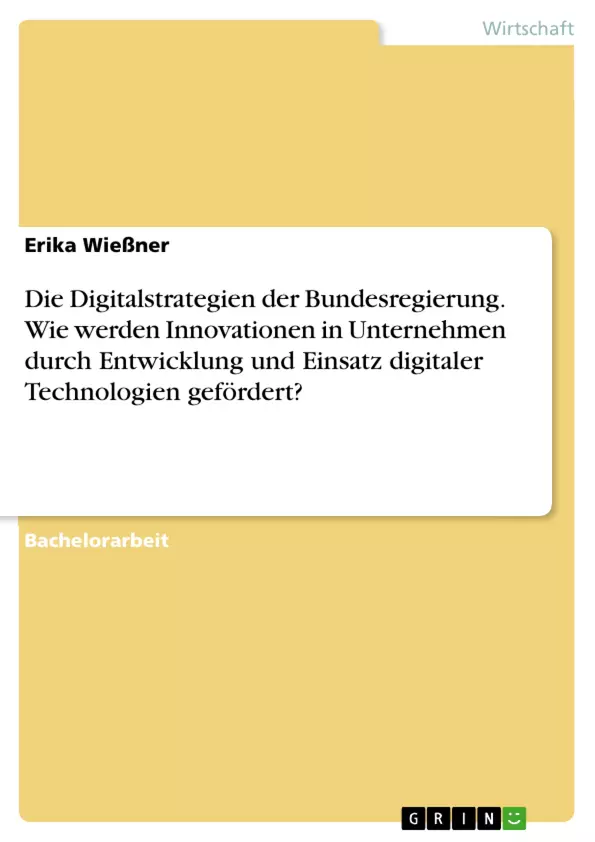Die vorliegende Arbeit untersucht Teilelemente der Digitalstrategien der Bundesregierung. Hierbei steht die folgende Forschungsfrage im Fokus: Worin bestehen Chancen und Risiken der Strategien der Bundesregierung zur Förderung von Innovation in Unternehmen durch die Entwicklung und den Einsatz digitaler Technologien?
Zur Beantwortung der Forschungsfrage zieht die Arbeit das methodische Vorgehen und die Ergebnisse von zwei empirischen Studien heran. Die empirischen Studien befassen sich zum einen mit der Auswertung einer ortbasierten Innovationspolitik "Innovative Regionale Wachstumskerne" in Ostdeutschland und zum anderen mit den Auswirkungen von Forschung und Entwicklung (F&E) auf die Unternehmensproduktivität. Aufgrund der thematischen Ähnlichkeit zu den Digitalstrategien der Bundesregierung sind die empirischen Studien sehr gut geeignet, um Chancen und Risiken für die Digitalstrategien herzuleiten. Die Arbeit kommt zu den zentralen Ergebnissen, dass staatliche Subventionen im Rahmen der Digitalstrategien der Bundesregierung die F&E-Ausgaben und die Unternehmensproduktivität in Unternehmen steigern können. Ein aus den empirischen Studien für die Digitalstrategien hergeleitetes Risiko besteht darin, dass Fördermaßnahmen lediglich kurz- bis mittelfristige positive Auswirkungen haben. Es bleibt also offen, ob die Digitalstrategien langfristige Innovationsbemühungen in Unternehmen erzielen können.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Digitale Agenda der Bundesregierung
- 2.1 Wachstum und Beschäftigung
- 2.2 Zugang und Teilhabe
- 3. Strategien der Bundesregierung zur Förderung von Innovation in Unternehmen durch die Entwicklung und den Einsatz digitaler Technologien
- 3.1 Hightech-Strategie 2025 - Förderung von F&E und Innovation
- 3.2 Unterstützung junger, innovativer Unternehmen
- 3.3 Innovationsförderung in KMU
- 4. Förderprogramm „Innovative Regionale Wachstumskerne“ – eine empirische Studie
- 4.1 Datenquellen und Methoden
- 4.2 Ergebnisse der empirischen Studie
- 4.3 Chancen und Risiken der Digitalstrategien der Bundesregierung
- 5. IKT: Die Auswirkungen von F&E auf die Unternehmensproduktivität – eine empirische Studie
- 5.1 Datenquellen und Methoden
- 5.2 Ergebnisse der empirischen Studie
- 5.3 Chancen und Risiken der Digitalstrategien der Bundesregierung
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Chancen und Risiken der Strategien der Bundesregierung zur Förderung von Innovationen in Unternehmen durch digitale Technologien. Sie analysiert, inwiefern staatliche Maßnahmen die Entwicklung und den Einsatz digitaler Technologien in Unternehmen beeinflussen und somit Wirtschaftswachstum und Produktivität fördern.
- Analyse der Digitalen Agenda der Bundesregierung und ihrer Ziele
- Bewertung verschiedener Förderprogramme zur Innovationsförderung
- Empirische Untersuchung der Auswirkungen von Förderprogrammen auf die Unternehmensproduktivität
- Identifizierung von Chancen und Risiken staatlicher Fördermaßnahmen im Bereich der Digitalisierung
- Bewertung des langfristigen Potenzials der Bundesregierung Strategien
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Digitalisierung und deren Bedeutung für die deutsche Wirtschaft ein. Sie beleuchtet den Stellenwert digitaler Technologien und deren Einfluss auf Innovationen, Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit. Der Kontext wird durch Zahlen und Daten zum deutschen IKT-Markt verdeutlicht, um die Relevanz des Themas zu unterstreichen und die Forschungsfrage zu motivieren.
2. Digitale Agenda der Bundesregierung: Dieses Kapitel beschreibt die Digitalstrategie der Bundesregierung, einschließlich der Ziele in Bezug auf Wachstum und Beschäftigung sowie den Aspekt von digitalem Zugang und Teilhabe. Es analysiert die darin enthaltenen Maßnahmen und deren Ansatz zur Förderung der Digitalisierung in Deutschland. Die Zusammenfassung würde die verschiedenen Bausteine der Agenda und deren gegenseitige Abhängigkeiten beleuchten.
3. Strategien der Bundesregierung zur Förderung von Innovation in Unternehmen durch die Entwicklung und den Einsatz digitaler Technologien: Dieses Kapitel analysiert verschiedene Strategien der Bundesregierung zur Förderung von Innovationen in Unternehmen, wie die Hightech-Strategie 2025, die Unterstützung junger Unternehmen und die Innovationsförderung in KMU. Es beleuchtet die konkreten Maßnahmen und Instrumente, die eingesetzt werden, um Unternehmen bei der Digitalisierung zu unterstützen. Die Stärken und Schwächen der einzelnen Strategien werden gegenübergestellt und kritisch bewertet.
4. Förderprogramm „Innovative Regionale Wachstumskerne“ – eine empirische Studie: Die Zusammenfassung dieser empirischen Studie würde die Methodik, die Datengrundlage und die zentralen Ergebnisse detailliert darstellen. Sie würde die Erkenntnisse der Studie über die Wirksamkeit des Förderprogramms "Innovative Regionale Wachstumskerne" in Ostdeutschland erläutern und in Bezug zu den allgemeinen Zielen der Digitalstrategie setzen. Die Chancen und Risiken des Programms im Kontext der Bundesregierung Strategien werden hervorgehoben.
5. IKT: Die Auswirkungen von F&E auf die Unternehmensproduktivität – eine empirische Studie: Diese Zusammenfassung erläutert eine weitere empirische Studie, die die Auswirkungen von Forschung und Entwicklung (F&E) auf die Unternehmensproduktivität im Kontext von IKT untersucht. Die Methodik, die Ergebnisse und die Schlussfolgerungen dieser Studie werden detailliert dargestellt. Die Ergebnisse werden im Kontext der Digitalstrategien der Bundesregierung interpretiert und deren Chancen und Risiken beleuchtet.
Schlüsselwörter
Digitale Technologien, Innovation, Bundesregierung, Digitalstrategie, Förderprogramme, KMU, Unternehmensproduktivität, Forschung & Entwicklung (F&E), empirische Studie, Wirtschaftswachstum, Wettbewerbsfähigkeit, Chancen, Risiken.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Bachelorarbeit: "Strategien der Bundesregierung zur Förderung von Innovationen in Unternehmen durch digitale Technologien"
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Bachelorarbeit analysiert die Strategien der Bundesregierung zur Förderung von Innovationen in Unternehmen mithilfe digitaler Technologien. Sie untersucht die Chancen und Risiken dieser Strategien für Wirtschaftswachstum und Produktivität und bewertet deren Wirksamkeit anhand empirischer Studien.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Digitale Agenda der Bundesregierung, verschiedene Förderprogramme (wie die Hightech-Strategie 2025 und "Innovative Regionale Wachstumskerne"), die Auswirkungen von Forschung & Entwicklung (F&E) auf die Unternehmensproduktivität, sowie eine kritische Bewertung der Chancen und Risiken der staatlichen Fördermaßnahmen im Kontext der Digitalisierung.
Welche Methoden werden in der Arbeit angewendet?
Die Arbeit kombiniert eine deskriptive Analyse der Digitalstrategie der Bundesregierung mit zwei empirischen Studien. Diese Studien untersuchen die Wirksamkeit von Förderprogrammen und den Einfluss von F&E auf die Unternehmensproduktivität. Die konkreten Methoden der empirischen Studien (Datenquellen und -analyse) werden in den jeweiligen Kapiteln detailliert beschrieben.
Welche Förderprogramme werden im Detail untersucht?
Die Arbeit analysiert unter anderem die Hightech-Strategie 2025 und das Förderprogramm "Innovative Regionale Wachstumskerne". Der Fokus liegt auf der Bewertung der Wirksamkeit dieser Programme zur Förderung von Innovationen in Unternehmen, insbesondere KMU.
Welche Ergebnisse liefern die empirischen Studien?
Die Ergebnisse der empirischen Studien werden in den Kapiteln 4 und 5 detailliert dargestellt. Sie liefern Erkenntnisse über die Wirksamkeit der untersuchten Förderprogramme und den Einfluss von F&E-Investitionen im Bereich IKT auf die Unternehmensproduktivität. Die Arbeit interpretiert diese Ergebnisse im Kontext der Gesamtstrategie der Bundesregierung.
Welche Chancen und Risiken werden im Zusammenhang mit den Digitalisierungsstrategien der Bundesregierung identifiziert?
Die Arbeit identifiziert sowohl Chancen (z.B. gesteigertes Wirtschaftswachstum, erhöhte Wettbewerbsfähigkeit) als auch Risiken (z.B. ungleiche Verteilung der Fördermittel, Abhängigkeit von staatlichen Förderungen) der Bundesregierung Strategien. Diese werden in jedem relevanten Kapitel diskutiert und im Fazit zusammengefasst.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Das Fazit der Arbeit fasst die wichtigsten Ergebnisse zusammen und bewertet das langfristige Potenzial der Bundesregierung Strategien zur Förderung von Innovationen durch digitale Technologien. Es gibt einen Ausblick auf mögliche Verbesserungen und Herausforderungen für zukünftige Digitalisierungsinitiativen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Digitale Technologien, Innovation, Bundesregierung, Digitalstrategie, Förderprogramme, KMU, Unternehmensproduktivität, Forschung & Entwicklung (F&E), empirische Studie, Wirtschaftswachstum, Wettbewerbsfähigkeit, Chancen, Risiken.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Wissenschaftler, Politiker, Wirtschaftswissenschaftler, und alle, die sich für die Digitalisierungsstrategie der Bundesregierung und deren Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft interessieren.
- Quote paper
- Erika Wießner (Author), 2020, Die Digitalstrategien der Bundesregierung. Wie werden Innovationen in Unternehmen durch Entwicklung und Einsatz digitaler Technologien gefördert?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/924612