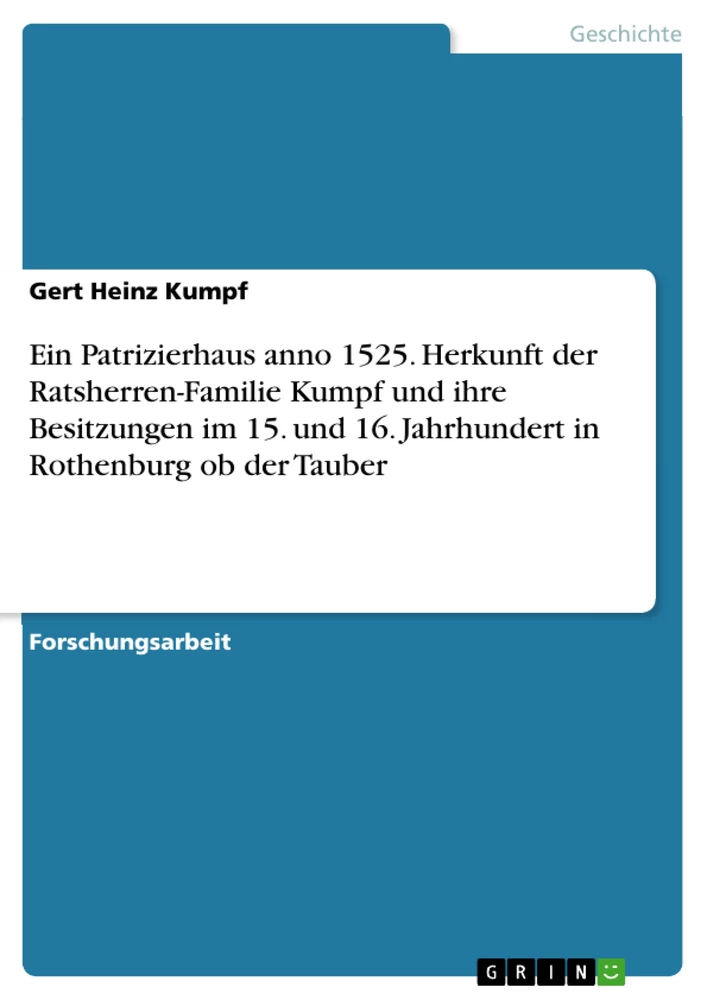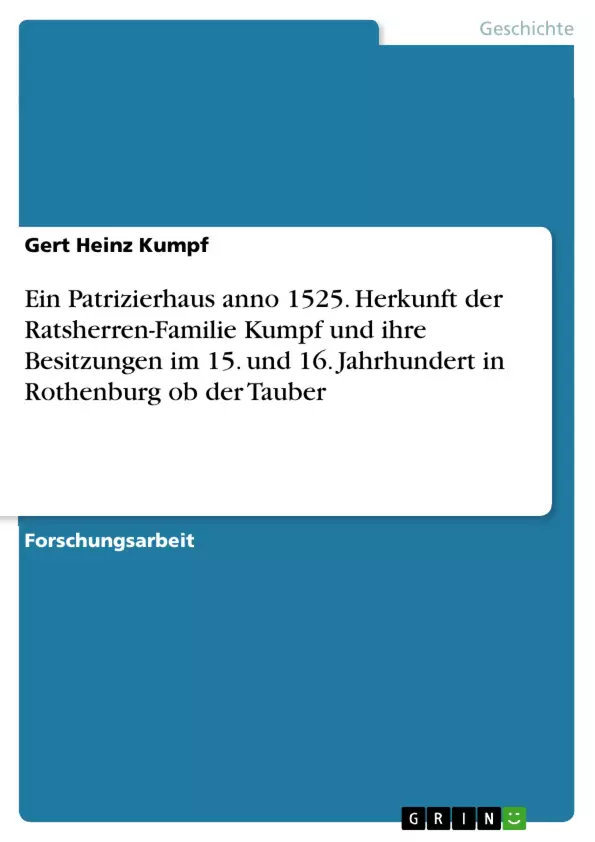Im Mittelpunkt der historischen Forschungsarbeit geht es um die genaue Untersuchung eines Patrizierhauses aus dem Jahr 1525 in der Reichsstadt Rothenburg ob der Tauber.
Der Besitzer war der Ratsherr und Bürgermeister Ehrenfried Kumpf, der im Bauernkrieg 1525 für die bäuerliche Sache Partei ergriff und im Auftrag der mit den Bauernhaufen verbündeten Reichsstadt Rothenburg nach Würzburg zog und dort zum Bürgermeister eines vom bischöflichen Einflusses befreiten Würzburgs gewählt wurde, dann aber durch den militärischen Umschwung und den Sieg der Adelspartei in Ungnade fiel, Haus, Hof, Besitz und Vermögen in Rothenburg verlor und vertrieben wurde. Anhand seines Schicksals vermag der Autor deutlich zu machen, wie damals Patrizier wohnten und lebten, weil sein Rothenburger Besitz durch ein zufällig erhaltenes Inventarverzeichnis im Staatsarchiv Nürnberg erhalten ist. So wird die Geschichte und der soziale Hintergrund einer bürgerlichen "ehrbaren" Familie im Franken des frühen 16. Jahrhunderts vor Reformation und Dreißigjährigem Krieg wieder lebendig.
Die Herkunft der Patrizierfamilie Kumpf aus der Reichsstadt Windsheim wird ebenso beleuchtet wie ihre Entfaltung in der Reichsstadt Rothenburg ob der Tauber. Ein kurzer Blick wird auf den Bauernkrieg als fehlgeschlagene erste demokratische Revolution in Deutschland geworfen.
Mittels eines umfangreichen Bildteils wird das Patrizierhaus außen wie innen sowie seine Lage in Rothenburg beleuchtet und veranschaulicht. So wird das Jahr 1525 am Beispiel einer schicksalhaft in geschichtliche Wirren hineingezogenen Person verlebendigt.
Inhaltsverzeichnis
- Herkunft der Ratsherren-Familie aus der Reichsstadt Windsheim
- Erste Erwähnung des Geschlechts in der Reichsstadt Rothenburg ob der Tauber im Jahr 1396
- Der Bürgermeister Ehrenfried Kumpf
- Die Rolle des Altbürgermeisters und seiner Brüder im Bauernkrieg 1525
- Exkurs: Der Bauernkrieg als fehlgeschlagene demokratische Revolution
- Eine historische Neubewertung?
- Wo befand sich das Wohnhaus des Ehrenfried Kumpf?
- Zimmeraufteilung und Inventar des Patrizierhauses
- Rothenburg, Herrngasse 16 oder 20?
- Bilddokumentation des Patrizierhauses
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit verfolgt das Ziel, die Geschichte der Patrizierfamilie Kumpf in Rothenburg ob der Tauber im 15. und 16. Jahrhundert zu erforschen und zu dokumentieren. Der Fokus liegt auf der Herkunft der Familie, ihrer Rolle im öffentlichen Leben Rothenburgs, insbesondere während des Bauernkriegs 1525, und der Lokalisierung ihres Wohnhauses.
- Die Herkunft und der Aufstieg der Familie Kumpf
- Die politische und gesellschaftliche Rolle der Familie Kumpf in Rothenburg
- Die Beteiligung der Familie Kumpf am Bauernkrieg 1525
- Die Identifizierung und Beschreibung des Wohnhauses der Familie Kumpf
- Eine historische Neubewertung der Rolle der Familie Kumpf im Bauernkrieg
Zusammenfassung der Kapitel
1 Herkunft der Ratsherren-Familie aus der Reichsstadt Windsheim: Dieses Kapitel beschreibt die Herkunft der Familie Kumpf als altes fränkisches Patriziergeschlecht, dessen Wurzeln bis ins 13. Jahrhundert in den Reichsstädten Windsheim und Rothenburg ob der Tauber zurückreichen. Es wird die erste urkundliche Erwähnung im Jahr 1284 dokumentiert und der Aufstieg der Familie vom landwirtschaftlichen Hintergrund zum Einfluss im Rat und Bürgermeisteramt Windsheims detailliert dargestellt. Die geschickte Nutzung landwirtschaftlicher Ressourcen und der frühzeitige Einsatz für das Gemeinwohl werden als Schlüsselfaktoren für ihren Erfolg hervorgehoben. Die Kapitel beschreibt auch die Verbindungen der Familie zum Zisterzienserkloster Heilsbronn und ihre Beziehungen zu Nürnberg. Die Bedeutung von Peter Kumpf, dem reichsten Bürger Windsheims, und seiner Stiftungen wird ebenfalls betont.
2 Erste Erwähnung des Geschlechts in der Reichsstadt Rothenburg ob der Tauber im Jahr 1396: Das Kapitel beleuchtet die Einwanderung der Familie Kumpf nach Rothenburg, beginnend mit Peter Kumpf im Jahr 1396. Es verfolgt den weiteren Aufstieg der Familie durch die Ratsmitgliedschaften verschiedener Generationen, mit besonderem Fokus auf Johann Kumpf den Älteren und seine Leistungen als Baumeister und Ratsmitglied. Die Kapitel beleuchtet die Heiratspolitik der Familie, welche Verbindungen zu anderen angesehenen Familien wie den Wernitzers und von Stettens herstellte, sowie deren Einfluss und Netzwerk in der Reichsstadt Rothenburg.
3 Der Bürgermeister Ehrenfried Kumpf: Dieses Kapitel konzentriert sich auf das Leben und Wirken von Ehrenfried Kumpf, Sohn von Johann Kumpf dem Jüngeren. Es zeigt sein umfassendes Engagement im öffentlichen und kirchlichen Leben Rothenburgs, seine zweimaligen Amtszeiten als Bürgermeister und seine zahlreichen ehrenamtlichen Tätigkeiten. Seine Familie und seine Rolle als Altbürgermeister während des Bauernkriegs 1525 werden kurz angerissen, wobei die Details auf das folgende Kapitel verwiesen werden.
4 Die Rolle des Altbürgermeisters und seiner Brüder im Bauernkrieg 1525: Dieses Kapitel beschreibt die Beteiligung der Brüder Hans, Ehrenfried und Georg Kumpf am Bauernkrieg von 1525. Es wird betont, dass sie die religiösen und sozialen Forderungen der Bauern unterstützten. Das Kapitel analysiert den Bauernkrieg als einen gescheiterten Versuch einer demokratischen Revolution und beleuchtet die komplizierten Abläufe des Aufstands und die Folgen für die Brüder Kumpf, insbesondere die Flucht Ehrenfrieds und die Hinrichtung von Hans. Das Kapitel hebt die harten Strafen der Stadt Rothenburg gegen die flüchtigen Rebellen hervor und endet mit einer kurzen Beschreibung des Schicksals Ehrenfried Kumpfs, der 1529 in Kitzingen starb.
4.1 Exkurs: Der Bauernkrieg als fehlgeschlagene demokratische Revolution: Der Exkurs interpretiert den Bauernkrieg als einen frühen Versuch, demokratische Elemente in die ständische Ordnung einzubringen. Er beleuchtet die Forderungen der Bauern nach religiöser Mitbestimmung und der Reduzierung feudaler Abgaben, stellt den Konflikt in einen größeren historischen Kontext und betont die Bedeutung dieses Ereignisses für die Entwicklung demokratischer Ideen in Mitteleuropa.
4.2 Eine historische Neubewertung?: Dieser Abschnitt plädiert für eine Neubewertung der Rolle der Familie Kumpf im Bauernkrieg, kritisiert die fehlende Rehabilitierung der Brüder durch die Stadt Rothenburg und regt die Anbringung einer Hinweistafel am ehemaligen Wohnhaus an.
5 Wo befand sich das Wohnhaus des Ehrenfried Kumpf?: Das Kapitel untersucht den genauen Standort des Wohnhauses von Ehrenfried Kumpf in Rothenburg. Es analysiert historische Dokumente, insbesondere das Inventar des Hauses aus dem Jahr 1525, um die Lokalisierung des Hauses einzugrenzen. Die Analyse von Nachbarn und angrenzenden Grundstücken wird verwendet, um die Identifikation des Hauses Herrngasse 16 zu belegen.
6 Zimmeraufteilung und Inventar des Patrizierhauses: Dieses Kapitel beschreibt die detaillierte Zimmeraufteilung und das Inventar des Kumpf’schen Hauses, basierend auf dem Inventar von 1525. Es bietet ein lebendiges Bild des Haushalts und der Lebensumstände einer wohlhabenden Patrizierfamilie des 16. Jahrhunderts.
7 Rothenburg, Herrngasse 16 oder 20?: Dieses Kapitel vergleicht die beiden möglichen Standorte des Kumpf’schen Hauses (Herrngasse 16 und 20) und argumentiert detailliert für die Herrngasse 16 als den korrekten Standort, indem es verschiedene architektonische und historische Argumente und Details der Gebäude berücksichtigt.
8 Bilddokumentation des Patrizierhauses: Dieses Kapitel präsentiert eine Auswahl von Fotos des Hauses Herrngasse 16, das heute noch als Baudenkmal existiert und die Bedeutung des Bauwerks als Zeugnis des patrizischen Lebensstils betont.
Schlüsselwörter
Patrizierfamilie Kumpf, Rothenburg ob der Tauber, Reichsstadt Windsheim, Bauernkrieg 1525, Ehrenfried Kumpf, Altbürgermeister, historisches Wohnhaus, Patrizierleben, fränkische Geschichte, Stadtgeschichte, Baudenkmäler, Inventar, Reformation.
Häufig gestellte Fragen zur Patrizierfamilie Kumpf in Rothenburg ob der Tauber
Woher stammt die Patrizierfamilie Kumpf?
Die Familie Kumpf ist ein altes fränkisches Patriziergeschlecht mit Wurzeln im 13. Jahrhundert in den Reichsstädten Windsheim und Rothenburg ob der Tauber. Ihre Herkunft wird detailliert im ersten Kapitel beschrieben, welches ihren Aufstieg vom landwirtschaftlichen Hintergrund zum Einfluss im Rat und Bürgermeisteramt Windsheims beleuchtet.
Wann taucht die Familie Kumpf erstmals in Rothenburg ob der Tauber auf?
Die erste urkundliche Erwähnung der Familie Kumpf in Rothenburg ob der Tauber datiert auf das Jahr 1396 mit Peter Kumpf. Das zweite Kapitel beschreibt die anschließende Einwanderung und den Aufstieg der Familie durch Ratsmitgliedschaften über mehrere Generationen.
Welche Rolle spielte Ehrenfried Kumpf in Rothenburg?
Ehrenfried Kumpf, Sohn von Johann Kumpf dem Jüngeren, war ein bedeutender Bürger Rothenburgs. Er bekleidete zweimal das Amt des Bürgermeisters und engagierte sich umfassend im öffentlichen und kirchlichen Leben der Stadt. Kapitel 3 widmet sich seinem Leben und Wirken.
Wie beteiligte sich die Familie Kumpf am Bauernkrieg 1525?
Die Brüder Hans, Ehrenfried und Georg Kumpf unterstützten die religiösen und sozialen Forderungen der Bauern während des Bauernkriegs 1525. Kapitel 4 analysiert ihre Beteiligung, den gescheiterten Aufstand und dessen Folgen für die Familie, einschließlich Flucht und Hinrichtung.
Wo befand sich das Wohnhaus der Familie Kumpf?
Kapitel 5 bis 7 untersuchen den genauen Standort des Wohnhauses von Ehrenfried Kumpf. Die Analyse historischer Dokumente, des Inventars und der Nachbarschaft führt zu der Schlussfolgerung, dass sich das Haus in der Herrngasse 16 befand, im Gegensatz zur möglichen Adresse Herrngasse 20.
Wie war das Wohnhaus der Familie Kumpf eingerichtet?
Kapitel 6 beschreibt detailliert die Zimmeraufteilung und das Inventar des Kumpf’schen Hauses basierend auf dem Inventar von 1525. Es bietet einen Einblick in den Lebensstil einer wohlhabenden Patrizierfamilie des 16. Jahrhunderts.
Gibt es Bildmaterial des Wohnhauses?
Kapitel 8 präsentiert Fotos des Hauses in der Herrngasse 16, welches heute noch als Baudenkmal existiert und als Zeugnis des patrizischen Lebensstils dient.
Welche Schlüsselthemen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Herkunft und den Aufstieg der Familie Kumpf, ihre politische und gesellschaftliche Rolle in Rothenburg, insbesondere während des Bauernkriegs 1525, sowie die Lokalisierung und Beschreibung ihres Wohnhauses. Eine Neubewertung der Rolle der Familie im Bauernkrieg wird ebenfalls angestrebt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Patrizierfamilie Kumpf, Rothenburg ob der Tauber, Reichsstadt Windsheim, Bauernkrieg 1525, Ehrenfried Kumpf, Altbürgermeister, historisches Wohnhaus, Patrizierleben, fränkische Geschichte, Stadtgeschichte, Baudenkmäler, Inventar, Reformation.
- Citar trabajo
- Gert Heinz Kumpf (Autor), 2020, Ein Patrizierhaus anno 1525. Herkunft der Ratsherren-Familie Kumpf und ihre Besitzungen im 15. und 16. Jahrhundert in Rothenburg ob der Tauber, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/924616