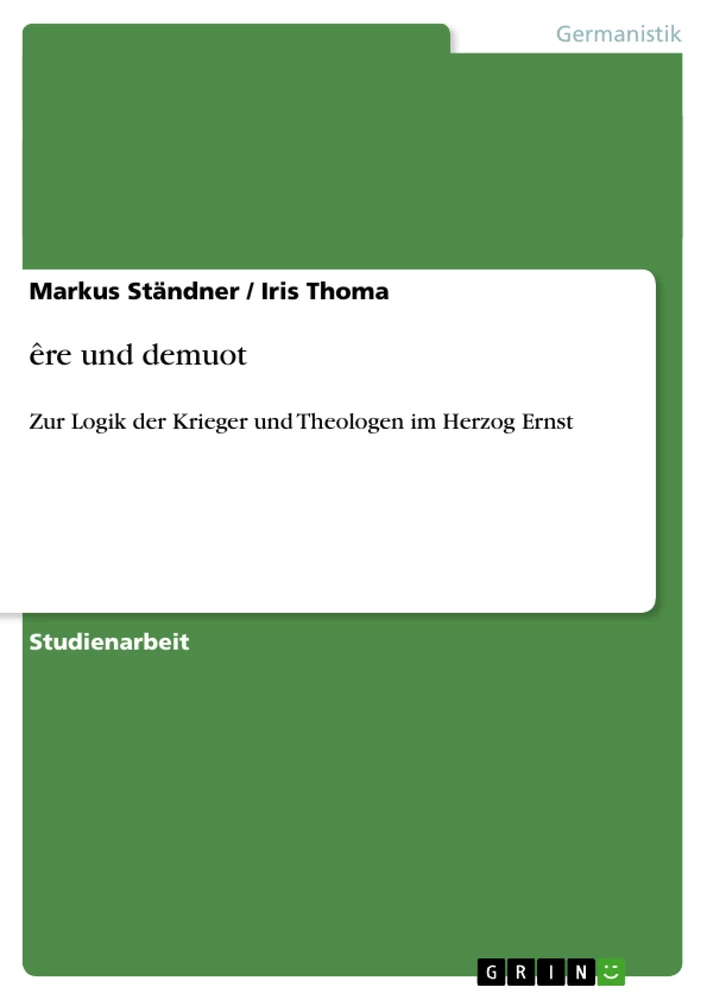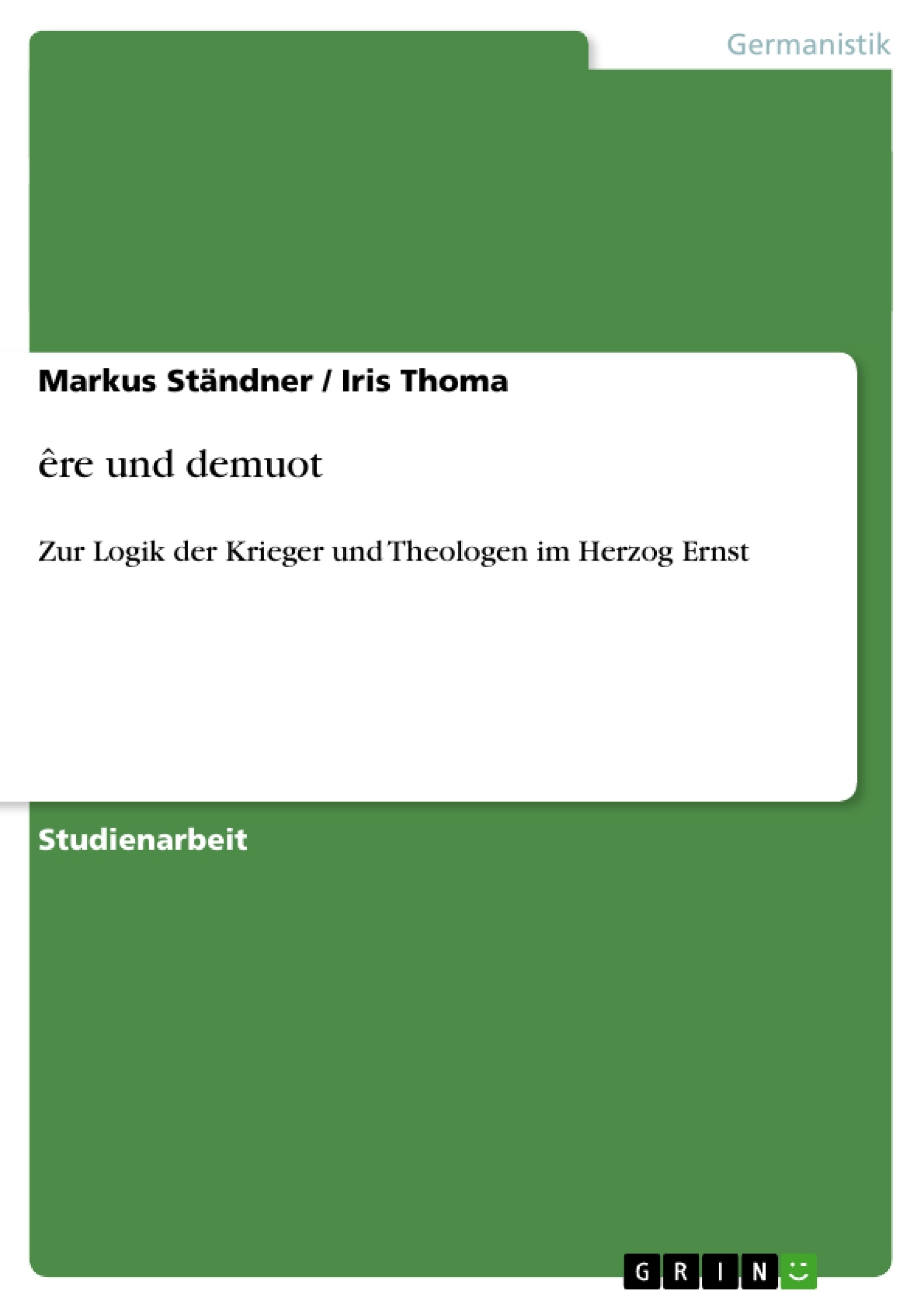Das zur Gattung der Spielmannsepik gehörende mittelhochdeutsche Werk Herzog Ernst, welches wohl im 12. Jahrhundert entstanden ist, liest sich für einen geübten Rezipienten von Arthusromanen vollkommen anders und offenbart einige Überraschungen in der Struktur. Sowohl der Konflikt des Helden und die Konfliktlösung, als auch beispielsweise das Motiv der Minne entwickelt sich im Herzog Ernst auf völlig andere Weise. Zentrales Thema ist hier der Werdegang bzw. Läuterungsprozess des Helden, bei welchem die Aspekte der êre und der demuot eine wichtige Rolle spielen. Diese Seminararbeit versucht an den einzelnen Stationen, die der Protagonist zu durchlaufen hat, zu zeigen, unter welcher dieser Handlungsmaxime diese abläuft und was daraus resultierend für Folgen für den weiteren Verlauf der Geschichte entstehen. Beginnend mit der Situation im Reich und dem, aufgrund von Verleugnung, entstehenden Vater-Sohn-Konflikt zwischen Herzog Ernst und seinem Stiefvater, dem Kaiser, folgt der Verlauf dieser Arbeit mit den einzelnen Episoden der Orientfahrt, mit der der Konfliktbewältigung beigelegt wird. Dem Läuterungsprozess des Herzogs folgend werden seine Begegnungen mit den einzelnen Wundervölkern, von den Grippianern, Greifen, Arimaspi, Plathüeven, Langohren, Pygmäen bis hin zu den Riesen ebenso beschrieben, wie sein Kampf gegen die Heiden im gelobten Land. Gegen Ende hin wird gezeigt, wie sich durch die Abenteuer im Orient auch der Konflikt in der Heimat löst und Herzog Ernst wieder ein vollwertiges Mitglied der hierarchischen Hofgesellschaft wird. Als ein begleitender Ansatzpunkt dieser Arbeit wird auch das Gelingen und Scheitern von Kommunikation in enger Verbindung mit dem êre-demuot Komplex und die daraus resultierenden Folgen für das Ganze behandelt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- I. Herzog Ernst und das rîche
- 1. Entstehung des Konflikts
- 2. Gescheiterte Kommunikation und eskalierende Konfliktführung
- 3. Argumentative Begründung der Orientfahrt
- II. Die Orientfahrt
- 1. Grippia - Das Land der Kranichschnäbler
- 2. Ausweglosigkeit, Läuterung und Rettung auf dem Magnetberg
- 3. Die Ereignisse im Königreich der Arimaspi
- III. Dienst in Jerusalem und Heimkehr ins rîche
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit beschäftigt sich mit dem mittelhochdeutschen Werk „Herzog Ernst“, einem bedeutenden Beispiel der Spielmannsepik. Im Zentrum steht die Analyse des Werdegangs und Läuterungsprozesses des Protagonisten Herzog Ernst, wobei die zentralen Themen der êre und demuot im Vordergrund stehen. Die Arbeit verfolgt das Ziel, die einzelnen Stationen der Heldengeschichte im Hinblick auf diese Handlungsmaximen zu beleuchten und die daraus resultierenden Folgen für den Verlauf der Geschichte aufzuzeigen.
- Der Vater-Sohn-Konflikt zwischen Herzog Ernst und dem Kaiser als Auslöser der Handlung
- Die Rolle von êre und demuot im Läuterungsprozess Herzog Ernsts
- Die Begegnungen mit den Wundervölkern und deren Bedeutung für den Helden
- Die Konfliktlösung und die Wiederherstellung der Ordnung im Reich
- Die Bedeutung von Kommunikation und deren Einfluss auf den Konfliktverlauf
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt den Kontext des Werkes „Herzog Ernst“ dar und hebt die Besonderheiten in der Struktur und Thematik im Vergleich zu anderen Ritterromanen hervor. Die Arbeit fokussiert auf den Läuterungsprozess des Helden, wobei die Aspekte von êre und demuot im Mittelpunkt stehen.
- I. Herzog Ernst und das rîche:
- 1. Entstehung des Konflikts: Dieses Kapitel analysiert den Konflikt zwischen Herzog Ernst und dem Kaiser, der aus der Heirat des Kaisers mit der Mutter des Herzogs entsteht. Es wird deutlich, dass die feudale Problematik des Reiches als Ausgangspunkt für die Handlung dient, jedoch nicht die zentrale Intention des Autors darstellt.
- 2. Gescheiterte Kommunikation und eskalierende Konfliktführung: Dieser Abschnitt beleuchtet die gescheiterte Kommunikation zwischen Herzog Ernst und dem Kaiser, die zu einer eskalierenden Konfliktführung führt. Die fehlende demuot seitens Herzog Ernst verstärkt die Konflikte und führt zu seiner Verbannung aus dem Reich.
- 3. Argumentative Begründung der Orientfahrt: In diesem Kapitel wird die argumentative Begründung der Orientfahrt Herzog Ernsts untersucht. Es wird gezeigt, wie er durch seinen Entschluss, sich in den Dienst des christlichen Glaubens zu stellen, seine êre wiedererlangen und die Konfliktlösung herbeiführen kann.
- II. Die Orientfahrt:
- 1. Grippia - Das Land der Kranichschnäbler: Dieses Kapitel beschreibt die Begegnung Herzog Ernsts mit den Grippianern, einem der vielen Wundervölker. Die Begegnung dient der weiteren Läuterung des Helden und verdeutlicht die Herausforderungen, denen er sich auf seiner Reise stellen muss.
- 2. Ausweglosigkeit, Läuterung und Rettung auf dem Magnetberg: Hier wird die Reise des Helden zum Magnetberg beleuchtet, die mit Gefahren und Prüfungen verbunden ist. Durch die Begegnung mit dem Riesenkönig wird Herzog Ernst erneut auf die Probe gestellt und erlangt ein tiefes Verständnis der Bedeutung von demuot.
- 3. Die Ereignisse im Königreich der Arimaspi: In diesem Kapitel werden die Begegnungen Herzog Ernsts mit den Arimaspi und anderen Wundervölkern beschrieben. Es wird deutlich, wie der Held durch seinen Mut und seine Klugheit die Herausforderungen meistert und seine Fähigkeiten im Kampf und in der Diplomatie unter Beweis stellt.
Schlüsselwörter
Die zentralen Begriffe und Themen des Werkes „Herzog Ernst“ sind Spielmannsepik, êre, demuot, Läuterungsprozess, Vater-Sohn-Konflikt, Orientfahrt, Wundervölker, Kommunikation, Konfliktlösung, Hierarchische Hofgesellschaft. Die Arbeit analysiert den Werdegang des Helden im Hinblick auf seine Entwicklung von einem unbedachten jungen Mann zu einem gereiften Ritter, der durch seine Taten seine êre wiedererlangt und seinen Platz in der Gesellschaft findet. Die Arbeit beleuchtet dabei die Bedeutung von Kommunikation und dem Umgang mit dem Komplex von êre und demuot als zentrale Elemente für die Konfliktlösung und das Gelingen der Reise.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die zentralen Themen im Werk „Herzog Ernst“?
Zentrale Themen sind êre (Ehre) und demuot (Demut) sowie der Läuterungsprozess des Helden nach einem Konflikt mit dem Kaiser.
Was löst den Konflikt zwischen Herzog Ernst und dem Kaiser aus?
Der Konflikt entsteht durch die Heirat des Kaisers mit Ernsts Mutter und eskaliert durch Verleumdung und gescheiterte Kommunikation.
Welche Rolle spielen die Wundervölker auf der Orientfahrt?
Begegnungen mit Völkern wie den Grippianern oder Arimaspi dienen der Prüfung des Helden und verdeutlichen seinen Reifeprozess und Mut.
Wie erlangt Herzog Ernst seine êre zurück?
Durch seinen Dienst im gelobten Land (Jerusalem) und seine bewiesene demuot und Tapferkeit kann er den Konflikt in der Heimat lösen und wird wieder in die Gesellschaft integriert.
Was ist das Besondere an der Kommunikation im Werk?
Die Arbeit zeigt, wie das Gelingen oder Scheitern von Kommunikation unmittelbar mit dem Ehrbegriff verknüpft ist und den Verlauf der Handlung maßgeblich beeinflusst.
- Arbeit zitieren
- Markus Ständner (Autor:in), Iris Thoma (Autor:in), 2007, êre und demuot, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/92461