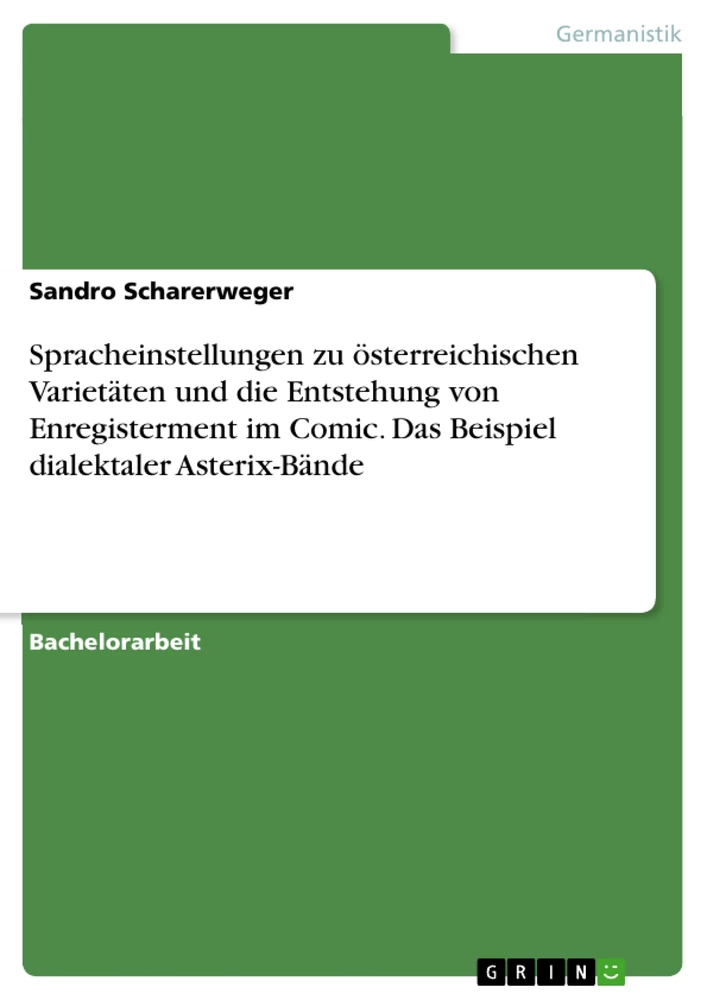Diese Bachelorarbeit beschäftigt sich mit den Einstellungen zu österreichischen Varietäten und deren Zusammenhang zur Entstehung von "Enregisterment". Dazu wird zuerst mithilfe einschlägiger Fachliteratur ein qualitativer Theoriebezug über Sprache im Allgemeinen sowie das österreichische Deutsch hergestellt.
Für die Einstellungen zu den österreichischen Varietäten wird Bezug auf frühere Forschungen genommen und darüber hinaus eine eigene Umfrage durchgeführt. Die Zusammenhänge werden anschließend anhand dialektaler Asterix-Bände verdeutlicht, indem die durch die Umfrage gesammelten Merkmale österreichischer Dialekte anhand der dialektalen Textkorpora analysiert werden, um letztendlich Aufschluss über den Verschriftlichungsprozess zu geben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Sprache als Verknüpfung von Lebewesen
- Aufbau der Arbeit, Hypothesen und Fragestellungen
- Varietäten und Subvarietäten innerhalb einer Sprache
- Standardsprache und Hochsprache
- Dialekte, Umgangssprache und weitere Ausprägungen
- Sprachregister und (un) bewusst eingesetzte Sprachmerkmale
- Das österreichische Deutsch
- Die Pluriarealität der deutschen Sprache
- Charakteristika des österreichischen Deutsch
- Enregisterment
- Einstellungen zu Dialekt und Standardsprache in Österreich
- Der Terminus Enregisterment
- Fallbeispiel Enregisterment: Asterix-Mundart-Korpora
- Methoden und Material
- Darstellung der Forschungsmethode
- Analyse und Ergebnisse österreichischer Spracheinstellungen
- Korpusanalyse
- Das Tirolerische: Obelix und's groaße Gschäft
- Das Steirische: Asterix ba di Olümpischn Schpüle
- Das Kärntnerische: Asterix ols Gladiatoa
- Das Wienerische: Da Woasoga
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht Einstellungen zu österreichischen Sprachvarietäten und deren Zusammenhang mit der Entstehung von „Enregisterment“. Sie betrachtet theoretische Grundlagen der Sprache, insbesondere des österreichischen Dialekts, und bezieht sich auf frühere Studien sowie eine eigene Umfrage. Die Arbeit beleuchtet die Zusammenhänge anhand dialektaler Asterix-Bände, analysiert die aus der Umfrage gewonnenen Merkmale österreichischer Dialekte im Kontext der dialektalen Textkorpora und gibt Aufschluss über den Verschriftlichungsprozess.
- Einstellung zu österreichischen Sprachvarietäten
- Entstehung von „Enregisterment“
- Analyse dialektaler Asterix-Bände
- Verschriftlichungsprozess österreichischer Dialekte
- Zusammenhang zwischen Spracheinstellungen und Enregisterment
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Thema Sprache als Verknüpfung von Lebewesen vor und erläutert die Bedeutung von Varietäten und Registern. Sie führt in das Konzept von „Enregisterment“ ein und legt den Fokus auf österreichische Mundart-Bände des Asterix-Comics. Das Kapitel „Varietäten und Subvarietäten innerhalb einer Sprache“ beschreibt Standardsprache, Dialekte und Umgangssprache sowie die Rolle von Sprachregistern. Der Fokus liegt auf den unterschiedlichen Ausprägungen und Realisierungen der Sprache. Das Kapitel „Das österreichische Deutsch“ behandelt die Pluriarealität der deutschen Sprache, die Charakteristika des österreichischen Deutsch und das Konzept von „Enregisterment“. Es werden die spezifischen Merkmale des österreichischen Dialekts sowie die Besonderheiten des Enregisterment-Prozesses beleuchtet.
Das Kapitel „Einstellungen zu Dialekt und Standardsprache in Österreich“ befasst sich mit den Einstellungen der Bevölkerung zu österreichischen Sprachvarietäten. Es werden die Ergebnisse einer durchgeführten Umfrage analysiert und die Beliebtheit von verschiedenen Dialekten sowie deren Wahrnehmung in der Gesellschaft beleuchtet.
Das Kapitel „Methoden und Material“ beschreibt die Forschungsmethode und die Analyse der Daten. Es werden die verwendeten Korpora vorgestellt und die Ergebnisse der Analyse der österreichischen Spracheinstellungen sowie der dialektalen Asterix-Bände dargestellt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Themen österreichische Sprachvarietäten, „Enregisterment“, Dialektanalyse, Sprachregister, Spracheinstellungen, Asterix-Mundart-Bände und Verschriftlichungsprozess. Sie analysiert die Beziehung zwischen Spracheinstellungen und Enregisterment im Kontext der dialektalen Asterix-Bände, untersucht die spezifischen Merkmale österreichischer Dialekte und deren Darstellung in schriftlicher Form.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet der Begriff "Enregisterment"?
Enregisterment bezeichnet den Prozess, durch den bestimmte sprachliche Merkmale als Anzeichen für ein bestimmtes Register oder eine soziale Identität (z. B. ein Dialekt) wahrgenommen und kulturell verankert werden.
Was sind die Charakteristika des österreichischen Deutsch?
Das österreichische Deutsch ist durch seine Pluriarealität geprägt und weist spezifische Merkmale in Phonetik, Lexik und Grammatik auf, die es von anderen Varietäten des Deutschen unterscheiden.
Warum wurden dialektale Asterix-Bände für die Untersuchung gewählt?
Diese Comics dienen als Korpus, um den Verschriftlichungsprozess von Dialekten (wie Tirolerisch, Wienerisch oder Kärntnerisch) und deren mediale Repräsentation zu analysieren.
Wie ist die Einstellung der Österreicher zu ihren Dialekten?
Umfragen zeigen eine hohe emotionale Bindung an Dialekte, wobei die Wahrnehmung je nach Region und sozialem Kontext zwischen "urwüchsig/beliebt" und "unstandardisiert" variieren kann.
Welche Rolle spielt die Standardsprache im Vergleich zum Dialekt?
Die Standardsprache dient als formelles Register, während Dialekte und Umgangssprache oft für Nähe und regionale Identität stehen; beide werden je nach Situation bewusst eingesetzt.
- Arbeit zitieren
- Sandro Scharerweger (Autor:in), 2018, Spracheinstellungen zu österreichischen Varietäten und die Entstehung von Enregisterment im Comic. Das Beispiel dialektaler Asterix-Bände, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/924654